DÜSSELDORF. Kinder aus nichtreligiösen Familien teilen eher als gläubig erzogene Kinder. Laut einer aktuellen Studie sind sie gleichzeitig toleranter gegenüber dem Fehlverhalten anderer.
Religiöse Werte lenken unterstützen Erziehung und bringen Kindern bei, gütig und großzügig zu sein, das nimmt man gemeinhin an. Psychologen aus Chicago bezweifeln das jetzt in einem Artikel in einem Fachmagazin. Ihre Studie zeigt, dass Kinder aus religiösen Familien weniger teilen und Fehler anderer kritischer einschätzen als Kinder aus nicht gläubigen Familien.
Der Versuchsaufbau sah das folgende Szenario vor: 1.170 Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren aus sechs unterschiedlichen Ländern (Kanada, China, Jordanien, Türkei, USA und Südafrika) bekamen Aufkleber geschenkt. Nicht alle Kinder würden Aufkleber bekommen, da die Zeit nicht reiche, sagten die Forscher den Kindern. Wenn sie wollten, können sie den fremden Kindern, die sonst leer ausgehen würden, einige von ihren eigenen Aufklebern abgeben. Dieses Spiel, das auch „Diktator-Spiel“ genannt wird, soll die Großzügigkeit messen. Das Ergebnis: Kinder aus christlichen und aus muslimischen Haushalten teilten deutlich weniger gern als Kinder aus nicht gläubigen Haushalten. Je stärker die Religiosität der Eltern, desto mehr behielten die Kinder die Aufkleber für sich. Auch das Alter spielte eine Rolle: Bei älteren Kindern war der Effekt deutlich ausgeprägter. Keine Rolle spielte die Art der Religion – christlich und muslimisch erzogene Kinder waren gleich geizig.
Ging es allerdings um das Fehlverhalten dern Anderen – wie schubsen oder anrempeln – waren religiös erzogene Kinder strenger. Sie traten für deutlich härtere Strafen ein als Kinder aus nicht gläubigen Familien. Dieses Verhalten deckt sich keineswegs mit der Einschätzung der Eltern. So schätzen die religiösen Mütter und Väter ihre Kinder als ganz besonders emphatisch ein. Besonders Christen halten große Stücke auf den Gerechtigkeitssinn ihrer Sprösslinge. Wenn in früheren Studien Gläubigen besonders hohe moralische Werte bescheinigt wurde, haben die sich offenbar auf Selbstauskünfte gestützt, vermuten die Forscher.
Das Ergebnis verwundert. Warum nun sollten ausgerechnet religiös erzogene Kinder weniger altruistisch sein? Die Forscher ziehen dafür das Prinzip des „Moral licensing“ heran. So wird das Verhalten genannt, wenn eine gute Tat als unbewusste Rechtfertigung für oft schwerer wirkende Missetaten dient. So ernähren sich Menschen, die täglich Multivitaminpräparate zu sich nehmen, deutlich ungesunder, und Menschen, die der Umwelt durch energiesparende Glühlampen helfen wollen, lassen diese dann länger brennen. Religiöse Menschen deuten ihren Glauben möglicherweise als Errungenschaft und rechtfertigen so unbewusst Egoismus und Intoleranz. „Das Phänomen des Moral Licensing ist gut etabliert“, so die Wissenschaftler. „Es kann egoistisches Verhalten fördern und prosoziales Verhalten einschränken, und es könnte erklären, warum Kinder aus gläubigen Haushalten weniger altruistisch sind.“
Den Originaltext zur Studie finden Sie hier
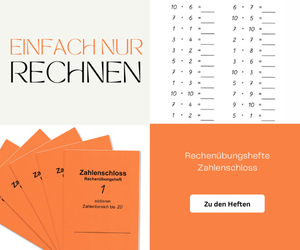
Es fällt auf, dass nicht klar genannt wird, wer die Studie durchgeführt hat. Trau keiner Statistik, die du …
Ich traue der Studie von vorn bis hinten nicht. Sie passt aber in unsere Zeit mit ihrem ausgeprägten Bestreben, vor allem den christlichen Glauben zu diskreditieren. Er scheint, ähnlich wie die Lebensform der traditionellen Familie, den Gesellschaftsveränderern mächtig im Weg zu stehen.
Ob gegen Christen weiß ich nicht, weil die Religionsgruppe gemäß der Studie keine Rolle spielt.
Wörtlich: “Das Ergebnis: Kinder aus christlichen und aus muslimischen Haushalten teilten deutlich weniger gern als Kinder aus nicht gläubigen Haushalten.”
genau. die religion ist egal. den Unterschied macht nur religiös oder nicht religiös.
Nach wikipedia sind in den USA bezogen auf die Umfrage etwa 71% christlich (davon rund 47% protestantisch, 21% katholisch) 0,9% muslimisch und 23% nicht-gläubig. Ob die Mormonen (1,6%), Zeugen Jehovas (0,8%) und orthodoxen (0,5%) unter den Christen befragt wurden, geht aus dem Artikel nicht hervor. Mich würde allerdings nicht überraschen, wenn zumindest die Mormonen “vergessen” wurden.
Nicht befragt wurden jedenfalls die Juden (1,9%) und Buddhisten (0,7%). Es leben in den USA also mehr Juden als Muslime und Buddhisten zusammen. Viele der Juden sind sehr radikal _und_ haben viel Geld, also eine starke Lobby. Ob sie sich für gleicher und / oder besser als andere halten und wegen möglicher schlechter Publicity die Befragung erfolgreich verhindern konnten, kann nur der liebe Gott, dessen Existenz ich als atheistischer Agnostiker zwar nicht kategorisch abstreite, sie aber erst akzeptiere, wenn sie naturwissenschaftlich zweifelsfrei nachgewiesen wurde, beantworten.
janatürlich steckt das internationale Finanzjudentum dahinter, wie auch hinter allen anderen Übeln einschließlich der Erderwärmung. Ja, das ist ironisch gemeint. Es ist sogar als Kritik an Ihrem Beitrag gemeint. Egal ob Sie religiöse oder die vielen atheistisch-agnostischen Juden verdächtigen.
Ich habe die Juden nicht verdächtigt. Ich habe die Studie kritisiert, die sich auf Christen und Muslime beschränkt, obwohl der Anteil Juden in den USA etwa doppelt so groß ist wie der der Muslime, und bei den Juden auf ihren Einfluss auf die US-amerikanische Gesellschaft hingewiesen.
Ich weiß, dass die Juden in ihrer gesamten Geschichte (Moses über Jesus Christus, Judenverfolgung im Mittelalter bis zum Zweiten Weltkrieg) für vieles verantwortlich gemacht wurden und entsprechend zu leiden hatten. Ich weiß aber auch, dass sie das Kreditwesen (aus der Not, keine anderen Berufe ausüben zu dürfen) erfunden haben und den Diamantenmarkt in Antwerpen kontrollier(t)en. Ich hoffe, dass Sie bei Ihrem Kommentar nicht an die ach so armen Juden in Israel gedacht haben, die die bösen bösen Palästinenser … aber lassen wir das. Die meisten Menschen auf der Welt wollen in Frieden und bescheidenem Wohlstand leben. Ein paar wenigen Idioten reicht das nicht, sie wollen mit Gottes, Jehovas, Allahs, Fox News, NRAv und wer weiß sonst wessen Hilfe immer mehr Reichtümer anhäufen. Dafür lassen sie im Wahrsten Sinne des Wortes ein paar kleine Würstchen über Leichen gehen.
wer je Einblick in das Innere einer religiösen Gemeinschaft hatte, dürfte über das Ergebnis der Studie eigentlich nicht verwundert sein. Jegliche geistige Abgrenzung führt zu Abschottung, Selbstgerechtigkeit und Gruppenegoismus!
Verzeihung, Euer Ehren, aber dieser Generalisierung kann ich nicht folgen. Ihr eigener Einblick scheint sich doch sehr in Grenzen zu halten oder Sie wollen agitieren.
Wo sehen Sie z. B. “Abschottung, Selbstgerechtigkeit und Gruppenegoismus” bei unseren Landeskirchen? Besonders die ev. Kirche zeigt sich dermaßen tolerant und willkommensfreudig anderen Religionen gegenüber, dass sie viel Kritik von den Mitgliedern einstecken muss, die ihr in Scharen davonlaufen, weil sie zunehmend die biblische Botschaft vermissen und eingeengt sehen auf politische Forderungen im Sinne der Grün-Partei.
Was Sie schreiben, mag auf einige Sekten zutreffen, deren Mitglieder in der Tat oft selbstgerecht sind und sich als Auserwählte fühlen. Das gibt es sowohl im Christentum als auch im Islam.
Im Islam fällt dieser Tage der IS durch seine Selbstgerechtigkeit auf, die sogar über Leichen geht.
Tatsächlich, die sind sogar so “tolerant” und gründen in Hannover ein Studienzentrum für Gendermainstreaming. Kostet mal nur so “schlappe” 280 000 EURO im Jahr.
Möglicherweise wird die offersichtlich weg schauende Kirchengemeinde demnächst mit einer gender – konformen Bibel überrascht. Zumindest soll daran gearbeitet werden.
werden dann aus den 12 Aposteln 6 Männer und 6 Frauen oder 24 mit je 12 Männern und Frauen? Johannas Evangelium klärt das sicherlich auf.
Frauen gehörten und gehören aber auch zur Anhängerschaft von Jesus, wahrscheinlich hatte er auch eine Frau, Kinder und Geschwister. War für die Leute damals alles normal, deshalb wird es nicht eigens erwähnt.
Frauen gehörten zweifelsfrei zur Anhängerschaft von Jesu. Immer wieder wird z.B. der Name von Maria Magdalena genannt.
Vermutet wird, dass er auch Ehemann und Vater war. Ich kenne aber keine seriöse Quelle, in der der das bestätigt wird.
Die relativ seriöseste Quelle dafür ist “Jesus Christ Superstar”.
Für eine Allaussage dieser Art sollten Sie aber eine lange Belegeliste anführen. Fangen Sie doch bitte mit der EKD und mit den englischen Methodisten zur Zeit Wilberforces an.
Pälzer, das verstehe ich nicht. War denn Jesus ein frauenfeindlicher single?
Jesu war doch ein Menschenfreund. Damit ist Ihre Frage beantwortet.
Heute Abend habe ich die Sendung “Vorsicht Verbraucherfalle” in der ARD gesehen. Interessant war der Beitrag, wie ein Fernsehteam ein Schlankheitsmittel aus Placebo-Pillen mit Erfolg in den Markt schleusen kann. Dazu brauchte es eine wissenschaftliche Studie für dessen hohe Wirksamkeit. Ein eingeweihter Wissenschaftler übernahm diesen Auftrag und erklärte freimütig, wie leicht es ist, Studien für gewünschte Ergebnisse zu erstellen: Man nehme korrekte Daten, stelle sie aber in einen anderen Zusammenhang, der dem beabsichtigten Zweck des Auftraggebers dient, und schon gibt es eine (legale) Studie, die beweist, was bewiesen werden soll.
Wenn die Sache bei Pillen und deren Wirksamkeit schon so einfach ist, dann ist zu fragen, wie viel einfacher es sein muss, Pseudo-Studien zu Positionen auf gesellschafts-, sozial- und bildungspolitischen Gebieten zu erstellen, die ohnehin schwammig und schwer nachprüfbar sind.
An etlichen Studienergebnissen die hier bei n4t vorgestellt wurden, hatte ich schon dickste Zweifel, doch bei diesem reißerischen Artikel “Atheistische Kinder sind großzügiger als Religiöse – schadet Glaube der Moral?” ist mir endgültig klar geworden, wie dreist bei Pseudo-Studien auf die Wissenschaftsgläubigkeit der Menschen gesetzt wird. Und das Ziel dieser Studie dürfte eindeutig klar sein.
Das schöne an wissenschaftlichen Studie ist, dass die Quellen, Ergebnisse und Schlüsse offengelegt werden müssen – also transparent und damit kritisierbar sind. Sie können sich also jederzeit die vorliegende Studie schnappen und entsprechend bearbeiten. News4teachers hat ja sogar den Link zur Studie angegegeben. Wissenschaftsgläubigkeit? Das ist genau so ein Dumpfbacken-Kampfbegriff wie “Lügenpresse” oder “die unehrlichen Politiker”. Wie schön: Sie haben im Fernsehen einen gesehen, der gesagt hat, er kennt einen … Super Quelle, um Pauschalaussagen zu treffen. Natürlich, “die” Wissenschaft mogelt und betrügt, wo sie nur kann. Woher der ganze technische und medizinische Fortschritt kommt, der uns umgibt? Dann wohl vom Himmel.
Word!
So, so . Wissenschaftsgläubigkeit ist ein böses Wort. Dann sollte man mal bei Hans-Peter Dürr nachlesen, wie er die “Objektivität” der Wissenschaft anhand ihrer “Netze” beschreibt.
Und was mich an Annas Beitrag am meisten irritiert : Sie wendet sich gegen “Kampfbegriffe” und verwendet doch selbst aggressive Rhetorik – bestes Beispiel für ? Richtig : WISSENSCHAFTSGLÄUBIGKEIT !!
Was bedeutet denn das Schreiben in Versalien? Dass Sie den Begriff innerlich SCHREIEN? Macht ihn trotzdem nicht intelligenter. Anna hat doch ausgeführt, dass Studien natürlich kritisierbar sind. Man muss sich allerdings schon die Mühe machen, sich mit ihnen zu beschäftigen – sonst ist Kritik einfach nur HERUMGETROLLE. Und dass Hans-Peter Dürr, verstorbener Direktor des Max-Planck-Institut für Physik, sich (selbst-)kritisch mit der eigenen Profession auseinandergesetzt und über wissenschaftliche Erkenntnisgrenzen geschrieben hat, kann schwerlich als Begründung dafür herhalten, Studien, deren Ergebnisse mir nicht passen, pauschal als unseriös abzuqualifizieren.
Ich stimme Anna zu, wenn sie darauf hinweist, dass man sich die Studie anschauen, ihre Fragestellung und Methoden analysieren und sie dann wohlbegründet bejahen, anzweifeln oder ablehnen kann. Ich tue das hier nicht, weil mir meine Kursarbeits-Korrekturen im Nacken sitzen. und weil noch viele weitere Studien mit sehr zweifelhaften Ergebnissen (subjektives Werturteil) in die Welt trompetet werden werden, die dann ebenfalls Zeit fordern. So bleibt es bei der Kontrastierung der Aussage der Studie mit meiner Alltagserfahrung, welche nämlich anders ist – ich kenne viele religiöse Kinder, die gerne teilen und auf andere achten – und bei der unbeantworteten Frage:
Wer hat diese Studie denn nun in Auftrag gegeben oder durchgeführt? Welches Eigeninteresse steht dahinter?
Ich sehe da mehrere unklare Punkte (und bin da den Kommentaren zu der Studie im Link nicht die Einzige), die für eine solche Studie definitiv relevant sind: Wieviele Kinder lebten in den Haushalten? Haben die Kinder gelernt, zu teilen, weil sie vielleicht zwei Geschwister haben – oder sind es mehr Einzelkinder? Wie sind die Erziehungsstile der Eltern? Welche religiöse Einstellung hat der Autor der Studie? Welchen sozialen Status haben die Kinder? Wie ist die politische Haltung in den jeweiligen Ländern/Haushalten? (China…) Die kulturellen Hintergründe spielen ebenso eine Rolle. Zudem ist ganz wesentlich der Umstand, dass die Kinder durch eine Autpritätsperson gesagt bekamen, dass andere unbekannte Kinder keine Sticker erhalten und sie diese behalten sollen. Vielleicht sollte das auch eine Rolle spielen bei so einer Bewertung. Im Großen und Ganzen sagt diese Studie also eigentlich nichts aus – weder für/gegen eine, noch für/gegen eine andere Seite.
https://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(19)30875-9.pdf
See also the Retraction Notice.
Es ist ganz logisch, warum gläubige Kinder weniger altrusitisch sind. Der Grund dafür ist, dass sie von klein auf ein kleines, ichbezogenes und dummes Weltbild ausgerichtet wurden, dass nur dazu dient, Zufriedenheit zu bekommen, indem man das Glaubt was man dafür Glauben muss und ausschliesen muss, was man dafür ausschliesen muss. Wenn ein Kind keine religiöse Erziehung hat, ist es von Natur aus offener gegenüber neuen Dingen, und kann demendsprechend auch mehr erfahrren und dieses Dinge aus einer objektiveren und damit originelleren Perspektive sehen, während ein religiöses Kind darauf programiert ist, alles sofort auszuschliesen, das nicht in seinem Glaubenssystem passt. Deshalb haben Atheisten ein viel originelleres Weltbild als Gläubige, weil diese von klein auf ein Glaubenssystem einprogramiert bekommen, das sich auch nicht ändert, und danach die gesamte Welt definieren, anstat, dass man so klug ist, und sich und das eigene Weltbild, nach der unergründlichen und sich ständig verändernden Welt ausrichtet. Ich selbst war Christ weil ich dazu erzogen wurde. Und obwohl ich immer aufmerksam und hoffnungsvoll zugehört und selbser daran gearbeitet habe es zu verstehen, ich habe es nie wirklich verstanden. Ein Kind versteht es nicht, dass es beten, teilen und busse tun soll, nur weil vor 2000 Jahren ein Mann ans Kreuz genagelt wurde. Ganz ehrlich, ich habe es früher nicht verstanden wovor uns Jesus gerettet haben soll indem er ans Kreuz genagelt wurde. Wenn man nur deshalb und für den Himmel lebt, und das nicht versteht, handelt man auch nicht richtig. Wenn man ein atheistisches Kind fragen wird, warum er Gutes tut, wird er nicht antworten, weil Jeses es so gesagt hat, sondern weil er Freude daran hat, dass er jemand anderes Glücklich machen konnte.