DÜSSELDORF. Brockhaus und Enzyklopädia Britannica waren einmal – die Verlage haben den Verkauf der traditionsreichen Lexika eingestellt und beugen ihr Haupt vor dem Online-Nachschlagewerk Wikipedia. Die Plattform, die am 15. Januar 15 Jahre alt wird, ist trotzdem umstritten. Einige ihrer Probleme, wie etwa die öffentlich und für jedermann zugänglichen Pornobilder, wurden bereits auf News4teachers.de diskutiert. Fakt ist dennoch: Wikipedia sammelt immenses Wissen und hat eine große Vision. Kostenlos soll möglichst viel Wissen möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht werden. Was die Plattform nach 15 Jahren wirklich kann und was eher nicht – eine Bilanz.
1. Wikipedia ist Aufklärung für breite Bevölkerungsschichten
In diesem Punkt hat sich Wikipedia großes Lob verdient: Vermutlich hat die Plattform dieses Ziel besser erreicht als alle ihre gedruckten Vorgänger. Laut Internetmarktforschungsinstitut Alexa.com steht Wikipedia hinter den Platzhirschen google, facebook, youtube, baidu, yahoo und amazon weltweit auf Platz sieben der meistgeklickten Webseiten. Rudolf Stöber, Wissenschaftler an der Universität Bamberg, der zum Thema forscht, sieht in der Plattform sogar ein Instrument der Aufklärung nach Immanuel Kant: “Das Grundprinzip der Aufklärung ist mit Immanuel Kants berühmtem Diktum vom „Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit“ am treffendsten umschrieben. Wikipedia ist ein Ausweis der Selbstaufklärung, insoweit die Wikipedia-Gemeinde, also ihre Autoren und Leser, sich um Wissensakkumulation bemühen.”
2. Computer-Technik- und popkulturelle Themen sind weitestgehen faktentreu wiedergegeben
Hier gibt es Lob und Tadel: Vergleicht man Wikipedia mit den klassischen und kommerziellen Lexika in Bezug auf Faktentreue, schneidet das Online-Nachschlagewerk nach Expertenmeinung bei den Themen Computer – Technik und Popkultur regelmäßig gut ab. Schwächen weist sie in den Kultur- und Geisteswissenschaften auf.
3. Vor allem bei politisch-ideologischen Themen sind viele Texte unausgewogen
Das ist der größten Kritikpunkt an der Plattform: Viele Texte sind unausgewogen und weit davon entfernt, annähernd objektives Wissen zu liefern. Die Liste dieser Beispiele im Bereich der politisch-ideologischen Themen ist umfangreich.
Am 7. Januar 2016 fragte beispielsweise die Medienfachseite kress.de “Haben Mitarbeiter des Verfassungsschutzes in Wikipedia herumgeschrieben, Behördenkritik gelöscht und den Eintrag zum entlassenen Generalbundesanwalt Harald Range geändert? Darauf deutet einiges hin.” Offenbar sind von IP-Adressen, die dem Verfassungsschutz zugeordnet werden können, u.a. Einträge über James Bond-Filme (!), über andere Behörden und über den umstrittenen Range geändert worden.
Der Bamberger Wissenschaftler Stöber schrieb unlängst dazu in einem Aufsatz: “Wenn man sich derzeit Einträge zur Ukraine, zum Abschuss des malaysischen FlugzeugsMH 17 am 17. Juli 2014 oder zum Freihandelsabkommen TTIP anschaut, wird die Strittigkeit der Einträge schon bei kursorischer Einsichtnahme deutlich. In der deutschen Wikipedia etwa gibt es keinen Artikel zum Flug, in der englischen hatten sich bis dato (Anmerkung der Redaktion: Hier ist das Datum des fertigen Beitrags des wissenschaftlichen Autoren gemeint, bis heute kann sich das natürlich geändert haben.) mehr als 800 Autoren mit über 5.200 Versionen beteiligt.”
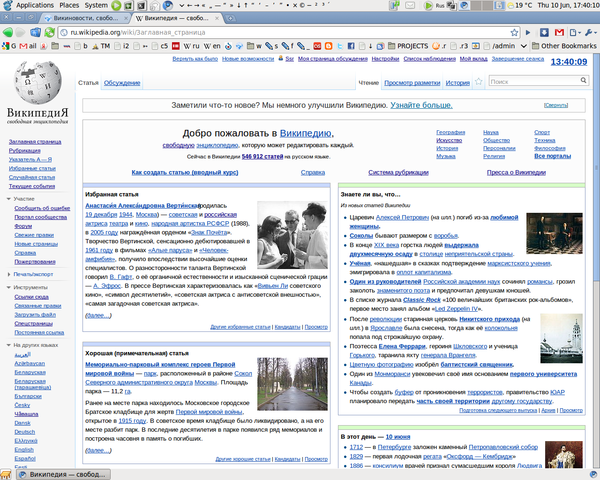
4. Das Wissen aus Wikipedia muss hinterfragt werden
Eigentlich logisch. Wissenschaft und Selberdenken zu ersetzen, war niemals der Zweck von Lexika. “Die klassischen deutschen Lexika seit dem 19. Jahrhundert, die Konversationslexika, führten den Hauptzweck zumeist im Titel: Sie sollten der Konversation, der gepflegten Unterhaltung, dienen”, erklärt der Bamberger Wissenschaftler Rudolf Stöber. Die Lexika stellten gesichertes, präzises, stabiles Wissen bereit. Davon ist Wikipedia weit entfernt. Im Online-Lexikon finden sich gesichertes Wissen neben höchst aktuellen und umstrittenen Themen.
5. Struktur und Qualität der Text ist höchst unterschiedlich
Angesichts der unterschiedlichen Autoren ist es nicht verwunderlich, dass auch die Struktur und Qualität der Texte höchst unterschiedlich sind. Alle Bemühungen um Qualitätssicherung können nicht verhindern, dass Artikel etwa überlang sind oder eine unsortierte Ansammlung von Fakten präsentieren. Inkonsequent mutet die Regelung zur Autorentransparenz an. Einerseits wird Bearbeiter-Transparenz hochgehalten, andererseits lässt sie sich nicht völlig durchhalten, weil Autoren mit Alias-Identitäten zugelassen sind. Darüber hinaus schwele im Kreise der Wikipedia-Aktivisten
seit Jahren der Streit zwischen „Inklusionisten“, die eher auf Addition der Informationen setzen, und „Deletionisten“, die Zusammenstreichen für
unerlässlich halten, erklärt Wissenschaftler Stöber. nin
Mehr Informationen
Die aktuelle Publikation der Universität Bamberg zum 15. Wikipedia-Geburtstag finden Sie hier
Der Wiki-Watch-Blog der Universität Frankfurt/Oder
Ihre Beurteilung von Wikipedia finde ich im Großen und Ganzen zutreffend, Frau Braun. Licht- und Schattenseiten sehe ich ähnlich.
Die “Augsburger Allgemeine” bringt in einer Kritik noch den mir wichtigen Aspekt der Meinungsmanipulation durch Wikipedia:
“Früher galt stets der Spruch: “Papier ist geduldig” – insbesondere im wissenschaftlichen Bereich. Eine Aussage einfach hinzunehmen, ohne eine Gegenquelle geprüft zu haben, war einfach ein Unding. Aber auch im privaten Bereich hat man gedruckten Dingen nicht einfach so Glauben geschenkt, sondern sie hinterfragt. Wer jedoch Wikipedia einfach übernimmt, ohne den Inhalt zu hinterfragen, liefert sich demjenigen aus, welcher Wissen nach seinem eigenen Gutdünken für Wahrheit hält. Doch solche Tendenzen sind bei einem Medium, das sich als freiheitlich deklariert, besonders stark zu kritisieren. Denn sie sind gefährlich: Das Nebeneinander von vielen trügerischen Einzelwahrheiten zu unterschiedlichen Themen, zusammengefasst unter einer Domain, ermöglicht es einer Minderheit, die ehemals kritische kommunikative Masse zu beeinflussen und dadurch die allgemeine Meinungsbildung mitzubestimmen (z. B. wenn es um Personenbeschreibungen geht).
Wikipedia allein kann also nicht das Allheilmittel sein. Das kritische Denken, Zweifeln und Hinterfragen sollten wir daher nicht weggeben, sondern uns nachhaltig bewahren. Oder wollen wir wirklich zurück in die “selbstauferlegte Unmündigkeit”, aus der uns die Aufklärung einst herausgeholt hatte?”
http://www.augsburger-allgemeine.de/community/profile/Till_Eulenspiegel/Kritik-an-Wikipedia-Die-neue-Inflation-des-Wissens-id26635776.html
“In der deutschen Wikipedia etwa gibt es keinen Artikel zum Flug”
Wie soll das zu verstehen sein? In der deutschsprachigen Wikipedia existiert seit dem Absturz ein eigenständigen Eintrag.
Außerdem ist an Ihrem Beitrag genau das zu bemängeln, was Sie der Wikipedia vorwerfen. Der zweite Punkt, wo sie von “Expertenmeinung” reden, ist vollständig unbelegt – auf welche Experten beziehen Sie sich?
Und was soll dieser Screenshot der russischen Wikipedia illustrieren?
Ein großer Vorteil, der hier keinerlei Erwähnung findet, ist die Aktualität.
Die von Ihnen gezogene Bilanz ist, gelinde gesagt, sehr oberflächlich und ich wundere mich, dass daraus tatsächlich ein eigenständiger Beitrag erwachsen ist.
Mit Verlaub, Ihr Kommentar ist mehr Polemik gegen den Artikel der Redaktion als fundierte Meinung.
Es gibt viele kritische Veröffentlichungen zu Wikipedia. Hier nur eine:
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/wikipedia-in-der-kritik-die-entwurzelung-des-wissens-1461719.html
Natürlich trägt mein Kommentar einen polemischen Charakter. Dies erlaube ich mir auch bei einem so unausgewogenen Beitrag, der im Titel das Wort “Bilanz” trägt, im Nachhinein aber wenig bilanziert.
Sie berufen sich außerdem auf einem neun Jahre alten Artikel, der mitnichten im Zusammenhang zu den o.g. Problemen steht und dessen Aussagen an mehreren Punkten Fragen aufwerfen.
Das Wikipedia-Prinzip ist in all den Jahren gleich geblieben. Also ist es egal, wie alt der Artikel ist.
Gestern haben Sie geschrieben: “Ein großer Vorteil, der hier keinerlei Erwähnung findet, ist die Aktualität.” Genau dies kann aber auch von erheblichem Nachteil sein.
Allerlei Halbwissen und Unwissen gepaart mit unseriösen Urteilen bereichert dann wikipedia und bleibt in so manchem Kopf hängen oder wird als gesicherte, enzyklopädische Wahrheit nachgeplappert und weitergegeben.
Spiegel-online titelte mal einen Artikel “Schwarmintelligenz: Gemeinsam sind wir dümmer”.
Sie werden sich damt abfinden müssen, dass ein Online-Nachschlagewerk nach dem Muster von Wikipedia Vorteile, aber auch Nachteile hat. Die Schwächen zu bestreiten und wütend zu werden, wenn ein anderer sie an bestimmten Stellen sieht, ist keine vertrauensbildende Maßnahme für Wikipedia.
Sie berufen sich auf einen Artikel der mehr als halb so alt ist wie die Wikipedia und in dem es heißt, dass „Die Geschichtswissenschaft liefert derzeit eine fundierte Auseinandersetzung mit diesem Phänomen, und Wikipedia muss sie fürchten. Entsprechend seinen Produzenten, die vornehmlich aus dem Bereich der Technik- und Naturwissenschaften stammen, vertrete Wikipedia, so Lorenz, ein positivistisches Geschichtsverständnis.“. Ob das so geblieben ist, ist aus einem so alten Eintrag beileibe nicht ersichtlich. Daran ändert auch das gleichbleibende Wiki-Prinzip nichts.
Die Weiternutzung der Wikipedia liegt nicht in der Verantwortung der Plattform/der Autoren. Dafür ist jeder selbst verantwortlich, deswegen kann man ihr selbst daraus wohl keinen Strick drehen und daran die Aktualität messen. Die sog. Schwarmintelligenz, die Sie in diesem Zusammenhang erwähnen, kann jedoch den Horizont öffnen; sie hilft, etwas aus unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen, was bei Monographien nicht der Fall ist.
Ich habe nie bestritten, dass die Wikipedia Vor- und Nachteile hat; sie sind mir zur Genüge bekannt. Nur sehe ich in diesem Nachrichtenbeitrag keine ausgewogene Darstellung im Sinne einer Bilanz. Weiterhin ist es wohl auch mein gutes Recht, dass ich genannte Nachteile kritisch betrachte. Sonst wären wir ja wieder dabei, alles für bare Münze zu nehmen. Ich äußere mich hier nicht, um Vertrauen für die Wikipedia zu schaffen, sondern weise daraufhin, dass man differenzierter an die Sache herangehen und einen Nachrichtenbeitrag nicht in zehn Minuten schreiben sollte.
Es hindert Sie niemand, differenzierter an die Sache heranzugehen und hier eine weniger “oberflächliche” Bilanz für 15 Jahre Wikipedia zu schreiben. Es gibt bei n4t keine Einschränkung in der Länge der Kommentare. Also los!
Nur Meckern und Mosern ohne auf Aussagen einzugehen, die angeblich “an mehreren Punkten Fragen aufwerfen”, die Sie nicht näher erläutern, gilt nicht. Machen Sie es besser, nennen Sie die Fragen und gehen Sie darauf ein.
Wenn der Artikel die Redaktion Ihrer Meinung nach nur 10 Minuten Zeit kostete, dann dürften Sie ja in 1Stunde oder auch etwas länger ein wahres Meisterwerk abliefern.
Was angeblich in nur 10 Minuten geschrieben wurde, gefällt mir nämlich recht gut.
Ich werde mich hüten, die 15 Jahre zu bilanzieren. Dieses Ziel hat sich die Autorin gesetzt – nicht ich mir. Ich habe genug Hinweise gegeben, wo die “Bilanz” hakt, dieses sollte Ihnen deutlich geworden sein. Ihren Spott an dieser Stelle halte ich für unangebracht. Schließlich bin ich hier kein Journalist, dessen Aufgabe es ist, hier Beiträge zu verfassen. Journalisten müssen sich, dadurch dass sie ihren Namen für einen Artikel hergeben, an ihren Leistungen messen lassen.
Natürlich gibt es einen Artikel zu MH17, https://de.wikipedia.org/wiki/Malaysia-Airlines-Flug_17, laut
https://tools.wmflabs.org/wikihistory/wh.php?page_title=Malaysia-Airlines-Flug_17 ist er zudem von 500 Personen fast 2500-mal bearbeitet worden und gehört damit zu den am häufigsten bearbeiteten Artikeln der deutschsprachigen Wikipedia überhaupt. Bitte diese falsche Behauptung entfernen oder seitens der Herausgebendenschaft entsprechend kommentieren. Zur restlichen „Qualität“ des Beitrages sage ich mal besser nichts …
Sehr geehrter Cato,
es handelt sich hier um einen Nachrichtenbeitrag, der natürlich nur an der Oberfläche kratzt. Für tiefer gehende Informationen können Sie sich gerne mit den Beiträgen der Universität Bamberg befassen, ich habe Sie unter dem Text verlinkt.
Viele Grüße
Nina Braun
Ein Grundproblem der – in vielen Bereichen unbestritten guten – Idee von Wikipedia ist der Glaube, dass bei umstrittenen Fragen eine Mehrheit der KommentatorInnen dafür sorgen wird, dass sachlich zutreffende und präzise Informationen stehen bleiben, andere gelöscht werden.
Es gibt aber – gerade in den genannten Kultur- und Geisteswissenschaften, ich möchte Philosophie, Geschichte, Soziologie und Theologie ergänzen – eine ganze Reihe von Stichworten, zu denen Artikel wichtig und nötig sind, in denen entweder a) eine Minderheit eine zutreffende Auffassung hat, sich aber gegen eine Mehrheit nicht durchsetzen kann, oder b) in denen schon Begriffs-Definition, Abgrenzungsfragen, Quellen etc. so strittig sind, dass man entweder gar nichts oder ein Buch zur Sache schreiben kann.
Das war in gedruckten Lexika auch so – aber da gab es normaler Weise einen Namen unter einem Beitrag, so dass man relativ leicht die Richtung zuordnen konnte (sofern man vom Fach ist).
Dennoch: Glückwunsch zu 15 Jahren Wikipedia!
Der wichtigeste Beitrag in 15 zum Thema Wikipedia ist wohl der Film “Die dunkle Seite der Wikipedia”. Er sorgte für größtes Aufsehen und liefert eine Reihe von verblüffenden Erkentnisse über die Strukturen hinter der deutschen Wikipedia
Nicht umsonst akzeptiere ich in Referaten, Facharbeiten usw. Wikipedia (und Google-Bildersuche) als Quellen nicht. Die Quellen, die die wikipedia angibt, hingegen schon. Die müssen die Schüler aber zumindest durchlesen. Der physikalische Bereich der wikipedia ist für schulische Zwecke häufig schon zu akademisch formuliert und damit für mich als Lehrer mit dem entsprechenden Hintergrund gut, für Schüler zu Recherchezwecken eher weniger geeignet.
Interessant aber, dass der Bereich Computer-Technik als “gut” beschrieben wird, die Geisteswissenschaften eher als “schwach”. Das Vorurteil, Geisteswissenschaft hat mit Wissenschaft im strengen Sinne nicht viel gemeinsam, wird erneut bestätigt.
Ihren letzten Satz verstehe ich nicht. Und was ist “Wissenschaft im strengen Sinne”?
Auch ich unterrichte an Schulen; mir geht es häufig mit den historischen Artikeln so, dass ich sie für SchülerInnen für zu schwer halte; jedenfalls dann, wenn ich einen Artikel gut und informativ finde.
Wikipedia-Artikel als Quelle nicht zu akzeptieren, funktioniert – meiner Erfahrung nach – in der Haupt- und Realschule nicht. Die SchülerInnen sind meist völlig hilflos, irgend etwas anderes als Wikiepdia (oder von ihr abhängige Beiträge) auch nur zu finden, geschweige denn zu lesen. Ich bin häufig schon froh, wenn sie einen mittelmäßigen Wikipedia-Artikel auch nur halbwegs verstehen & wiedergeben können; von Haupt- und RealschülerInnen zu verlangen, dass sie quellenkritisch vorgehen und einen eigenen Überblick über irgendeine Sache gewinnen, ist – leider – meistens Wunschdenken.
Aber deshalb ist Medienkompetenz doch so wichtig zu vermitteln: Wer nicht in der Lage ist, schlechte (=falsche) Information von guter, also verifizierter, zu unterscheiden, ist doch ein leichtes Opfer für all die Bauernfänger, die im Internet unterwegs sind – ob es politisch oder religiös Radikale sind und/oder Gauner und Verbrecher. Medienkompetenz ist die Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts – kommt m. E. gleich nach Lesen, Schreiben, Rechnen.
D’ accord – freilich die Basis, um tendenziösen, nicht einmal populärwissenschaftli- chen Schund von seriösen Inhalten zu unterscheiden, ist nun einmal gesichertes Wissen, das man sich selbst erarbeitet haben muß; und hierfür sind Handbücher und Lexika, die ja stets einer Endredaktion unterliegen, in meinen Augen ersatz- los.
Sie haben recht, an irgendetwas muss ich ja Informationen, die ich aus dem Internet hole, messen können. Das Problem ist nur: Es gibt ja kaum noch Quellen für verifziertes Wissen – die Wikipedia hat alle seriösen Lexika vom Markt verdrängt. Und mit einem Brockhaus von 1980 aus der Stadtbücherei kann ich Schülern die Funktionsweise von Wikipedia, Google, Facebook und Co nicht erklären.
Das Problem ist grundsätzlicher Natur: Eine “Geiz-ist-geil”-Mentalität beim Wissen und bei Informationen. Alles muss gratis oder billig sein, das ist bei den Schulträgern nicht anders als bei privaten Nutzern. Eine (wissenschaftliche) Redaktion zu unterhalten, kostet aber Geld. Wer ist bereit, dafür heute noch zu zahlen?
Man hätte hier durchaus noch konkreter werden können. In politisch ideologischen Themen sind die Artikel nicht unausgewogen, sondern massiv manipuliert. Wenn man mal drüber nachdenkt wie viele Themen heutzutage ideologisiert sind, bekommt man eine Vorstellung vom Ausmaß und Anzahl der politisch manipulierten Artikel auf der WP.
Richtig!!! U. a. sind politische, soziologische oder auch pädagogische Themen heutzutage dermaßen ideologisiert, dass Wikipedia nur so strotzt vor Aussagen, die mit größter Vorsicht zu genießen sind.
Wer hier in Wikipedia ein verlässliches, wissenschaftlichen Ansprüchen genügendes Auskunftswerk sieht, ist Manipulationen hilflos ausgeliefert.
Wikipedia macht eigene Informationen und Recherchen auf bestimmten Gebieten nötiger denn je.
Wer nur über ein wenig kritisches Bewusstsein und Medienkompetenz verfügt, wird in der Wikipedia immer wieder über Darstellungen stolpern, die vielleicht nicht falsch, in ihrer Einseitigkeit aber verzerrend sind. Wer mag, kann sich zum Beispiel ja mal den Beitrag über Scientology durchlesen – und dann für sich selbst die Frage beantworten, wer den wohl geschrieben hat.
Sollten Sie einen Zustand vorfinden, der Ihrer Meinung einseitig oder unausgewogen ist, sind Sie herzlich dazu eingeladen, selbst den Eintrag zu verbessern oder einen Baustein im Eintrag zu setzen und auf der Diskussionsseite zu präzisieren, wo die Missstände zu finden sind. Die Bausteine finden Sie unter https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bewertungsbausteine
Darum geht es aber nicht – ich will nicht die Wikipedia verbessern, ich will Schülerinnen und Schüler darüber aufklären, dass die Wikipedia von ihrer Konstruktion her kritisch zu sehen ist. Nicht falsch verstehen: ich habe nichts gegen die Wikipedia als schnelle erste Recherchequelle. Eine seriöse wissenschaftliche Quelle aber besteht nicht nur aus einer Ansammlung von mehr oder weniger geprüften Informationen, sondern auch aus einer Einordnung der Relevanz derselben. Und gerade an letzterem hapert es bei der Wikipedia bisweilen bedenklich – mit der Folge, dass etwa in dem Scientology-Beitrag ellenlang die “Lehre” und die “Praktiken” unreflektiert dargestellt werden (vermutlich nicht mal falsch), die kritischen Einwände hingegen zu Randnotizen verkümmern.