DÜSSELDORF. Immer wieder glauben Politiker und Wissenschaftler, dass nur theoretisch erdachte empirisch geprüfte Rezepte in den Schulen befolgt werden müssen und dann kommt hinten guter Unterricht heraus. Alle Lehrer kennen das: Schulbücher und wissenschaftliche Empfehlungen, die gut durchdacht sind, aber dennoch in der schulischen Praxis versagen. Professor Hans Brügelmann schreibt in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift des Grundschullehrerverbands “Grundschule aktuell” warum das nicht funktioniert. Seine Thesen in der Übersicht.
- Wer die empirisch ermittelten Top-Methoden von Forschung nur noch von den Lehrkräften umgesetzt sehen will, fordert einen Respekt vor den Ergebnissen ein, der die Bedeutung von Berufswissen und Alltagserfahrung minimiert.
- Pädagogische Praxis funktioniert nicht wie die Anwendung von Regeln in der Technik. “Eine Methode mag im Durchschnitt um einige Leistungspunkte erfolgreicher sein als eine andere. Trotzdem kann ihr Erfolg bei Lehrerin Schulze wesentlich geringer sein als bei Lehrer Müller.”
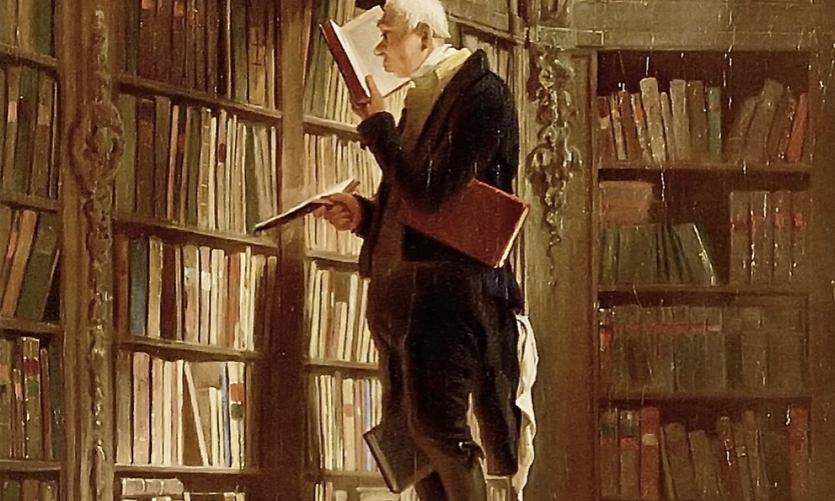
Immer nur Bücherwurm? Nein, die gute Praxis gelingt nur im Austausch von Forschern und Praktikern. (Bild: Carl Spitzweg „Der Bücherwurm“ via Wikimedia Commons (gemeinfrei) - Datenbasierte Forschungsergebnisse vernachlässigen die Besonderheiten der konkreten Situation, die über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Nach Brügelmann liegt der Grund darin, dass Personen in komplexen sozialen Situationen wie Unterricht in hohem Maße auf implizites Wissen angewiesen sind.
- Das implizite Wissen ist schwer zu vermitteln. Brügelmann zitiert den Berufsbildungsforscher Neuweg (2015), der drei Gründe dafür definiert: Diese sind a. Je komplexer ein Verhalten, desto schwerer fällt es den Handelnden, die Gründe für ihr Vorgehen zu beschreiben und somit wird es dem Experten schwerfallen, Regeln zu rekonstruieren. b. Selbst wenn die Rekonstruktion gelingt, sind die Handlungen schwer darstellbar und somit schwer vermittelbar. c. Jeder Fall ist anders, sodass Regeln sinn- und situationsgerecht ausgelegt werden müssen. Hier kommt wieder die Kompetenz des Lehrenden ins Spiel.
Fazit: Die Aufgabe der Bildungsforschung kann demnach nur Anregung, Herausforderung, Zweifel und und kritische Befragung sein. “Sie kann Chancen und Risiken benennen, aber keine verlässlichen Aussagen über zu erwartende Wirkungen machen.” Auf der anderen Seite zeichne eine starke Praxis sich statt durch Überheblichkeit – es durch die tagtägliche Erfahrung einfach besser zu wissen – durch eine eigene Forschungshaltung aus. Das eigene Erfahrungswissen sollte im Austausch mit anderen geprüft werden und durch “den Dialog mit Forschung zusätzlich angeregt und unterstützt werden”. nin
Bedacht werden sollte auch, dass sich Schüler, die wissen, dass sie Teil einer wissenschaftlichen Untersuchung sind, anders verhalten als wenn sie das nicht wären. Insofern sind die Untersuchungsergebnisse immer mit Vorsicht zu genießen.
“Die Aufgabe der Bildungsforschung kann demnach nur Anregung, Herausforderung, Zweifel und und kritische Befragung sein: “Sie kann Chancen und Risiken benennen, aber keine verlässlichen Aussagen über zu erwartende Wirkungen machen.“”
Und was ist der Nutzen des ganzen?
Aus diesem Grund ist die Bildungsforschung keine Wissenschaft und man sollte sich wirklich seine Gedanken machen, ob so eine Menge von Lehrstühlen tatsächlich in dieser Form vom Steuerzahler finanziert werden muss.
Die Bildungsforschung ist sogar eine interdisziplinäre Forschungsrichtung! Aber welche Wissenschaft setzt den Theorien, die in der Praxis 1:1 umgesetzt werden? Ihre Forschung lässt auf eigene Frustrationserlebnisse in der Bildungsbiographie schließen. Sie ist aber weder kausal relevant, noch geistreich oder wissenschaftlich belegt! Bildungswissenschaft setzt einen optimalen Rahmen als Leitfaden für erfolgreiche Bildung! Da Lernprozesse aber aus den Imdividuen heraus initiiert sind, kann eine Wissenschaft kein Patentrezept zum Wissenserwerb liefern. Sie kann aber die motivierenden Bedingungen schaffen, um ein erfolgreiches Lernen überhaupt erst zu ermöglichen!
Die Aussagen von Brügelmann treffen die Situation schon ganz gut. Etwas mehr Vertrauen in Lehrmethoden, die sich bewährt haben, wäre angebracht. Nicht umsonst wurde dieser Beitrag in einer Grundschulzeitschrift veröffentlicht, denn das Vertrauen wäre in der Grundschule besonders wichtig, denn da werden die Grundlagen gelegt. Es gibt gute Vorschläge, die aus der Forschung kommen und mit denen man den Unterricht weiterentwickeln kann und es gibt “Erkenntnisse”, die in die falsche Richtung zeigen. Erfahrene Lehrer nehmen dann bewährte Methoden und machen das zusätzlich über den Lehrplan hinaus. Die Blickrichtung der Ausbilder und Beurteilenden ist aber die, dass man dann ein/e gute/r LehrerIn ist, wenn man nach den neusten “Erkenntnissen” unterrichtet.
Es tut gut, manchmal auch etwas über den Wert praktischer Erfahrungen zu lesen.
Zu Anfang habe ich mich noch sehr nach Rezepten gerichtet, die vor allem “in” waren, bis ich merkte, dass meine Schüler nicht dem Labortyp entsprachen, an dem Wissenschaftler immer neue Seiten entdecken.
Heute probiere ich auch noch Neues aus, lasse aber ziemlich schnell davon ab, wenn mir die Ergebnisse nicht gefallen. Dann besinne ich mich wieder auf das Altbewährte.
Es stimmt, Forschung kann anregen und unterstützen. Sie kann aber auch etwas produzieren, was für die Schulpraxis wenig bringt oder sogar kontraproduktiv ist, wenn man nicht kritisch damit umgeht, Abstriche macht, modifiziert oder sogar Abstand davon nimmt.
Das Hauptproblem einzelner Forschungsergebnisse und ihrer Übertragung auf den Unterricht scheint mir darin zu liegen, dass sie oft überbewertet werden und von heute auf morgen alles „befruchten“ sollen. Was gestern noch gut war, ist plötzlich schlecht und altmodisch. Das erinnert an Modetrends.
Viel bedeuten mir Gespräche und Erfahrungsaustausche mit nahestehenden Kollegen. Da habe ich das Gefühl, wir sitzen im selben Boot, haben einen ähnlichen Überblick und ein ähnliches Ziel.
Wie gesagt, Anregung und Unterstützung durch Forschungsergebnisse finde ich o.k. Mehr bedeuten sie mir aber auch nicht, sonst müsste ich meine Schüler und mich selbst zu ständigen Versuchskaninchen machen.
@ysnp Ich teile Ihre Meinung und unterstreiche ganz dick den letzten Satz.
@Nele Abels Auch Ihrer Meinung kann ich mich anschließen.
Beim Namen “Brügelmann” überkommt mich leichte Gänsehaut, und ich ziehe meine Stirn in Falten.
Gerade er stand doch dem fragwürdigen Reichen – Konzept sehr nahe. Worüber schreibt er hier eigentlich?
Wer sich weiter informieren möchte, dem empfehle ich die breite Abhandlung im Link “Grundschulservice”.
Der Spiegel schrieb 2013 ausführlich über Herrn Brügelmann. Einen Auszug habe ich kopiert.
http://www.grundschulservice.de/1746594.htm
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-98091072.html
Wie konnte es bloß so weit kommen? Das ist eine Frage, die man Hans Brügelmann stellen muss, dem Mann, der mit einem ähnlichen Konzept wie Jürgen Reichen einst beschloss, die Kinder vom Drill zu befreien. Vor nunmehr 30 Jahren verfasste er ein Werk, das die Schullandschaft verändern sollte.
Inzwischen ist Brügelmann emeritierter Professor für Grundschulpädagogik. Während Jürgen Reichen eher sektenartig Gefolgsleute um sich scharte, nutzte der gelernte Jurist Brügelmann das reformgierige geistige Klima der Pädagogenwelt in den frühen achtziger Jahren, um den auf Reichen fußenden Methoden in Deutschland zum Durchbruch zu verhelfen. Brügelmann war einer der wichtigsten Türöffner für die neue Rechtschreibanarchie.
Jetzt sitzt der bärtige Oberpädagoge – der selbst nie als Grundschullehrer gearbeitet hat – in seiner kleinen Wohnung in einem Dorf bei Schwäbisch Gmünd in einem Schlösschen, dessen einstiger Glanz sich hinter Efeuranken und im zugigen Treppenhaus nur noch erahnen lässt. Als hätte Brügelmann sich verbarrikadiert: meterdicke Mauern, Bücherwände ringsum, ein Kelim in Rottönen auf den Dielen, das Weinregal neben dem Arbeitspult. Leise wabern seichte Klänge durch den Raum. Savoir-vivre in der Provinz.
Brügelmann erzählt von seiner eigenen Kindheit. “In der Schule hatte ich das Gefühl: Die Lehrer haben immer recht.” So wie die Paukerin in der dritten Klasse: Als er und sein Nachbar, beide eigentlich gut in Rechtschreibung, im Diktat “Bäcker” mit “e” geschrieben hatten, verpasste sie den Jungs bei der Rückgabe der Hefte Backpfeifen, weil sie Betrug vermutete. “Sie hat ungebremst ihre Macht ausgeübt”, sagt Brügelmann.
Als er 1980 Professor an der Uni in Bremen wurde, machte er sich daran kaputtzumachen, was ihn kaputtgemacht hatte: “Es ging darum, die Kinder zu befreien”, erzählt er, immer noch mit Begeisterung in der Stimme. “Es ging darum, ihnen Räume zu geben, in denen sie ihre eigenen Erfahrungen machen können.”
“Kinder auf dem Weg zur Schrift” hieß das Werk, das er damals verfasste. Darin propagierte er eine neue Methode zum Schreibenlernen – die in ihren Grundzügen dem reichenschen Konzept ähnelt: den “Spracherfahrungsansatz”. Die Grundidee dabei ist, die Kinder einzuladen, über das zu schreiben, was sie interessiert. Das mache sie kreativer. Am Anfang steht auch hier die Anlauttabelle.
Brügelmanns Buch war ein Kracher. Innerhalb weniger Jahre erschien es in zweiter und dritter Auflage. Als “Leitdampfer” sieht es der Autor heute. “Es hat in der damaligen Aufbruchsstimmung gewirkt wie ein Katalysator.”
Brügelmann trat den Weg durch die Institutionen an. Er wurde Präsident der Deutschen Gesellschaft für Lesen und Schreiben und als solcher gleichsam zum amtlichen Verkünder der neuen Methoden. Auch den Grundschulverband brachte er auf Kurs – und erreichte damit Zehntausende Lehrer.
In der Zeitschrift des Verbandes konnten er und Gleichgesinnte die Reichen-Methode und den Spracherfahrungsansatz ausführlich feiern. Zwar sprachen etliche Studien gegen die neuen Heilslehren. Doch Brügelmann säte Zweifel. Auch an der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung Iglu und den Vergleichsarbeiten, die das Ausmaß der Rechtschreibkatastrophe erahnen lassen, fand er wenig Gutes.
Für die Didaktikerin Agi Schründer-Lenzen von der Universität Potsdam ist es ein Rätsel, wie es eine Idee ohne jegliche Vorprüfung schaffen konnte, die Grundschulpädagogik derart zu durchdringen. “Man muss doch von einem Bildungssystem erwarten können, dass Unterrichtsmethoden auf einer wissenschaftlich gesicherten Basis stehen”, sagt sie.
“Für die Didaktikerin Agi Schründer-Lenzen von der Universität Potsdam ist es ein Rätsel, wie es eine Idee ohne jegliche Vorprüfung schaffen konnte, die Grundschulpädagogik derart zu durchdringen.”
Dies ist für mich der wichtige Satz.
„Man muss doch von einem Bildungssystem erwarten können, dass Unterrichtsmethoden auf einer wissenschaftlich gesicherten Basis stehen“, sagt sie.
Aber dieses Vorgehen hat doch Methode! Genau nach diesem Muster werden die Schulen mit immer neuen und angeblich besseren Methoden “beglückt”.
Richtig. Die wissenschaftliche Basis wird an der Front hergestellt (auf Kosten der Schüler und Lehrer). Falls die Basis nicht das gewünschte Ergebnis liefert, werden entweder die Anforderungen der Methode angepasst (sprich gesenkt) oder eine neue, noch bessere Methode ohne wissenschaftliche Basis an die Front gebracht. So beißt sich der Hund in den Schwanz und wir haben einen Kreis, der sich unentwegt weiterdreht. Das geht so lange gut, wie sich der Kreismittelpunkt nicht bewegt, dem ist aber aktuell zumindest gefühlt leider nicht mehr so.
‚Von wem sollen Lehrpersonen eigentlich lernen?‘
Einen Hinweis gibt die Freinet -Pädagogik, die den Begriff des ‚praticien-chercheur‘/Praticienne-chercheuse‘ kennt.
Die Lehrperson als ‚forschender Praktiker‘, der als Praktiker auch eine fragende, reflektierende und suchende Haltung einnehmen kann.
Der an Forschungsprojekten teilnehmen kann, eigenständig Projekte durchführen kann. Der über Grundkenntnisse in Statistik verfügt. Das könnte zu einer Verbindung der Parallelwelten ‚Schulalltag‘ und ‚Forschung‘ führen. Ein gemeinsames Analysieren der täglichen Vorgänge im Unterricht und Möglichkeiten der Wetierentwicklungen. Beispiel: Entwicklung von kindgemässen Lern-und Lehrmitteln.
Und wann in ihrer 48-Stundenwoche sollen Lehrer das auch noch machen? Kommen Sie mir nicht mit den Ferien, die sind in der Stundenzahl nämlich schon mit eingerechnet.
Natürlich reflektieren die meisten Lehrkräfte ihren Unterricht und nehmen eine suchende und fragende Haltung ein. Wie kann ich meinen Unterricht (noch) besser machen? Diese Frage stellen sich doch fast alle Lehrkräfte und entwickeln ihren Unterricht weiter.
Wie wäre es, wenn man die Sache mal umdreht: Forscher (Didaktiker usw.) suchen nach gelungenem Unterricht in Schulen, und beantworten dann die Frage, warum dieser Unterricht erfolgreich ist. Vorteil: der gefundene Unterricht ist praxistauglich.
Diese könnten dann auch die nötigen Statistiken dazu erheben.
Ein solches Vorgehen wäre aber wahrscheinlich unter dem Niveau der genannten Didaktiker und Forscher.
nein, über dem Niveau, weil kein ausschließlich schreibtischtaugliches theoriegebäude. erst müssten sie suchen, dann beobachten, dann theoretisieren, dann evaluieren und dann auswerten. mindestens doppelt so viel arbeit pro veröffentlichung.
Sehe ich auch so, dass die Kolleginnen und Kollegen merken, wo etwas nicht rund läuft und das versuchen zu verbessern.
Ich würde aber nochmal pragmatischer ansetzen in der Beschreibung. Für die modernen Fremdsprachen z.B. hat sich die Unterrichtsentwicklung über die Jahrzehnte in immer besseren Schulbüchern manifestiert, mit Audio-CDs, Arbeitsheften, Computerprogrammen, DVDs mit Videoausschnitten usw. Das ganze inhaltlich sehr gut reflektiert und für die Klassensituation vorstrukturiert, mit Lehrerband und Online-Materialien.
Eine Entwicklung in dieser Qualität war möglich, weil Verlage viel Geld mit diesen Büchern verdienen können, und immer mehrere Verlage in Konkurrenz an den Neuauflagen arbeiten.
Wer Herausgeber eines gut laufenden Lehrwerks ist, hat sein Ferienhaus sicher (ohne Neid geschrieben:-)
Keine Fachschaft würde ein mittelmäßiges Unterrichtswerk anschaffen. Durch den täglichen Unterricht haben die Sprachehrer die Expertise, sich für gutes Material zu entscheiden. Durch die Verdienstmöglichkeiten haben die Verlage eine Motivation, gutes Material zu erstellen. Durch Tantiemen haben Lehrer eine Motivation, guten Unterricht mit vollem Lehrplanbezug für andere aufzubereiten.
Das kann klappen und klappt auch.
Die Regierungspräsidien haben nicht die Ressourcen, in der Breite guten Unterricht noch zu verbessern. Sie können lediglich punktuell gute Fortbildungen anbieten, und auch das gelingt nicht immer.
Das im Artikel genannte “implizite Wissen” (Berufserfahrung?) wird den Lehrerinnen und Lehrern durch raschen Themen- und Kompetenzenwechsel auch immer wieder ausgetrieben:-)
Es geht mir auch um die Aufwertung jeglicher Lehrtätigkeit. Unabhängig von der Stufe. Befragt man Schulabgängerinnen danach, was sie aus dem 9/11 Jahre dauernden Unterricht mitnehmen (nach rund 11‘000 Stunden Unterricht), ist immer sehr eindrücklich, was bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Eindrücke, die oft ein Leben lang ihre Spuren hinterlassen. Sowohl konstruktive, wie destruktive. Das ist ein Schulprojekt, das nur von Lehrpersonen durchgeführt werden kann: regelmässige Befragungen von Lernenden. Die Fragen stellen die unterrichtenden Lehrpersonen. Die erhaltenen Antworten fliessen in den Unterricht zurück.
Nennen Sie mir dann mal den wissenschaftlichen Mitarbeiter einer Universität, dessen Arbeitsvertrag nur bei Vorlage neuer Ergebnisse (= Veröffentlichung) immer nur um maximal ein Jahr verlängert wird, und der sowieso nur maximal 8 Jahre oder so an einer Universität bleiben darf, der so ein Projekt in die Wege leitet. Sie werden keinen finden. Außerdem kann man mit so einer Studie kurzfristig kein Geld verdienen, weswegen auch die freie Wirtschaft eine solche auch nicht in Auftrag gibt.
‘Von wem sollen Lehrpersonen eigentlich lernen?’
Evaluationsstudien sind möglich ohne wissenschaftliches Personal. Wenn nötig, gibt es vielfältige zeitlich und finanziell umschriebene Coaching Formen, welche qualitativ gute Arbeit mit bescheidenem Budget ermöglichen.
Entscheidender Punkt: Lehrpersonen verfügen über ein schulhausbezogenes Konzept mit entsprechenden sinnvollen Fragestellungen.
Lehrpersonen/Kollegien verfügen über ein enormes Erfahrungspotential, das leider aus verschiedenen Gründen wenig zum Tragen kommt.
falsch, irgend jemand muss das Ganze koordinieren, zumal isolierte. von unterschiedlichen Personen nach unterschiedlichen Maßstäben erhaltene Daten nicht vergleichbar ist — weder im einem Längs- noch einem Quervergleich.
Außerdem: Welche Lehrkraft hat dafür auch noch Zeit? Ich nicht. Außerdem bin ich nicht dazu in der Lage während des Unterrichts mit all den fachlichen Dingen auch noch eine wissenschaftliche Beobachtung aller Schüler durchzuführen.
‚Von wem sollen Lehrpersonen lernen‘?
Beispiel: Eine Oberstufenschule einigt sich auf folgende Fragestellung: ,Wo stehen unsere Lernenden zwei Jahre nach Schulaustritt? Wie haben sie den Übergang Sek.stufe 1 zu Sek.stufe 2 erlebt?
Inwiefern wurden sie im Entscheidungsprozess von der Schule unterstützt? Wie realistisch waren ihre Selbstbilder, bezogen auf verschiedene Kompetenzen? Waren die schulischen Ressourcen ausreichend oder brauchten Lernende private Hilfe?
Projektdauer: 2 Jahre. Eine Lehrperson erhält eine bestimmte Stundenentlastung für Koordinationsaufgaben.
Sinnvolle, weiter führende Fragen können vor allem die an der Oberstufe tätigen Lehrpersonen formulieren. Sie können die Antworten schulbezogen gewichten und Umsetzungen planen bis zum nächsten Evaluationszeitpunkt.
Forschen heisst Fragen stellen und Antworten suchen. Lehrpersonen können das. Wenn sie entsprechende – vergleichsweise bescheidene – Mittel erhalten.
Ja,
schöner Gedanke.
Allerdings:
“Eine Lehrperson erhält eine bestimmte Stundenentlastung für Koordinationsaufgaben.”
Zwar haben Gymnasien erheblich mehr Entlastungsstunden, als andere Schulformen, aber auch hier werden sie nicht ausreichen, um die vielen zusätzlichen Aufgaben angemessen zu bedenken.
Aber WENN jemand solche Forschungsvorhaben unterstützen wollte, KÖNNTE er/sie/es ja Stunden dafür finanzieren. DANN wäre es sicherlich sinnvoll, eine Kooperation von Uni und Schule einzugehen, sie zu koordinieren, gemeinsam Fragen zu entwickeln und das Forschungsvorhaben durchzuführen.
Im übrigen ist in meinem Bundesland jede Schule verpflichtet, jährlich zu evaluieren (intern) … OHNE Entlastungsstunden und auch ohne Statistik-Studiengang vorab und meist ohne Oberstufenlehrkräfte. Und tatsächlich sind auch andere Lehrpersonen in der Lage, sinnvolle, weiter führende Fragen zu formulieren.
Es gibt ja nicht mal Entlastungen für die Referendarsbetreuung, wo sollen dann die anderen Entlastungen herkommen?
@ Griasdi Die Ausbildungskoordinatoren an einer Schule bekommen wenigstens manchmal A14 dafür. Eine Entlastung oder wenigstens im sinnvollen Verhältnis stehende Zusatzentlohnung ist das nicht. Der normale Lehrer, der einen Referendar ausbildet, bekommt für Beobachtung und Nachbesprechung nichts. Da haben Sie vollkommen recht.
Das scheint wohl von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Schleswig-Holstein bekommt man für die Betreuung eines Referendars zwei Stunden Entlastung, was dann natürlich beinhaltet, dass man mindestens in einer Stunde pro Woche bei ihm/ihr zuschaut und eine sogenannte Besprechungsstunde hat.
@ Küstenfuchs: Zwei Stunden Entlastung für einen Referendaren? Jeder Lehrer? Dann kann es in Schleswig Holstein nicht viele Referendare geben. In NRW sind an großen Schulen 5-10 Referendare keine Seltenheit und auf die 10-20 Lehrerstunden kann kein Schulleiter trotz 45-90 eigenständige Unterrichtsstunden durch die Referendare ohne Lehrer verzichten.
@bernie
Die Frage, von wem Lehrpersonen lernen sollen ist doch ganz einfach zu beantworten. Dafür gibt es doch extra die Kompetenzzentren in den kommunalen Dienstaufsichtsbezirken in NRW. Der Nachteil ist, dass dort im Regelfall Schülerflüchter sitzen wie in den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung. Über diese Wege lassen sich nämlich Karrieren planen, über entsprechende Unterrichtspraxiis vor Kreide und mit Schülern eben nicht.
In Schule werden im Regelfall alle bis zum Erreichen ihrer persönlichen Inkompetenz befördert. Dreht man dieses Peter-Prinzip um, heißt es, dass die Fähigsten in den untersten Besoldungs-/Entgeltgruppen zu finden sind, die sich mit EDEKA abgefunden haben und gerne unterrichten anstatt Verwaltungsaufgaben zu erledigen.
(EDEKA ==> Ende der Karriere)
Gut gesagt. Im Prinzip sehe ich das genauso. Einstmals wurde das, was Sie beschreiben, “Flucht auf die Karriereleiter” genannt.
Der Weg zum Dezernenten geht über den Schulleitungsposten. Im Lebenslauf steht dann irgendwo unter ferner Liefen aktiver Schuldienst.
Nicht unbedingt – der Weg über die Fachseminar- bzw. Kernseminarleitung tut dies auch. Die Voraussetzungen und die Besoldung entsprechen denen für die Abwesenheitsvertreter der SL. Der Vorteil ist, man muss sich nicht mit alltäglichen Dingen befassen und durch die staubige Ebene mit Budgetverantwortung, nervigen Kollegien und aufsässigen Schülern sowie deren renitenten Eltern.
@maestro
Es hat ja Gründe, warum erfahrene Lehrkräfte bestimmte Fortbildungen meiden, wie der Teufel das Weihwasser.
Wenn ‘ne Fortbildung mit netten Kennenlernspielen anfängt, habe ich den Rest des Fortbildungstages zwangsläufig frei. Entweder der Fortbilder lässt mich ziehen oder er muss mich nach einiger Zeit wegen störenden Vergaltens entlassen. Die meisten sind einsichtig und lassen mich ziehen.
Damit kein falscher Verdacht aufkommt, ich begebe mich umgehend an meine entsendende Stammdienststelle und nehme an Stelle der eignen Fortbildung den ansonsten entfallenden oder zu vertretenden Unterricht wieder auf.
Wie genau stören Sie? Ich nehme an, dass Sie das ähnlich gut können, wie Ihre Kommentare hier auf der Seite sind ;-). Andauernde kritische Nachfragen bzgl. des Sinns und Zwecks sind wahrscheinlich nur der Anfang.
Kommt drauf an; in NRW gibt es für die Betreuung von OBASlern (Seiteneinsteigern) eine Wochenstunde Entlastung für die betreuende Lehrperson in jedem der beiden Fächer. Dafür ist der AKo für die OBASler nicht zuständig. Darüber hinaus gibt es noch die Betreuer der diversen Praktikanten. Für das Anerkennungspraktikum zu Beginn gibt es allenfalls einen Betreuer, der ähnlich wie der AKo stundenmäßige Entlastung erhält. Bei den Jahrespraktikanten (Praktikumssemester) gibt es ebenfalls eine Pool-Entlastung, die in keinem Verhältnis zum Aufwand steht.
(alle Angaben beziehen sich auf NRW)
Was die Forschung für die schulische Praxis leisten kann – und wo die Grenzen sind
Grenzen der Forschung: Am Beispiel Selektion. Obschon das Thema ‚Selektion‘ während der Volksschule gründlich erforscht und dokumentiert ist, mit dem unbestrittenen Ergebnis, dass die Irrtumswahrscheinlichkeit von selektiven Zuordnungen zu hoch ist, finden noch immer selektive Übergänge in den öffentlichen Schulen statt. Je nach Region mit Leistungsvoraussagen für fünf, vier oder drei Jahre. Grenzen der Forschung liegen dort, wo bestehende Glaubenssysteme stärker sind als wissenschaftlich erhärtete Fakten.
Es fällt langsam auf, wie die “Außerirdischen”, womit ich alle Nicht-Lehrer und praxisfremden Besserwisser meine, immer auf die pädagogische Forschung und Wissenschaft verweisen, um die eigentlichen Könner und Kenner der Materie, nämlich die Lehrer, von ihren realitätsfremden Ansichten zu überzeugen.
Es gibt keine einheitliche pädagogische Forschung und Wissenschaft, liebe Leute, sondern die unterschiedlichsten Aussagen und Widersprüche in diesem Expertenkreis.
Bezeichnet also nicht immer die ausgewählte Gruppe Eurer Haus-und-Hof-“Wissenschaftler” als die irrtumsfreie und mit einer Stimme sprechende Forschung und Wissenschaft, die alles Mögliche “beweist”, besonders Eure Lieblingsthesen.
Es gibt unzählige Untersuchungen, durchgeführt von Lehrpersonen an verschiedenen Stufen,’eigentlichen Könnern und Kennern der Materie’, die zum Beispiel im Bereich Textbeurteilung von Lernenden zur schmerzhaften Einsicht kamen, dass Beurteilungen des gleichen Textes durch verschiedene Lehrpersonen bis zu 5 Notenwerte voneinander abweichen können.
Und das im Fach Sprache, einem Fach, das bei selektiven Verfahren eine gewichtige Rolle spielt. Es gibt auch unter Lehrpersonen ‘unterschiedlichste Aussagen und Widersprüche’.
Was kaum eine Schule davon abhält, Leistungsprognosen auf fünf Jahre hinaus abzugeben mit entsprechenden Gruppenzuweisungen.
Dann überlassen wir mal lieber die Prognosen den Eltern, was ja bereits die Regel ist. Die sind bestimmt treffsicherer.
Am besten: Prognosen ganz abschaffen, Zensuren abschaffen, Sitzenbleiben abschaffen und alle Schüler mit einer Garantie fürs Abitur zum Gymnasium schicken, das dann Gemeinschaftsschule ist.
Damit hat das inhumane und grausame Aussortieren, Ausgrenzen, Diskriminieren, Foltern mit Zensuren, mit Chancenungleichheit, sozialer Ungerechtigkeit etc. endlich mal ein Ende.
Bernie, Sie haben durchschaut, wie der Weg in die Zukunft aussehen muss.!
Und wem er nicht gefällt, kann seine Kinder ja auf ein paralleles Privatschulsystem schicken, das noch die gegliederte, völlig veraltete Lösung anbietet.
Es gibt eben Leute, die an alten Zöpfen hängen und einfach nicht einsehen können oder wollen, dass moderne und fortschrittliche Schulen anders auszusehen haben.