DÜSSELDORF. Das Schulsystem ist schwer reformierbar, kritisiert Ulrich Heinemann in seinem Buch „Paradoxe Geschichte der Schule nach PISA“. Warum das so ist und was der Reform entgegensteht, erklärt der Autor und ehemalige Ministerialbeamte aus dem NRW-Schulministerium in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Schulverwaltung NRW“. Seine Thesen im Überblick.
1. Eltern sind die zentrale Referenzgröße und die „Giganten“ in allen Schuldiskussionen. Jeder beziehe sich auf sie. Gehör finden vornehmlich die Eltern aus der sprachmächtigen Mittelschicht, die selbst unter Druck stehen, Ihrem Nachwuchs die Chancen zu erhalten, die sie selbst realisieren konnten.
2. Stiftungen sind „Scheinriesen“. Entgegen der gängigen Annahme, dass Stiftungen einen starken Einfluss auf die Bildungspolitik haben, meint Heinemann, dass sich eine nachhaltige und flächendeckende Wirkung der von den Stiftungen initiierten Schulpreise und Modellvorhaben auf die Modernisierung der Schule nicht nachweisen lässt. Als Beispiel führt er das von der Bertelsmann-Stiftung entwickelte SEIS (Selbstevaluation in Schulen), an. Es sei erst von einigen Bundesländern übernommen worden, heute friste es aber nur noch ein Kümmerdasein.
3. Das ganze System ist lernschwach. Ein Gedankenspiel dazu: Nehmen wir einen Elektroingenieur und einen Lehrer, die vor 100 Jahren eingefroren wurden und heute wieder auftauen. Der Elektroingenieur wäre in seinem Beruf heute rettungslos verloren, wohingegen der Lehrer sich wohl recht schnell zurechtfinden würde. Er würde ja noch vieles vorfinden, was er kenne, stellt Heinemannn fest: Halbtagsunterricht, 45-Minuten-Takt, überlange, an vorindustriellen Arbeitszyklen orientierten Ferienzeiten, Monoprofessionalität, schwache Teamorientierung, fehlende Arbeitsteilung, lehrerzentrierter, auf den Klassendurchschnitt fixierten Unterrichtsstil und die Leistungskriterien einer sozial und ethnisch homogenen Mittelschicht, die es Kindern aus sozialen Unterschichten und aus dem migrantischen Umfeld besonders schwermache.
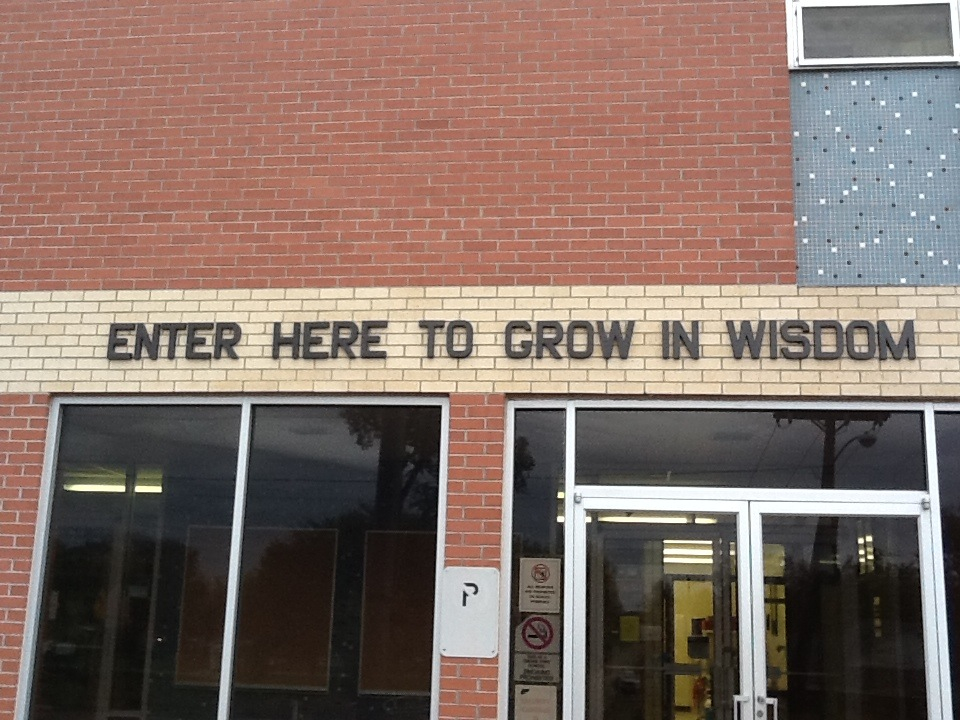
4. Lehrerverbände sind Teil des Problems. Denn Sie seien ohne Ausnahme „hartleibige, strukturkonservative Verfechter der beschriebenen Lernschule“, die nur ihre eigenen Interessen, die Autonomie und den Status des Berufsstandes, sichern wolle.
5. Heinemann sieht eine Lösung für bessere Steuerung in einer wieder breiter aufgestellten Steuerung durch die Schulaufsicht. Diese sollte die zentralen Aspekte wie Kompetenzorientierung, Heterogenitäts- und Lernerfolgsorientierung, individuelle Förderung und Chancengerechtigkeit voranbringen. Parallel sollte dazu das Unterstützungssystem für Schulen stärker ausgebaut werden – nach dem Vorbild Niederlande.
6. Die Schulpolitik ist besser als ihr Ruf. Die Bundesländer in der KMK seien sich weit einiger als die Bildungswissenschaften über den Sinn der Schulreformen. Die Schulpolitik befinde sich nur im „grundlegenden Irrtum über die Wandlungsfähigkeit und Reformbereitschaft des Schulsystems“. Dessen Akteure seien offene oder verkappte Gegner jeder Modernisierung der Schulen. Sie sorgten sich lediglich um ihre Autonomiespielräume, ihre professionelle Identität und ihre Privilegien. nin
Ulrich Heinemann: Bewegter Stillstand: Die paradoxe Geschichte der Schule nach PISA. Weinheim/Basel 2017.
Kurz zusammengefasst, die eltern und ie Berufsverbände der Lehrerschaft sind die Hemmnisse. Wenn diese beseitigt sind und die Schulaufsicht gestärkt ist (mehr Durchgriffsfähigkeit auf die untertéllten Schulen hat ==> Direktionsprinzip), können Schulreformen im Sinne der KMK umgesetzt werden.
Stimmt, ohne Steuerberater und Finazbeamte bzw. deren berufsständische Vertretungen könnten die OFDs auch wesentlich leichter die Erkenntnisse ihres obersten Chefs “durchdrücken”.
Naja, ich weiß nicht. Das stimmt ja alles alles nur, wenn man eine bestimmte Art von Schule will. Wenn man aber diese Art von Schule nicht will, dann stimmen ja die Vorwürfe auch nicht.
Und die Geschichte der Methodik und Didaktik zeigt zwar, dass es alle 20 Jahre zwar eine neue Art von Schule geben soll, aber das Ergebnis ändert sich nicht grundlegend. Die Schüler freuen sich nach wie vor auf Ausfall, Wochenende und Ferien.
Und die Leistungen sind nur schlechter geworden und gar nicht besser!
Das ist das Werk eines populistischen Schreibtischtäters, der die Schule kaum von innen kennt und Geld mit seinem Populismus verdienen will. Die Schule von vor 100 Jahren dürfte mit der Schule von heute auch kaum etwas zu tun haben, sowohl didaktisch, von den Erziehungsmethoden her, von den Abläufen her hat sich die Schule komplett geändert.
Dass der Elektroingeneur von 1917 heute natürlich hinterherhinkt, liegt am rasenden Fortschritt der Wissenschaft. Der Lehrer von 1917 wäre aber genauso verloren, es ist Unsinn, dass er heute zurecht kommen würde. Wie soll er die Relativitätstheorie erklären, wie Computer bedienen, wie mit renitenten Eltern umgehen (die es 1917 kaum gab), wie mit störenden Schülern umgehen, die er nicht verprügeln darf? Wie soll er Klassenfahrten organisieren, häusliche Gewalt erkennen oder mit Psychologen reden (soviel zur Monoprofessionalität)?
Wieso möchte er, dass die Stiftungen mehr Einfluss haben? Die sind alle von den Geldgebern gelenkt und verfolgen zumeist rein egoistische Ziele!
Das ganze scheint eher ein populistisches Machwerk eines frustrierten Büromenschen, der einsehen muss versagt zu haben.
Küstenfuchs
Sie sprechen mir aus dem Herzen.
Die Sache mit der Relativitätstheorie stimmt, betrifft aber nur die wenigsten Lehrer. Der gesamte technische Fortschritt und das generelle Tempo würde den Lehrer von 1917 massiv überfordern.
Da liegt eben der Unterschied zwischen Mitarbeitern der Bildungsbürokratie a la Heinemann und dnen, die vor Kreide arbeiten.
Nur wenn man z.B. die Debitoren und Creditoren der kaufmännischen Abteilung von Siemens als großer Elektro-Klitsche betrachtet, sieht es nach dem Auftauen nicht anders aus.
Übrigens, die Grundlagen der E-Technik – also die “drei Ohm’schen Gesetze” – haben sich auch nicht wirklich verändert.
Natürlich haben wir sprachlich geschulten Eltern bessere Möglichkeiten uns auszudrücken als Eltern aus bildungsfernen Schichten und von Eltern mit Migrationshintergrund.
Aber deshalb wird trotzdem nicht auf uns gehört.
Und unser Einfluss beschränkt sich nur auf das Mitorganisieren von Schulfesten und die private Nachhilfe zu Hause.
Kinder mit Beeinträchtigungen werden aber gerade durch diese Schulreformen noch mehr benachteiligt.
Und deshalb wird uns aber auch nicht daran hindern Ihrem Nachfolger die selben unangenehmen Fragen zu stellen , wie ich diese Ihnen stellte bezüglich der unkritischen Anwendung von Lesen durch Schreiben,mit seinen negativen Auswirkungen auf die Risikogruppen. Ihr Freund Christiani versuchte hier in NRW diese Methoden groß angelegt durchzusetzen, und er hatte hier im Kreis Warendorf damit Erfolg.
Jetzt bläst Ihnen und Ihren Nachfolgern eben der Wind ins Gesicht.
Wir werden hier die Eltern weiter über diese kruden Methoden informieren und weiter private Hilfe anbieten, bis hier vor Ort mindestens eine Schule endlich wieder mit strukturierten Lehrgängen unterrichtet.
Reinhold Christiani und sein Freund Ulrich Heinemann gehörten mit zu den treibenden Kräften für die in den letzten 17 Jahren durchgeführten Schulreformen in NRW-Grundschulen.
Sie ermöglichten die Verbreitung Rüdiger Urbaneks und Norbert Sommer-Stumpenhorst Lehrmaterialien für den neuen Unterricht, des selbst gesteuerten , eigen initiativen und Material zentrierten Unterricht.
Das Schulministerium unterstützte Lehrerfortbildungen in den hiesigen Grundschulen für deren Lehrwerke . Die Materialien sind auf die neuen Curicula zugeschnitten und sie ermöglichten die Verbreitung dieser Schulmaterialien an unseren Schulen.
Begeistert waren sie auch von den Ideen eines Herrn Brügelmann und eines Herrn Barnitzki.
Zum Glück gab und gibt es den beschriebenen Widerstand durch Lehrer gegen den Reformeifer dieser Herren.
Zwischenbemerkung: In NRW scheint in dieser Richtung einiges übertrieben zu werden. Ich war erstaunt, als ich auf die Uniseite von Heinemann (Uni Münster) kam, dass dort alle Lehrenden (egal ob männlich oder weiblich) in der Überschrift weiblich belegt sind. Das ist gegen das Sprachgefühl und ich hoffe, das wird sich nicht durchsetzen. Gleichberechtigung kann man auf anderen Wegen erreichen, aber nicht so. Wer solche Äußerlichkeiten braucht….
yspn
Das gelesene entspricht der Umsetzung der Gender-Ideologie.
Die meinen, dass man sich auf Männer bezieht.
Man ist hier im Regierungsbezirk Münster stolz auf die flächenhafte Durchsetzung von Sommer-Stumpenhorsts Rechtschreibwerkstatt.
An der Uni Münster lernten Herr Becker-Mrotzek vom Mercator-Institut in Köln, oder auch Frau Prof. Claudia Forst, die Landesvorsitzende des Baden-Württembergischen Grundschulverbandes, sowie Herr Prof. Hans Brügelmann.
@ ysnp: Wie wird denn dann eigentlich der Abschluss “Master” gegendert?
Mastress jedenfalls nicht.
Englische Titel (wie zum Beispiel M.A. für „Master“) werden nicht gegendert.
(© 2012 MMag. Dr. Huberta Weigl • Schreibwerkstatt •)
…”Mastreuse” ?…
Bei Mister und Missis wäre es entsprechend Master und Massis oder Massas.
Aber Messias wird auch nicht gegendert. Und ob ein Messie weiblich ist, ist auch nicht zu erkennen.
da lob ich mir doch die vdL-Truppe: Da kann ein Master auch Hauptmann (w) zu sein.- Da ist eben alles klar geregelt.
… oder Massas.
Ich glaub nicht, Bwana:)
Und beim Bachelor?
Bachalor und Bachalorette kennen die meisten aus dieser RTL-soap 🙂
Geht korrekt nur in der Übersetzung “Junggesellin”.
Messianidis oder einfach Messi ?
Zitat:
“Das ganze System ist lernschwach. Ein Gedankenspiel dazu: Nehmen wir einen Elektroingenieur und einen Lehrer, die vor 100 Jahren eingefroren wurden und heute wieder auftauen. Der Elektroingenieur wäre in seinem Beruf heute rettungslos verloren, wohingegen der Lehrer sich wohl recht schnell zurechtfinden würde.”
Wie erginge es denn einem Autor und Ministerialbeamten, wie Heinemann. Er würde sich nach 100 Jahren sehr schnell wieder zurechtfinden.
Wer im Glashaus sitzt …
Absolut keine neue Erkenntnis:
“Da liegt eben der Unterschied zwischen Mitarbeitern der Bildungsbürokratie a la Heinemann und denen, die vor Kreide arbeiten.
Nur wenn man z.B. die Debitoren und Creditoren der kaufmännischen Abteilung von Siemens als großer Elektro-Klitsche betrachtet, sieht es nach dem Auftauen nicht anders aus.
Übrigens, die Grundlagen der E-Technik – also die „drei Ohm’schen Gesetze“ – haben sich auch nicht wirklich verändert.”
Jetzt habe ich das auch noch falsch geschrieben… BACHELOR und BACHELORETTE natürlich.
Wenn das weibliche Instrument die Klarinette ist, wie lautet denn dann die männliche Form?
Klarin – was denn sonst?
Bei den ganzen anderen -ette Worten kuss man nur -ette weglassen ;-).
Muss …
Nee is klar!
Dann ist Toil ein Pissoir?
Das Tour-Syndrom ist krankhaft höfliches Sprechen.
Bul ist ein Fleischlotz ohne Fleisch.
Ob eine Tabl gegen Krankheiten hilft, sollte die Bertelsmann-Stiftung untersuchen und auf einer Datas speichern.
;-).
Bei Bul liegen Sie falsch; Bulette ist die weibliche Form von Bulle – aka Beamter im polizeilichen Vollzugsdienst.
Ethik – Ethikette?
Wie peinlich, wenn man sagt: “Ich mache die Bachelorette…..”
Ist es ohnehin, denn die akademischen Grade – wobei sich mir beim “bachelor degree” echt die Nackenhaare sträuben – werden von der Hochschule verliehen. Man kann einen akademischen Grad nur anstreben, aber nicht machen. Absolvieren (machen) kann man nur die Prüfungen und eine Thesis verfassen.
Zitat:
“Die Bundesländer in der KMK seien sich weit einiger als die Bildungswissenschaften über den Sinn der Schulreformen.”
Das heißt, dass wissenschaftliche Expertise nicht gefragt ist. Die KMK weiß es besser als Wissenschaftler?
Ja klar, die Schulminister kennen doch die Vorgaben ihrer jeweiligen Landesfinanzmister.
Refom kommt von Haushaltskonsolidierung. Die wichtigsten Finanzmittel zur Ausgestaltung des Schulwesens, sind die, die man nicht ausgeben muss.
Die besten Lehrer sind immer die, die nie unterrichtet haben.
Gut gesagt! 🙂
Nicht immer auf Precht und Klippert ‘rumhacken!!
Warum nicht?
Precht hält selbst 08-15-Vorlesungen in Lüneburg. Dort könnte er zeigen, wie es besser geht – macht er aber nicht.
Eigentlich witzig, dass einer an den Schalthebeln der Kultusbürokratie so ein Fazit zieht. Eigentlich erbärmlich.
Die Thesen des Herrn Heineman sind realitätsfern. Sie schilder lediglich die Sicht eines Verwaltungsbürokraten, der jenseits des täglichen Schulalltags im fernen Düsseldorf seine Sicht der Dinge schildert.
Aber gerade die Schulpolitik der letzten 15 Jahre ist eine Verkettung von Fehlentscheidungen,
wie der Jahrgang übergreifende Unterricht, die flexible Eingangsphase, die Beschulung von Fünfjährigen ohne eine ausreichende motorische und kognitive Befähigung zur Beschulung, sowie von den Lernanfänger überfordernden Lernmethoden , wie der eigen initiative, selbst gesteuerte und Material zentrierter Unterricht bereits in der ersten Klasse mit Lesen durch Schreiben und freiem Schreiben nach Scharrelmann/Ganzberg.
An den Entscheidungsfindungen dazu war der Autor sicherlich mitbeteiligt und er trägt diese ideologisch mit.
Er wünscht sich eine stärkere Steuerung der Schulen durch die Schulbehörden, und verkennt dabei die Bedeutung des Lehrers als zentralen und wichtigsten integralen Bestandteil der Vermittlung,Förderung von Wissen und Fähigkeiten der Schüler.
Lernschwach wurde das System auch gerade durch diese Reformen des Schüler gesteuerten Unterrichts.
Wir Eltern sind für ihn nur auf dem Papier eine zentrale Referenzgröße. Verwiesen wird man allerdings an die Lehrer vor Ort.Das eigentliche Problem der Methode ist für ihn nicht relevant. Der Lernerfolg würde dann doch erreicht.
Er spricht mit keinem Satz die Notwendigkeit der Entwicklung einer wissenschaftlich und Evidenz basierten Schulpädagogik an, die sich auf große Studien stützt und die unabhängig von den Ansichten Einzelner wegweisend für eine moderne Schulpädagogik wäre.
Er scheint weiter an einer Methodenvielfalt ohne wissenschaftliche Grundlagen interessiert zu sein, welche einer rein individualisierten Schulpädagogik dient.
Jetzt verdingt er sich als freier Dozent der Uni Münster .