BERLIN. Frontalunterricht – so lautet die schlichte Antwort in großen Beiträgen von FAZ und „Welt“ zur Frage, welche Lehrmethode die beste sei. Dies belegten aktuelle Untersuchungen. Tatsächlich sind die Antworten, die die Bildungsforschung gibt, komplexer, als sie von den Journalisten wahrgenommen werden.
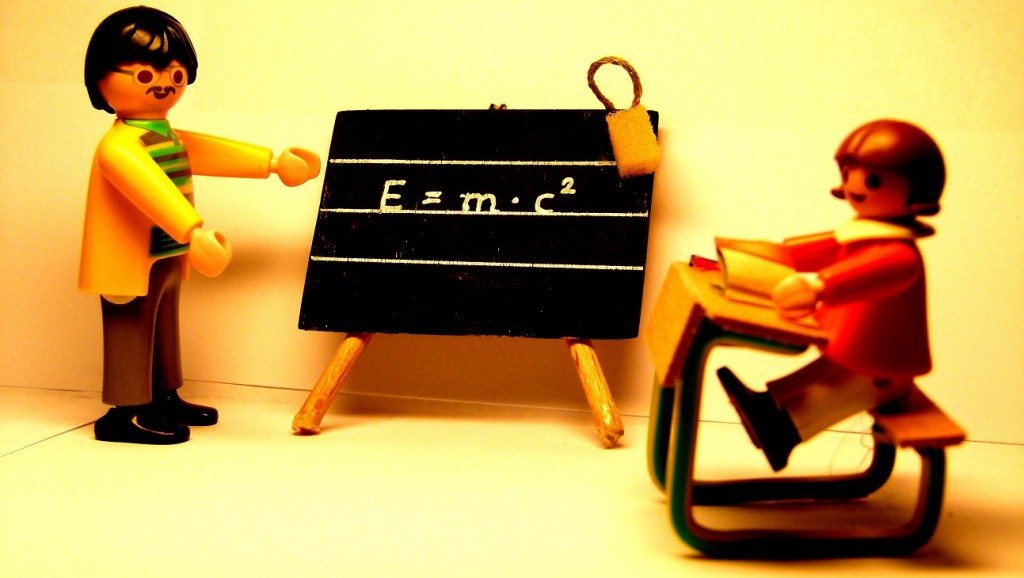
„Die Zeit des traditionellen Frontalunterrichts, in dem alle Schüler mit gleicher Methode und gleichem Material im gleichen Tempo das Gleiche lernen, ist vorbei”, sagte Kurt Reusser, Professor am Institut für Erziehungswissenschaft der Uni Zürich, unlängst gegenüber „Spiegel online“. Anlass war die Nachricht, dass Facebook-Gründer Mark Zuckerberg 99 Prozent seiner Aktien an seinem Online-Unternehmen – im Wert von rund 45 Milliarden Dollar – an eine Stiftung geben will, die mit dem Geld „personalized learning“ fördern soll. Personalized learning? Heißt auf Deutsch: Individualisiertes Lernen – jeder soll nach seinen Stärken und Schwächen in eigenem Tempo vorangehen. Für Zuckerberg ist das dem Bericht zufolge vor allem eine Frage der Technik: Eine Lernsoftware, die im Unterricht genutzt wird, soll künftig, so die Idee des Facebook-Gründers, die Lernschritte der Schüler analysieren und differenzierte Aufgaben vorlegen.
Der Grundgedanke ist nicht neu. Seit dem PISA-Schock 2002 gilt in Deutschlands Schulpolitik das Mantra der „Individuellen Förderung“. In manchen Bundesländern fand ein Anspruch der Schüler darauf sogar Eingang in das Schulgesetz (so in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen). In der Praxis haben viele Schulen in Deutschland Konzepte entwickelt: ob Lerngruppen, selbstständige Arbeit, zusätzliche Förderstunden oder Tutorensysteme (also eine Nachhilfe von Schülern für Schüler). Das Ganze fußt auf reformpädagogischen Ansätzen, die Eigeninitiative, Partnerarbeit und Selbstkontrolle der Schüler ins Zentrum des Unterrichtsgeschehens rücken – und die, auf die Spitze getrieben, dem Lehrer nur noch die Rolle eines „Moderators“ von Lernprozessen zuweisen. „Eines haben die modernen Methoden gemeinsam, sie alle wollen Alternativen zum klassischen Frontalunterricht sein“, so schreibt die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ).
Und jetzt das: „Kinder lernen immer noch am besten, wenn man sie in guter alter Manier frontal unterrichtet. Das haben Bildungsökonomen in einer groß angelegten Analyse herausgefunden. Zwar nicht für Deutschland, sondern für die Vereinigten Staaten, weil es dort eine Unmenge qualitativ guter Daten gibt. Die Aussage ist aber eindeutig: Frontalunterricht bringt mehr als problemorientierter oder gar offener Unterricht“, so berichtet das Blatt und zitiert den Autoren der Analyse, Guido Schwerdt vom Münchener Ifo-Institut, mit folgender Aussage: „Lehrer wenden häufig eine Kombination verschiedener Unterrichtsmethoden an. Wenn Lehrer 10 Prozent mehr Zeit auf frontales Unterrichten verwenden, dann zeigen Schüler einen Leistungsvorsprung, der ungefähr dem Wissenszuwachs von ein bis zwei Monaten Schulbildung entspricht.“ Liegt Zuckerberg also völlig daneben mit seiner Vision eines auf das einzelne Kind zugeschnittenen Lernprogramm?
Die „Welt“ stößt ins gleiche Horn wie die FAZ. Alan Posener, Korrespondent für Politik und Gesellschaft, der mit einer Grundschul-Pädagogin verheiratet ist und auf News4teachers auch schon mal herzergreifend das berufliche Engagement von Lehrkräften beschrieben hat, kommt ebenfalls mit einem Abgesang auf den Reformunterricht. „Jahrgangsübergreifende Gruppen, individualisiertes Lernen, das Arbeitsbogenunwesen und alles, was damit zusammenhängt, dürften sich bald in der Rumpelkammer der dummen pädagogischen Ideen wiederfinden, zusammen mit der Mengenlehre in der Mathematik, der Ganzheitsmethode des Lesenlernens, dem Sprachlabor und der Arbeitslehre; zusammen auch mit dem Rohrstock und dem ganzen Einschüchterungsarsenal der schwarzen Pädagogik“, so schreibt Posener und meint: „Didaktische Moden gehorchen einer Wellenbewegung; das, was einer Pädagogengeneration heilig war, gilt der nächsten als Götzendienst. Klassengemeinschaft und Lehrercharisma, Unterrichtsgespräch und Dialog werden nun wiederentdeckt. In der angelsächsischen Welt, wo sonst. Womit gesichert ist, dass die neue alte Didaktik bald zu uns herüberschwappen wird.“
Sind schülerzentrierte Unterrichtsmethoden also Kokolores? Richtig ist: Der neuseeländische Bildungsforscher John Hattie, der in seiner Meta-Studie „Visible Learning“ die Ergebnisse von rund 1.000 Untersuchungen evaluiert hat und seitdem als “Harry Potter der Bildungsforschung” gilt, kommt unter der Fragestellung „What works best“ zu folgender Schlussfolgerung: Den größten Einfluss auf den Unterrichtserfolg haben die Lehrpersonen, genauer gesagt ihr Handeln.
Die Lehrpersonen lenken laut Hattie das Lernen als Regisseure (activators), „als bewusste Veränderer“. Damit ist aber offenbar keine Rückkehr zu einem Frontalunterricht gemeint, indem fast nur die Lehrkraft redet. „Das Modell des sichtbaren Lehrens und Lernens kombiniert lehrerzentriertes Lehren und schülerzentriertes Lernen, statt beide gegeneinander auszuspielen“, so schreibt Hattie selbst. Lehrer müssen „erkennen, wann Lernen stattfindet und wann nicht“ und daraufhin Feedback fordern und geben. Anders ausgedrückt: Guter Unterricht baut auf einer Vielfalt der Methoden, die vom Lehrer bewusst eingesetzt werden – je nach aktuellem Bedarf der Schüler.
„Schüler brauchen auch das unterstützte Lernen voneinander und vom Lehrer”, so erklärt Pädagogik-Professor Reusser auf „Spiegel online“. Das gelte besonders für schwächere Schüler, wenn komplexe Sachverhalte neu eingeführt würden. Am erfolgversprechendsten sei es daher, Frontalunterricht und selbstständiges Lernen klug zu verknüpfen.
Die Quintessenz der FAZ, „Frontalunterricht macht klug“, ist in ihrer Verkürzung Unsinn. „Dumme Überschrift!“, so kommentiert dann auch ein Leser den Beitrag. „Anderer Unterricht macht auch klug! Jede Form hat ihre Berechtigung. Der wichtigste Faktor ist immer noch die Kompetenz des Lehrers. Es gibt Lehrer, die können gut frontal und sollten dann manchmal auch lieber dabei bleiben, andere machen besseren Unterricht mit anderen Methoden. Der Lehrer muss nicht zuletzt auch anhand der Schülerfähigkeiten entscheiden, welche Methoden geeignet sind. Als freiberuflicher Pädagoge mit häufig wechselnden Klassen habe ich da viel Erfahrung sammeln können.“
Und ein anderer Leser meint ironisch: „Am besten ist immer noch Fernsehunterricht“. News4teachers
Gab es hier nicht schon etliche Artikel zum gleichen Thema mit immer dem gleichen Ergebnis?
Wenn ich in der Suchmaske von News4teachers “Frontalunterricht” eingebe, bekomme ich in der Tat viele Artikel – allerdings, so scheint mir, aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Offenbar ein kontroverses Thema. Was für ein Ergebnis hätten Sie denn gerne?
Die Wahrheit scheint mir recht simpel: natürlich hat jeder Lehrer, der seinen Beruf selbst nur in Spurenele- menten verstand oder ernst nahm, auch in der jüngeren Vergangenheit den “Frontalunterricht” in ein Unterrichtsgespräch verpackt und zweifellos auch Phasenwechsel eingebaut, bis selbsternannte pädago- gische Zauberpriester planvoll die “Krise des deutschen Schulsystems” ausriefen und Schwärme von bil- dungsökonomistischen Unternehmen samt “coaches” über die Schulen herfielen, um sich die Taschen zu füllen oder als theoretisierende “Hirnforscher” durch medienwirksames ballyhoo Drittmittel einzuwerben.
In der Tat kranken unsere Schulen nicht an methodisch-didaktischen Schwächen, sondern an einer zuneh- mend defizitären Schülerschaft, die – weil vor Hürden immer öfter scheuend (denn auch nur einigermaßen anspruchvolle Inhalte lassen sich nun einmal mehrheitlich nicht spielerisch-genussvoll, sondern allein in ener- gischer Auseinandersetzung aneignen) – eine Phänomen, das euphemistisch mit dem harmlos klingenden Terminus “heterogen” belegt wird. Gewiß – dieser Mißstand hat keine monokausalen Ursachen, sondern ist einem Konglomerat von mangelnder Erziehung, damit einhergehender Bildungsferne, fehlender Eignung sowie freilich ebenso sozialer Herkunft geschuldet, wogegen die naive Rezeptur einer “Schule für alle” eben nur Einfaltspinseln Heilung verspricht, die den gesellschaftlichen Aufstieg durch Talent und Leistungswillen perfide als “altständisch” verunglimpfen.
Das Problem sind die Kinder, ganz eindeutig.
Wer sonst?
An der Schule können die aktuellen Herausforderungen natürlich auf keinen Fall liegen. Die Schule, ihr Selbstverständnis, ihre Organisation, ihr Abläufe, die Lehrer*innenschaft sind in jedem Fall über jeden Zweifel erhaben. Per Definition.
Diese vermaledeiten Gören. Wie kriegen wir sie nur wieder passend gemacht?
Zurück zu alten Werten und Methoden?
Ganz eindeutig, das muss die Lösung sein.
@ Georg: Trotz Änderung der Methoden schneiden wir weiterhin bei der Pisa-Studie schlecht ab. BaWü reagiert darauf mit neuen Lehrplänen. Nicht mehr die Kompetenzen stehen so sehr im Mittelpunkt, sondern wieder die Lerninhalte.
Und, wenn man schon ein paar Jahrzehnte im Geschäft ist, hat man halt die Erfahrung gemacht, dass die Schüler einige grundlegende Dinge weniger gut können als früher(dafür können sie vielleicht neue, die es damals noch nicht gab ).
Was mich immer wieder wundert, sind Behauptungen wie “… schneiden wir weiterhin bei PISA schlecht ab”. Bei der letzten PISA-Untersuchung lag Deutschland in allen Testbereichen signifikant über den Durchschnittsergebnissen, in Naturwissenschaften und Mathematik sogar in der Spitzengruppe der europäischen Nationen, in Mathe mit Finnland fast gleichauf. Dass im Lesen nur Platz 16 herauskam, lag auch daran, dass sich 2012 inzwischen 62 Länder daran beteiligen, das ist aber selbst im Testfeld, wo man am schlechtesten abschnitt, ein Platz im oberen Drittel.
Offensichtlich gibt es viele Leute, die seit 2000 (TIMSS und PISA-Start Deutschlands) keine neuen empririschen Vergleiche mehr zur Kenntnis genommen haben.
Ich bin zwar dagegen, PISA zu Gradmesser der Bildungsqualität eines Landes insgesamt zu machen,- aber wenn man sich schon auf PISA bezieht, dann aber bitte mit den korrekten Ergebnissen.
Das mit der Pisa-Studie wurde uns auf einer Fortbildung so erzählt. ich muss aber zugeben, dass ich keine Zahlen im Kopf habe. Es ist schön, wenn es anders ist. Die neuen alten Ansätze des neuen Lehrplans wurden so begründet.
In Zeitschriften wie “Wunderwelt Wissen” (die ich gestern in die Finger bekam) werden immer noch die Finnen als PISA-Sieger genannt, obwohl sie längst im Mittelfeld gelandet sind. So wird es wohl auch mit den Deutschen gehen.
Wenn Kinder nicht schulreif sind – was soll man machen. Wenn Kinder nicht mehr flüstern können, sich dauernd laut unterhalten müssen, wenn Kinder nur noch sich selbst kennen, keine Rücksicht mehr auf andere nehmen, dann kann es schon sein, dass auch die Kinder Teil des Problems sind.
Wenn ein Kind zum Frisör geht, muss es schließlich auch den Kopf still halten, um einen einigermaßen passablen Haarschnitt zu bekommen oder nicht?
Wenn ein Kind mit gebrochenem Arm zum Arzt geht, muss es den Arm auch stillhalten, um einen vernünftigen Gips zu bekommen oder nicht?
@ mississippi: Haben sich denn die Methoden wirklich so grundlegend geändert oder ist eher etwas dazugekommen? Das es den klassischen Frontalunterricht quasi nicht mehr gäbe, kann man doch auch nicht behaupten, oder?
Und wenn ich Alfs Kommentar dazunehme – den ich sehr gut finde, weil er mit Verweis auf Studien argumentiert und auch darauf hinweist, dass PISA Ergebnisse und damit auch Noten nur begrenzt als Aussage für Bildungsqualität gelten können. Danke dafür! -, hat sich ja einiges verbessert. Und vielleicht hängt das ja dann auch mit der methodischen und didaktischen Diversifizierung und der Kompetenzorientierung zusammen?
@GriasDi:
Mmmh, für mich hört sich das alles ein wenig an wie das Klagen der Unternehmen, dass es angeblich keine ausbildungsreifen Abgänger mehr gäbe.
Da fragen ja die Gewerkschaften nicht umsonst zurück, was denn Unternehmen selbst tun können, um mit der sich angeblich so stark gewandelten Klientel der potentiellen Azubis umzugehen.
Es gibt da viele Beispiele, wie z. B. Anreizsysteme, besondere Arten der Fortbildung im Unternehmen, ein Einstellen auf die Bedürfnisse der Azubis, die ja sonst oft nur mitgeschleift wurden (ich habe viel mit Berufsschulklassen im Osten zusammengearbeitet und die Geschichten waren oft haarsträubend).
Das Gleiche gilt eben auch für Schule.
@ Milchmann:
Und wenn Sie, lieber Milchmann, “heterogen” nur ein Euphemismus für Leistungsunwilligkeit ist, sich also SuS nur mehr anstrengen und Leistung bringen wollen müssten, damit alles wieder so gut wie früher wird, kann ich aus meiner Perspektive da nur eine Fehlinterpretation des Begriffs auf Basis mangelnder Kenntniss der wissenschaftlichen Debatte sowie der Zusammensetzung der aktuellen Schülerschaft konstatieren.
Und gleichzeitig frage ich mich, ob Ihr Abkanzeln der Verfechter der binnendifferenzierten und das Individuum fördern wollenden “Schule für alle” – wie ich ja einer bin – nur in der Angst begründet liegt, dann genau einer sozial-ökonomisch- und kerkunftsheterogenen Schülerschaft als Lehrkraft ausgesetzt zu sein und sich anderer als der liebgewonnenen Mittel bedienen zu müssen, um bestehen zu können? Ist es also eine schlichte Angst vor Überforderung?
Oder aber einfach das Bedürfnis, in der gesellschaftlich produzierten Elite einfach weiterhin unter sich sein zu wollen, unbehelligt von Pöbel und Gesocks?
Fragen über Fragen. Und auch ein wenig Provokation. 😉
Wenn man jahrelang in altersgemischten Klassen unterrichtet hat, kann man keinen Frontalunterricht machen, zumindest zu 80% nicht.
Das stimmt. Aber altersgemischte Gruppen sind doch auch eher noch die Ausnahme, denke ich.
In kleinen Waldorf- bzw. Montessorischulen wird es so gemacht.
@Georg
Provokationen sind mir durchaus unproblematisch, da ich selber oft genug eher mit dem Rapier fechte als das feine Florett zu gebrau- chen; meine Unterrichtsqualitäten zu beurteilen aber obliegt einzig meinen Schülern.
Tatsächlich bekenne ich mich ausdrücklich zum Auswahlgedanken – in Sport und Kultur sonderbarerweise ohne Murren akzeptiert -, da ein Staat ohne Funktionseliten schlichtweg zugrundeginge, indem er sich nach Karl Jaspers sein eigenes Grab schaufelt, wenn er die Stär- ke des Ganzen dadurch mindert, weil er die Besten nicht zur Geltung kommen lässt und, so füge ich hinzu, sich der Diktatur des Durch- schnitts ergibt. Wenn also der sogenannte “Pöbel” das mit Fleiß ge- paarte Talent nachweist, durch Leistung aufzusteigen (im übrigen eine durch die Französische Revolution erkämpfte Perspektive) – sprich: die durch das öffentliche Schulwesen gebotenen Chancen auch zu ergreifen – so soll er zurecht Häuptling werden; scheitert er, muss er eben Indianer bleiben.
@Georg
Es gibt ja noch schulreife Kinder. Wenn ich allerdings zunehmend nicht schulreife Kinder bekomme, dann muss ich auch Zeit dafür bekommen, diese schulreif zu machen, oder?
Lernen kann nur unter bestimmten Voraussetzungen stattfinden. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, muss ich Zeit dafür bekommen, diese Voraussetzungen zu schaffen.
Wenn ich als Fußballtrainer Kinder bekomme, die noch nicht laufen können, muss ich halt auch die Zeit dafür bekommen, diesen Laufen zu lernen.
@Milch: Ihren Kommentar von 14:33 Uhr finde ich gelungen und absolut richtig.
Es ist eine Tragödie, wie geringschätzig unsere lernstarken und -willigen Schüler heutzutage von der Bildungspolitik behandelt werden und welch ein Tanz dagegen ums goldene Kalb der Moralprediger (die angeblich Benachteiligten) gemacht wird, ohne dass diese davon nennenswert profitieren.
Ein Staat, der sich so wenig um die Förderung seines Elitenachwuchses kümmert, diesen geistig unterernährt wegen fixer Ideen von Gleichheit und Gerechtigkeit, schaufelt sich tatsächlich sein eigenes Grab.
Manchmal denke ich, dass dahinter sogar Absicht stehen könnte und einflussreiche Kräfte durch fragwürdige Auslegungen von Barmherzigkeit und Nächstenliebe bewusst auf eine Ochlokratie zusteuern.
@ Heike: Nach dem Motto “Halte das Volk dumm, so äußert es keinen Widerspruch und leistet keinen Widerstand.”
Sorry, Heike und xxx, jetzt wirds wild und verschwörungstheoretisch. Sie wittern einen großen Plan, wo Gesellschaft komplex und politisch ist.
Setzen Sie sich für eine Inklusive Schule ein, in der alle Kinder nach ihren Bedürfnissen gefördert werden – das gilt dann eben auch für “Hochbegabte”.
Das ist der Grundgedanken eines “weiten” Inklusionsbegriffs und nicht nur der oft mies gemachten, weil möglichst günstigen, Verengung, wie sie leider gerade zu oft unter dem Label “Inklusion” zu verkaufen versucht wird.
@ GriasDi: Ja, genau, da bin ich voll bei Ihnen. Deshalb muss Schule besser finanziert und der Schlüssel verkleinert werden. Wer eine bessere Schule will, muss neben der Suche nach eine guten Organisation und inhaltlichen Strategie auch die Steuer- und damit Verteilungsfrage stellen.
Aber das wird in diesem Land gescheut wie der Teufel das Weihwasser. Und das obwohl sich seit Jahrzehnten die Einkommens- und Vermögensverhältnisse auseinanderentwickeln (was in schönster Regelmäßgikeit Artikel produziert, ohne dass sich außer der LINKEN jemand daran stört) und sich immenser Reichtum unproduktiv bei verhältnismäßig wenigen ansammelt.
Genau diesen beliebten und probaten Einwand “Verschwörungstheorie” habe ich von Ihnen als Reaktion auf Heikes Kommentar erwartet. Er gehört zu den bekanntesten Keulen zur Bekämpfung anderer Meinungen.
Insofern könnte man allen Schlitzohren raten: Bezeichnet die Meinung eurer Gegner als Verschwörungstheorien und schon sind sie lächerlich gemacht. Wer als Verschwörungstheoretiker bezeichnet wird, ist zugleich als Spinner gebrandmarkt, ohne dass dies ausdrücklich gesagt würde. Das wäre ja auch zu auffallend.
Von Verschwörungstheorie reden Sie auffallend oft, wenn Ihnen eine Meinung oder Befürchtung nicht ins Konzept passt.
Lieber U.B.,
Sie hatten scheinbar wirklich einen schlechten Tag gestern.
Vielleicht ist es ja heute besser. Ich wünsche es Ihnen.
Trotz Ihrer unangenehmen Rumpeligkeit deshalb noch einmal: Fröhliche Weihnachten!
Die Ursache sind nicht die Kinder selbst, sondern vielmehr der Wohlstand in unserer Gesellschaft. Die Kinder brauchen sich nämlich nicht mehr anzustrengen, um von den Eltern alles zu bekommen, was sie haben wollen. Dazu gehören Lebensmittel, Kleidung, Medikamente, technische Geräte, Bargeld usw.. Darüber hinaus müssen die Eltern nur genug Druck beim Lehrer bzw. Schulleiter machen, um das für die Kinder erwünschte Ziel auch ohne Arbeit erreicht zu bekommen.
Das gilt in anderer Form auch für die so genannten bildungsfernen Schichten, für die das Verhältnis aus Arbeit (=Lernen) und Ertrag (= nennenswert höherer Wohlstand als die soziale Hängematte) nicht mehr zwingend lohnend zu sein braucht.
Mmmh, das finde ich schwierig.
Ihr Beitrag pauschalisiert. Die “bildungsfernen Schichten” wollen nicht arbeiten und ruhen sich in der “sozialen Hängematte” aus.
Mal abgesehen von den mir so verhassten Pauschalisierungen: Waren Sie schon mal auf ALG II und wissen, was das heisst? Das ist alles andere als eine Hängematte. Das Geld reicht für nichts und die Behörde ist gnadenlos am sanktionieren.
ein Friseur verdient netto nur unwesentlich mehr als alg ii, die diversen aufstocker ebenso. wer nur aussicht auf solche einkommen hat, kann gleich in der Hängematte liegen bleiben. gez gibt es gratis dazu.
Wie gesagt: ALG II ist keine Hängematte. Ich hatte das selbst schon mal durch und erlebe das immer mal wieder in meinem Bekanntkreis bzw. bei Migranten.
Wenn im Friseurberuf so wenig Geld gezahlt wird, das es kaum zum Leben reicht, sind nicht die Leute daran Schuld, die ein staatlich willkürliches festgelegtes Existenzminimum erhalten.
Unter den ALG II Leuten gibts sicher manche, die keine Lust auf Arbeiten haben, was ich – als Freund der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens – volkommen legitim finde. Es gibt aber auch genug Menschen, die aus anderen Gründen keine Arbeit antreten können. Die werden dann immer pauschalisieren mit abgewatscht, wenn mal wieder die in Deutschland traditionell so beliebte “Harte Hand” gefordert wird.
Tut mir leid, dass Sie mal von Hartz IV leben mussten. Sie vermischen in Ihrer Antwort aber wieder zwei Dinge, nämlich die Berufe mit Einkommen wenig oberhalb des Existenzminimums und die Schuldfrage daran.
Die von Transferleistungen lebenden Menschen sind natürlich nicht Schuld an der Gehaltsstruktur. Sie bekommen aber vom JobCenter die Miete, den Lebensunterhalt, die Heizung, die GEZ, diverse Versicherungen usw. bezahlt. Damit kommt man sehr schnell auf 800-1000€ im Monat, als alleinerziehender Mensch mit Kindern auch auf 1400€ im Monat. Ein Friseur in Vollzeit schafft um 1200€ netto (ggf. zzgl. Trinkgeld ggf. zzgl. Schwarzarbeit). Aus diesem Grund wird es Menschen geben, die anstelle eines Ganztagsjobs für das gleiche (oder nur wenig weniger) Geld den Offenbarungseid im JobCenter vorziehen und “frei haben”. Sehr viele andere Menschen verdienen lieber weniger als ihnen nach Hartz IV zustünde, wollen sich aber die Schmach des JobCenters nicht antun, z.B. weil sie noch Teil der Gesellschaft sein wollen ohne ihr (gefühlt) auf der Tasche zu liegen.
Man braucht aktuell schon mehr als 2000€ brutto im Monat, um in der Altersrente mehr zu haben als Grundsicherung. Das werden etliche Kassiererinnen in Teilzeit nicht schaffen. Deutschland wird noch sehr sehr große Probleme mit der Rente bekommen …
Ich kann das bestätigen: Die Lehrbuchtexte werden immer simpler; die Anforderungen an gute Noten immer milder. Damit man sich irgendwann wohl damit brüsten kann, wie gut die Schüler “wieder” in der Schule abschneiden.
Aus der DDR kenne ich das als “den Plan nach unten korrigieren”. Das war damals ein geflügeltes Wort. Wenn ein Betrieb merkte, er schaffte seinen Jahresplan wahrscheinlich nicht, dann wurde einfach das Plan-Soll verringert und am Ende konnte man stolz melden, den Plan erfüllt – oder sogar übererfüllt zu haben (obwohl man unter den ursprünglichen Zielen geblieben war). 😉
Die Bücher werden auch mit immer mehr bunten Bildern gefüllt.
Vergleichen Sie mal eine Bravo von 198x mit einer aktuellen. In ersterer gibt es noch Artikel, die von der Länge und Schriftgröße den Namen verdienen, von letzterer kriege ich ADHS wegen viel zu bunt-knallig-“laut”
Ein guter Lehrer mischt die Methoden und verwendet verschiedene Ansätze je nach Inhalt und Klasse und manchmal auch einfach nur zur Abwechslung.
Ich habe den Eindruck, dass all die unterschiedlichen “Moden” nicht wirklich irgendetwas am unterschiedlichen Leistungsstand verändert haben. Es gab und gibt in allen Klassen eine Spitze, ein breites Mittelfeld und Schüler, die nicht mithalten können. Diesbezüglich gibt es überhaupt keine Veränderung – ob nun Frontalunterricht oder “schülerzentriert” !
Und trotz all der modernen Formen freuen sich die meisten Schüler immer noch auf die Pausen, auf das Wochenende und auf die Ferien.
Und auf den Ausfall.
Warum konnten all die tollen neuen “Moden” daran nichts ändern?!?
@ sofawolf: Sie sagen das Ergebnis der ganzen Studien in ihrem ersten Satz. Aber das hatten wir ja schon alles.
Nur dass die Anforderungen für die breite Mitte im Laufe der vergangenen Jahrzehnte anders geworden sind. Es kamen zweifellos neue Inhalte dazu, insbesondere technischer Art, jedoch hat die fachliche Tiefe in deutlich stärkerem Maße abgenommen. Ich habe mal in einem 35 Jahre alten Mathebuch für eine 10. Klasse in der DDR, ich meine das Realschuläquivalent, geblättert. Etliches davon bräuchte man vom Abstraktionsniveau her sogar in heutigen Leistungskursen 12. Klasse garnicht erst zu versuchen.
Naja, Schule ist ja noch einiges mehr als “neue Methoden”. Es ist immer noch eine Zwangsveranstaltung und die einzige Institution in diesem Land, die Menschen zur Mitgliedschaft zwingen kann – mal abgesehen von Gefängnissen.
Außerdem ist es auch eine soziale Zwangsgruppierung. Kinder können sich nicht aussuchen, mit wem sie da den ganzen Tag verbringen müssen. Wir als Erwachsenen können unseren Job kündigen, wenn wir die Kolleg*innen nicht mögen. Kinder können aus ihrer Klasse nur sehr, sehr schwer raus.
Das nur als Beispiele, die Liste liesse sich noch beliebig fortsetzen.
Sind Sie denn auch wie ich für die Erlaubnis von Homeschooling? Wenn nicht, halte ich Ihre Worte für nur frommes, sympathieheischendes Gerede.
Joa, auf so einen Ton antworte ich einfach mal nicht.
Ach ja? Dass Sie ein Freund rücksichtsvoller und höflicher Töne sind, ist mir bisher entgangen.
Warum sich also hinter Tönen verstecken, wenn Ihnen die Antwort in der Sache unbequem ist und schwer fällt?
Sagen Sie, was ist mit Ihnen los?
Es ist Weihnachten. Warum garsten Sie mich so an?
Das ich ein Freund verschiedener Töne bin, ist Ihnen trotz ihrer Wachsamkeit scheinbar entgangen. Sie nageln mich gerade auf einen Klang fest. Das finde ich ganz schön Panne, wie man so schön sagt.
Und nein, ich drücke mich nicht um eine Antwort. Das habe ich hier – im Vergleich zu manch anderer Person – noch nicht getan. Auch das ist Ihnen scheinbar nicht aufgefallen. Warum sollte ich also jetzt damit anfangen?
Ich antworte nur Ihnen nicht, weil sie mich gefühlt gerade anranzen und ich das nicht mag.
In ganz anderem Sinne deshalb: Fröhliche Weihnachten!
Stimmt, ich war unfreundlich. Entschuldigen Sie bitte!
Nichts desto trotz auch von meiner Seite: Frohe Weihnachten!
“scheinbar”, “scheint”, “anscheinend”, “offenbar/offensichtlich” – “Georg” scheint da nicht so sattelfest zu sein.
Jemand, der in “Sachen Sprache” unterwegs ist – so las ich es zumindest von ihm, etwas unverständlich und auch nervig!!
Bitte vom Weihnachstmann unbedingt eine “Tüte Unterricht” schenken lassen.
Hallo mehrnachdenken,
in meinem bisherigen Leben ist mir die Unschärfe in der Nutzung der Begriff noch nie zum Problem gewordenm, und ich bin, außer vom Milchmann, darauf auch noch nie hingewiesen worden.
Hier wird es das, und das ist auch in Ordnung. Ich freue mich immer, wenn ich was dazulernen kann.
Allerdings muss ich mich mal wieder über Sie wundern.
Sie wollten doch auf meine Posts eigentlich nicht mehr reagieren, oder? Aber wenn es um so etwas geht, können Sie die Finger einfach nicht stillhalten, oder? Da drückt es Sie dann ganz nachhaltig und Sie müssen sich, ganz oberlehrerhaft, dazu äußern, was?
Und wenn Ihnen etwas unverständlich ist, muss das nicht unbedingt daran liegen, dass das Gegenüber sich unverständlich ausdrückt. Es könnte auch bedeuten, dass Ihnen da die eine oder andere Tüte Unterricht mehr vielleicht auch Ihnen nicht schaden würde.
In diesem Sinne auch Ihnen: Fröhliche Weihnachten und einen besonders spendablen Weihnachtsmann.
Naja, es holpert etwas mit dem “Ihnen”.
Aber ich denke mal, daß Sie die frohe Botschaft inhaltlich erreicht hat.
@ U. B.
Danke!
Ihnen auch.
Es fällt mir ein wenig schwer, Ihr Mitleid mit den armen, zwangskasernierten Schülern zu teilen, die sich weder ihre Lehrer noch ihre Klassenkameraden aussuchen dürfen.
Was schlagen Sie zur Änderung dieses inhumanen Zustandes vor?
Ich habe mit dem Kommentar nur meinen Schulpädagogik-Prof zitiert, den ich für einen sehr kompetenten Lehrer (hat jahrelang als Hauptschullehrer in der Schweiz gearbeitet) und Pädagogen (großartige, interaktive Vorlesungen und pädagogische Haltung) halte und dessen Hinweis ich ganz schön augenöffnend fand.
Ich habe über Alternativen auch noch nicht wirklich nachgedacht.
Prinzipiell reicht es mir aber auch erstmal, das – zu Recht – festzustellen und das in seinem Blick auf die SuS, das ihnen zugemutete und ihr Verhalten mitzudenken. Das kann Einfluss auf die Haltung und das Verständnis haben, das LK dann ihren SuS entgegenbringen, denke ich.
Und eben auch das Bedürfnis bzw. die Offenheit erhöhen, Schule anders zu denken und auch zu gestalten.
Die Methoden sollten auch zur Lehrerpersönlichkeit passen.
Gäbe es DIE beste Unterrichtsmethode, so würden doch alle mit dieser Methode unterrichten. An der Vielzahl der Unterrichtsmethoden kann also abgelesen werden, dass es DIE Unterrichtsmethode nicht gibt.
Ein interessanter Link:
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/moocs-online-kurse-schliessen-keine-sozialen-bildungsluecken-a-1067284.html
@ Georg
Sie fragen: „Zurück zu alten Werten und Methoden?“ Ja, warum nicht!?
„Alt“ bedeutet nicht automatisch „schlecht“ und „neu“ nicht automatisch „gut“, auch wenn dies immer wieder nahegelegt wird durch die Bedeutung dieser Begriffe auf technischem Gebiet.
Ich wünsche mir oft eine Rückbesinnung auf Bewährtes, das ohne Not abgeschafft wurde und wird, weil ach so tolle, aber utopische Ideen vieles verdrängen, was sich auf Grund allgemein guter Erfahrungen entwickelt und als erfolgreich durchgesetzt hat. Ein Wirbel, wie ihn „Des Kaisers NEUE Kleider“ regelmäßig brauchen, wurde um diese Erfolge nie gemacht. Sie sprachen für sich und nicht für Erfinder.
Es ist keine Schande zu erkennen, dass der Kaiser nackt ist und seine Schneider nur Aufschneider. Im Gegenteil, es zeugt von Realitätssinn und Widerstandsfähigkeit gegen das häufige Blendwerk von Illusionskünstlern.
Diese sogenannten neuen Methoden sind ja auch schon mindestens 100 Jahre alt.
Nun, Frau Prasuhn, so lange sich Altes in der neuen Zeit bewährt und nicht durch Besseres ersetzt werden kann, hat es zweifellos seine Berechtigung. Da wäre ich der Letzte, der für Austausch ohne Notwendigkeit plädieren würde.
Gleichzeitig bin ich aber auch sehr dafür, neue Dinge, die sich vielversprechend anhören und in kleinerem Rahmen auch schon erfolgreich getestet wurden, anzuwenden und zu schauen, ob sie funktionieren.
Unpassend finde ich in dem Rahmen dann auch Formulierungen wie “utopische Ideen”, “Blendwerk” und “Illusionkünstler”, die mal wieder dem so beliebten “Realitätssinn” (aka “gesunder Menschenverstand”) gegenüber gestellt werden. Damit sprechen Sie in meinen Ohren anderen, als den von Ihnen liebgewonnenen Techniken und Methoden ganz grundlegend die Berechtigung ab (da sie ja schon von der Grundlage her nicht funktionieren können), anstatt sachliche Kritik zu üben.
Alan Posener ist nicht nur mit einer Grundschullehrerin verheiratet, bevor er Freiberufler und dann Journalist wurde, war er selbst Lehrer, zuletzt Studiendirektor.
Interessant, das habe ich nicht gewusst. Danke!
Meine Kritik an den Punkten halte ich aber trotzdem aufrecht.
@Xxxx: Ihrem Beitrag vom 21.12. um 22.55 Uhr muss ich völlig zustimmen. Um das “Wohl” ihrer Kinder durchzusetzen, tun heutige Eltern vieles, gepaart mit einer Form von Respektlosigkeit gegenüber den Lehrern.