BERLIN. Naturwissenschaftliches Argumentieren beruht auf möglichst genauen Daten. Doch es kommt auch darauf an, die Fakten einschätzen zu können. Doch auch 14-jährigen Schülern fehlt es an den notwendigen Kompetenzen, haben Berliner Wissenschaftler in einem Experiment ermittelt. Fehlt es also auch älteren Schülern an grundlegenden Kenntnissen zum Verständnis wissenschaftlichen Denkens? Die Forscher plädieren dafür, den kritischen Umgang mit Messwerten früher zu thematisieren.
In unserer Gesellschaft spielen Daten eine enorme Rolle. Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, aber auch das Privatleben sind geprägt von Entscheidungen, die auf Basis von Daten getroffen werden. Doch wie kommen wir eigentlich zu guten, vulgo „richtigen“ Entscheidungen? Wohl die meisten von uns würden die Aussage unterschreiben: Je mehr und genauere Fakten vorliegen, desto genauer kann eine Sachlage eingeschätzt werden und desto fundierter fällt mithin eine Entscheidung aus. Dass dies nicht immer so ist hat jetzt ein Forscherteam der Berliner Humboldt-Universität um den Physikdidaktiker Burkhard Priemer in einem Experiment gezeigt.
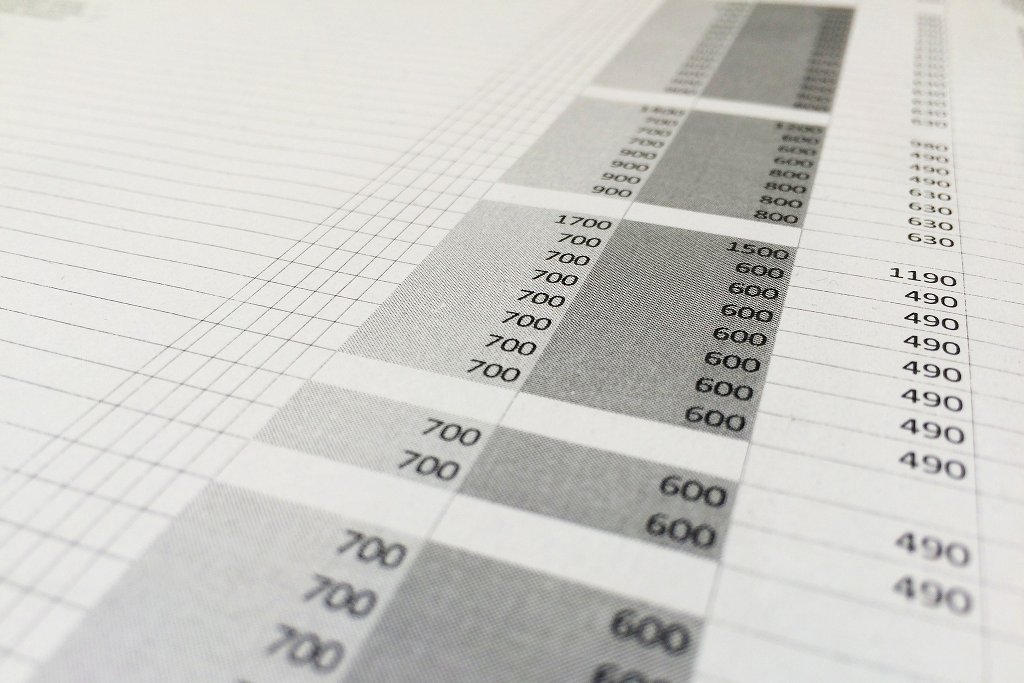
Die Wissenschaftler hatten den Verdacht, dass Schüler mit präzisen Daten gar nicht angemessen umgehen können, sondern durch diese vielleicht sogar zu Fehlschlüssen verleitet werden und diese Vermutung habe sich bestätigt. Deutlich habe sich gezeigt, dass Schüler, die zuvor genauere Daten aus einem physikalischen Experiment erhalten hatten, Sachverhalte weniger gut einschätzen konnten, als jene mit weniger genauen Daten.
Die 14-jährigen Schüler waren zuvor zufällig in drei Gruppen eingeteilt und mit Daten unterschiedlicher Qualität ausgestattet worden. Erhielt eine Gruppe Werte mit nur zwei Nachkommastellen, konnten sich die beiden anderen auf Messwerte mit drei oder vier Stellen nach dem Komma stützen. Bei den Experimenten ging es darum, die Fallgeschwindigkeit eines bewegten und eines unbewegten Objekts zu vergleichen.
Auf Basis der Messdaten sollten die Schüler ihre zuvor genannten Prognosen überprüfen. Die Ergebnisse zeigten, dass mit der Zunahme der Dezimalstellen die Anzahl der Schüler abnahm, die von einer falschen zur korrekten Hypothese (beide Objekte fallen gleich schnell) wechselten. Überdies wechselten bei genaueren Messdaten mehr Schüler zu einer falschen Hypothese.
Die Wissenschaftler erklären dieses Resultat mit fehlenden Kompetenzen von Schülern, die dazu führen, dass sie mit Unsicherheiten in Messungen nicht angemessen umgehen könnten, sondern sich stattdessen auf ihre Intuition verließen. Traten mit zunehmenden Dezimalstellen Unterschiede in den Messdaten auf, sei diese Intuition verunsichert worden, auch wenn diese in den Bereich der Messungenauigkeiten fielen, also keinen relevanten Effekt auf die Untersuchungsergebnisse gezeitigt hätten.
Den Schülern künftig also nur ungenaue Daten zu geben sei daher keine Lösung. Um den kritischen Umgang mit Daten frühzeitig in den Fokus zu rücken, sei es daher wichtig, diesen kritischen Umgang bereits in den Schulen zu thematisieren, so die Forscher. (pm)
Gefordert ist also, dass Schüler im Alter von 14 Jahren (zumeist 8. Klasse) die 4. Stelle nach dem Komma lesen und als Messungenauigkeit wahrnehmen und zur Einschätzung der Daten an sich korrekt interpretieren können.
Dabei zeigt sich, dass viele das in diesem Altern nicht können.
Daraus wird dann eine Aussage konstruiert,
a) dass Schüler generell nicht die Kompetenz hätten, Daten zu bewerten (Überschrift)
b) dass Schüler mit präzisen Daten nicht angemessen umgehen können
und die Forderung erhoben, dass SuS dies frühzeitig lernen müssten … wohlgemerkt bezogen auf die 4. Nachkommastelle.
Nun mag man den Rahmenlehrplan aus Berlin unübersichtlich finden, aber die Widerlegung einer Hypothese ist laut Rahmenlehrplan Physik übrigens erst für das 9. SJ angegeben, die Interpretation der Untersuchungsergebnisse auch, ebenso die Angabe gemessener Größen mit sinnvoller Genauigkeit. (S. 20+21 Teil_C_Physik_2015)
Die zur Testung genutzten Inhalte sind für den Doppeljahrgang 9/10 verortet (S. 29+40)
Der Didaktiker hat also erforscht, dass SuS das, was sie im nachfolgenden Schuljahr lernen sollen, zuvor noch nicht können?
Das ist natürlich bedenklich.
“Die Forscher plädieren dafür, den kritischen Umgang mit Messwerten früher zu thematisieren.”
Und wieder wird einfach etwas von uns gefordert, von jemandem der ganz offensichtlich nicht ganz in der Thematik drin ist. Zumindest in NRW wird sehr wohl auch schon früher mit Daten umgegangen, vor allem im Fach Mathematik, findet man dies im Kernlehrplan.
Was der Didaktiker auch verschweigt, ist dass vielen Kindern in dem Alter die kognitive Fähigkeiten fehlen, komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Das zeigt sich im Unterricht immer wieder, dass ein Zusammenhang hunderte Male besprochen werden kann, die Klassenarbeit schlecht ausfällt und ein Jahr später sagen viele Schüler “ach so einfach war das? Warum konnte ich das denn damals nicht?”
Man könnte also mal davon abweichen, immer so zu tun, als könnte man Kindern alles beibringen, wenn man sich nur genug Mühe dabei gibt!