DRESDEN. Sachsens Kultusminister Conrad Clemens lädt zum „Handygipfel“ und will klären, ob Smartphones an Schulen verboten werden sollen. Doch eigentlich liegen die Antworten längst auf dem Tisch – aus der Praxis. In Dortmund zum Beispiel hat die Europaschule vor einem Jahr klare Handynutzungsregeln eingeführt. Die Erfahrungen des Kollegiums sind sogar noch positiver als erwartet (und belegen, dass sich Befürchtungen im Vorfeld als unbegründet erwiesen haben).
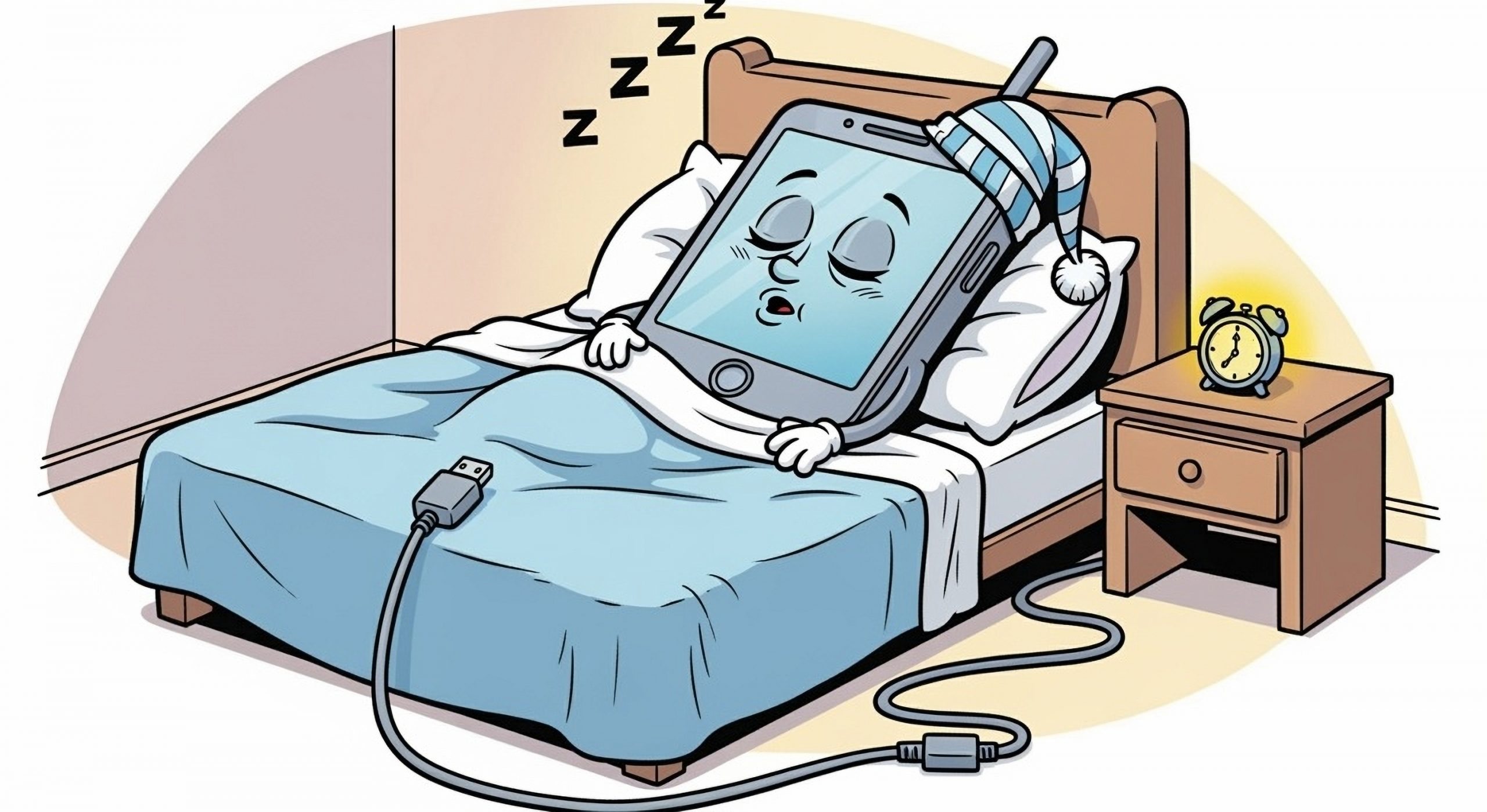
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) lädt für Donnerstagnachmittag zu einem „Handygipfel“. Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) reist an, Experten wie Prof. Manfred Spitzer geben Impulse, Verbände und Elternvertretungen wollen mitreden. Die große Frage: Soll es ein Handyverbot an Schulen geben – und wenn ja, wie?
Dabei müsste Clemens gar nicht erst einen Gipfel einberufen. Ein Blick in die Praxis zeigt, dass Lösungen längst erprobt sind. An der Europaschule Dortmund zum Beispiel. Dort hat das Kollegium um Schulleiter Jörg Girrulat bereits vor einem Jahr „Handynutzungsregeln“ eingeführt – mit durchweg positiven Ergebnissen.
„Seitdem wir das gemacht haben, konnten wir feststellen, dass viele der Schülerinnen und Schüler sich wieder besser auf den Unterricht konzentrieren konnten“
„Wir selber benutzen das Wort Handyverbot gar nicht, sondern den Begriff Handynutzungsregeln“, erklärte Girrulat im Gespräch mit WDR 5. „Verändert hat sich eine ganze Menge, aus unserer Sicht vieles zum Vorteil. Anlass, die Handynutzung zurückzunehmen, war, dass wir festgestellt haben, dass sehr viele Schülerinnen und Schüler vor allen Dingen in den Pausen – und vor allem auch die Jüngeren – sich sehr viel mit dem Handy beschäftigt haben, mit den sozialen Netzwerken, und gar nicht mehr miteinander gesprochen haben. Sie haben nicht mehr kommuniziert, nicht gespielt – das ging immer weiter zurück. Wir hatten den Eindruck: Wir müssen da jetzt gegensteuern.“
Die Wirkung sei unmittelbar spürbar gewesen: „Seitdem wir das gemacht haben, konnten wir feststellen, dass viele der Schülerinnen und Schüler sich wieder besser auf den Unterricht konzentrieren konnten. Die Anfangsnervosität, die wir in den ersten Stunden immer noch wahrgenommen haben, ist zurückgegangen. Das Unterrichten hat sich deutlich vereinfacht. Das ist ein Nebeneffekt – aber einer, den wir nicht erwartet hätten.“
Auch die Zahl der Störfälle habe sich massiv verringert: „Missbrauch des Handys, soziale Netzwerke, Videos machen, Fotos verteilen, mit Airdrop irgendwelche Dinge verschicken – all diese Probleme sind zurückgegangen. Das hat den Unterrichtsalltag für alle in der Schulgemeinde deutlich vereinfacht und verbessert.“
Wie setzt man eine solche Regel in der Praxis durch? Girrulat berichtet: „Mit Betreten des Schulgeländes muss das Handy bei den Schülerinnen und Schülern ausgeschaltet sein und in der Tasche verschwinden. Es darf erst wieder beim Verlassen des Schulgeländes herausgeholt werden. Wann immer wir Schülerinnen oder Schüler finden, die das Handy trotzdem benutzen, wird es eingezogen. Wir dürfen das ja nach Paragraph 53 Schulgesetz NRW zeitweise einziehen, wohlgemerkt zeitweise, weil es nicht uns gehört. Wir haben gedacht, das würde am Anfang ein Riesenproblem mit sich bringen. Deshalb hatten wir eine Kulanzphase zu Beginn des Schuljahres von einem Monat, in dem wir die Schülerinnen und Schüler noch mal deutlich darauf hingewiesen haben: Bitte, packt das Handy weg, sonst nehmen wir es euch ab.“
„Unser Hauptansatzpunkt war, die Eltern zu überzeugen, dass es überhaupt keine Notwendigkeit gibt, während der Schulzeit ein Handy zu haben“
Doch die Befürchtungen bestätigten sich nicht. „Nach dieser Kulanzphase haben wir es dann so umgesetzt, wie ich es gerade skizziert habe. Tatsächlich war die Anfangsphase schwieriger, weil es eine Zeit gedauert hat, bis alle verstanden haben, dass wir das ernst meinen und dass wir es auch wirklich durchsetzen. Egal, welche Lehrkraft sie dabei erwischt – das Handy ist dann erstmal weg. Inzwischen gibt es fast keine Probleme mehr. Wir haben dieses sogenannte Handyhotel im Lehrerzimmer, in dem die eingezogenen Geräte aufbewahrt werden. Am Ende der Pause oder der Mittagszeit geben wir sie zurück. Statistisch gesehen haben wir am Tag vielleicht fünf Handys im Handyhotel – bei 1.200 Schülerinnen und Schülern. Das ist verschwindend gering.“
Unerwartet war für den Schulleiter, woher der größte Widerstand kam: „Der kam gar nicht von den Schülerinnen und Schülern, sondern von den Eltern. Das hat uns sehr überrascht. Die Eltern waren ja eigentlich der Meinung, dass sie ihre Kinder jederzeit erreichen müssten – nicht nur vor und nach dem Unterricht, sondern auch zwischendurch, um mehr oder minder wichtige Dinge abzusprechen: Was gibt es zum Mittagessen, wann holst du mich ab? Unser Hauptansatzpunkt war, die Eltern zu überzeugen, dass es überhaupt keine Notwendigkeit gibt, während der Schulzeit ein Handy zu haben. Denn wir haben ein Telefonsekretariat, über das die Schule die Eltern erreichen kann – und umgekehrt. Und natürlich gibt es immer Ausnahmen. Jede Lehrkraft kann im Notfall sagen: Hol dein Handy raus, wir machen das darüber.“
Girrulat betont zudem, dass es seiner Schule nicht um Digitalfeindlichkeit geht: „Wir sind ja keine Gegner der Digitalisierung. Unsere Schülerinnen und Schüler haben iPads, die ihnen von der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Mit diesen Geräten arbeiten wir statt mit Handys – und die können wir kontrollieren. Wir können wichtige Funktionen wie Internet, Airdrop oder Kamera gezielt ausschalten. Das ist der Unterschied.“
Auch beim Thema Medienerziehung sieht er die Schule nicht allein in der Verantwortung: „Viele Probleme entstehen durch soziale Netzwerke. Aber die Schule kann das nicht allein lösen. Eltern müssen hier mitwirken – und sind leider oft keine guten Vorbilder, weil sie selbst ständig mit dem Handy beschäftigt sind. Wir versuchen gegenzusteuern, mit Infoabenden, Fortbildungen und Aufklärung, überall da, wo es nötig ist.“ Das Fazit nach einem Jahr Handynutzungsregeln: Selbst viele Schülerinnen und Schüler sind erleichtert, dass sie in der Schule einmal frei vom Smartphone sind.
In Sachsen hingegen wird das Thema jetzt großflächig verhandelt. Kultusminister Clemens hatte im Mai noch im Landtag ein generelles Handyverbot an Grundschulen verfehlt (die Landesregierung verfügt im Parlament über keine eigene Mehrheit) – nur BSW, AfD und ein fraktionsloser Abgeordneter stimmten damals zu. Zwar gilt an den meisten Grundschulen im Freistaat ohnehin schon ein Handyverbot, doch über einheitliche Regeln wird weiter gestritten.
Auch unter Lehrkräften gibt es Vorbehalte. Die Lehrergewerkschaften äußern sich kritisch zu pauschalen Verboten. Burkhard Naumann (GEW) erklärte: „Ein pauschales Handyverbot greift zu kurz, ist nicht realistisch und auch nicht pädagogisch sinnvoll. Stattdessen braucht es klare, gemeinsam vereinbarte Regeln, die von Schülern, Lehrkräften und Eltern getragen werden.“ Auch der Sächsische Lehrerverband lehnt ein generelles Handyverbot ab, fordert aber Einschränkungen an Grundschulen – und verweist auf praktische Probleme wie die Frage, wer Geräte einsammelt und haftet.
Der Landesschülerrat wiederum sieht in Handyverboten keine Lösung. „Medienkompetenz erlangen Schülerinnen und Schüler nicht durch ein solches Verbot“, sagte Sprecher Felix Schönherr. Auch der Landeselternrat spricht von Symbolpolitik und fordert stattdessen schulformspezifische Lösungen. Während also in Dresden diskutiert wird, wie man Handys an Schulen künftig reguliert, haben Schulen wie die Europaschule Dortmund längst gezeigt, dass klare Regeln funktionieren – und zwar zum Vorteil von Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und Schülern. News4teachers / mit Material der dpa
Erst lässt man die Schulen jahrelang allein im Regen stehen und vor sich hin wurschteln…..wer im Jahr 2025 aber dann plötzlich bemerkt,dass irgendetwas bei den Handys getan werden muss,hat irgendwie im Dornröschenschlaf gelegen…..dann jedoch kommt man mit einem stumpfsinnigen Verbot. Dass die Schule dann…Überraschung….umsetzen muss. Die aber seit langer Zeit Regeln implementiert hat. Vielleicht könnte man einfach den Einfluss von Kultuspolitik in Schule verbieten. Dann läuft der Laden besser.
Die KMK und die Schulministerien ganz einfach auflösen oder mit dem Laden für Wissenschaft und Forschung fusionieren.
Wir waren nicht alleingelassen. Wir hätten nur keine Vorgaben von oben. An unserer Schule gab es trotzdem seit x-Jahren ein Handyverbot. So weit es erlaubt ist, kann man auch selbstständig handeln. Auf “oben” warten ist wohl noch ein bisschen DDR-Mentalität.
“ Dass die Schule dann…Überraschung….umsetzen muss. Die aber seit langer Zeit Regeln implementiert hat.” Überlesen?
Bei uns in NRW macht das Ministerium, was es immer macht:
Dann die Verantwortung den Shculen überlassen, wenn es eine “Vorgaben von oben” geben müsste (und umgekehrt). Und bei usn beshcließt das die Shculkonferzenz, die zu je einem Drittel mit Lehrern, Eltern und Schülern besetzt ist… nach jahrelangem Kampf haben wird endlich(!) zu diesem Jahr das kompeltte Verbot auf dem Schulgelände (trotz allen Widerstandes) umsetzen können… und die ersten beiden Tage waren bereits hervorragend: Kinder, die miteinander reden, spielen etc. Hat man bei uns seit Jahen (vor Corona bereits) nicht mehr gesehen. Endlich!
Das freut nich aufrichtig! 🙂
Wie wird Ihre Schule mit einkassierten Handys verfahren? Ist ne (frustrierende) Dauerdiskussion an meiner Schule -__-
Bei einmaligem Verstoß zentrale Verwahrung bis zum Schultagesende (15:30 Uhr), bei wiederholtem Verstoß längere Verwahrung (auch mal ein paar Tage, rechtlich in NRW möglich) resp. nächste Eskalationsstufe (z.B. Ordnungsmaßnahmenkatalog).
Danke für die Rückmeldung. Verwahren Sie die Handy im Sekretariat, bei sich oder der Schulleitung?
Sekretariat.
Die Handynutzungsregeln der Europaschule waren in Bayern jahrelang genau so vorgeschrieben, also auch dort gelebte Praxis. Aus meiner Sicht hätte es auch so bleiben können. Erst vor zwei Jahren wurden sie aufgeweicht.
Ich kann gar nicht nachvollziehen, dass es noch Schulen gibt, die Handys in Pausen erlauben. …
Das, was an der Europaschule praktiziert wird, gibt es an meiner Schule bereits verschärft seit schon vor Corona. Die Kids kriegen das eingesammelte Handy erst am Ende des Schultages zurück. In der Regel von der Schulleitung, da das Sekretariat nachmittags nicht mehr geöffnet ist. Es wird vermerkt, wenn das Handy eingesammelt wurde, und zieht nach mehrmaligem Regelbruch Konsequenzen nach sich.
Nun ja, das klappt so lala und ist sehr aufwendig für die Lehrkräfte, die jemanden erwischen.
Gemaule seitens der Kids gibt es selten, aber einige sind einfach unbelehrbar.
Was passiert, wenn gerade keine Lehrkräfte anwesend sind, weil Pausenaufsichten nun einmal nicht überall sein können, wissen wir alle. Manchmal posten einige nämlich Aufnahmen aus der Schule bei Insta und Co …
Daher bin ich für ein Handy-Parken am Anfang des Schultages. Das hätte dann auch zur Folge, dass die gar nicht erst in Versuchung geraten, denn Vibration und Benachrichtigungsgeräusche kriegt man auch mit, wenn das Handy nicht sichtbar ist, und mehr auf die Zeit achten, ohne auf ihr Handy schauen müssen. Einige lernen dann auch, wann sie wo Unterricht haben. Jetzt schauen sie ständig doch auf ihr Handy. Stundenplanänderungen können sie zwar überall auf Monitoren …
Wie ging das eigentlich früher?!
Ja früher…
ich werde jetzt nicht von “Früher” erzählen. Nur das Ergebnis benennen: ein abwechslungsreiches Leben – bis heute. Schön war und ist es.
So ist es bei uns an der Grundschule schon immer. Das soll aber keine Kritik sein, sondern aussagen, dass ich nicht einschätzen kann, wie es an den weiterführenden Schulen “abgeht”. Das Handyverbot an den Grundschulen wird durchaus von Einzelnen unterlaufen. Aber das sind dann vielleicht im Vergleich zu den “Oberschulen” nur Einzelfälle.
Genauso an unserer Grundschule. Die Kids lernen quasi von klein auf, dass Handy ausgeschaltet im Tornister zu lassen. An den weiterführenden Schulen müssen sie die “neuen” Handyregeln also nicht erst erlernen.
“Der Landesschülerrat wiederum sieht in Handyverboten keine Lösung. „Medienkompetenz erlangen Schülerinnen und Schüler nicht durch ein solches Verbot“, sagte Sprecher Felix Schönherr.”
Ähh, doch. Denn gutes Zureden und Aufklärung in Bezug auf Bildschirmzeiten, Aufmerksamkeitsspanne und Cybermobbing alleine, haben über all die Jahre ja nicht in ausreichendem Maße funktioniert. Zur Medienkompetenz gehört auch das Wissen, wann das Handy mal ausgeschaltet in der Tasche sein muss. Kein 12-jähriger muss 24/7 Zugang zu seinem Handy haben. Sollte tatsächlich mal ein familiärer Notfall eintreten, sind die Lehrkräfte über das Sekretariat oder die Schul-App (Sdui) für die Eltern erreichbar und die können das Kind dann entsprechend informieren oder dann das Einschalten des Handys gestatten.
Ähh, nein. Ein Verbot führt nicht automatisch zu mehr Medienkompetenz. Es verlagert bestenfalls nur das Problem, löst es aber nicht. Ansonsten gebe ich Ihnen bei ihren anderen Aussagen durchaus Recht.
Das sagt er doch auch gar nicht. Aber kein Schüler braucht ein privates Endgerät um in der Schule Medienkompetenz zu erlangen. Handyverbot und Medienbildung gehen wunderbar Hand in Hand
Danke, ich leite den Artikel, vor allem den Link, an meine Schulleitung weiter.
Erwarte aber ehrlichgesagt nicht viel -__-
überhaupt nicht!!
Wir brauchen die 4 Tage Woche und online-Unterricht.
30 Leute in einem Raum gequetscht, frontal und womöglich noch im Virenwinter, klappt nicht. Außerdem sind wir heute digital vernetzt, von überall aus!!!
13 Monatsgehalt sollte auch mal langsam kommen.
Denken Sie nicht immer nur an sich!
By the way, um mal einen Bezug zum Thema herzustellen:
Im Online-Unterricht waren viele SuS gleich doppelt digital unterwegs.
Ein bisschen im Unterricht, oft mit “Kamera funktioniert nicht), größtenteils in einem parallel laufenden Chat, in dem sie sich prächtig amüsiert haben…
Oder beim Gamen
Wie heißt dieser Beruf dann? Lehrer*Inn ist ist es jedenfalls nicht.
Warum?
Man könnte Sie zu der Kochzeit von Kartoffeln befragen und Sie würden stereotyp die 4-Tage-Woche und Online-Unterricht als Antwort geben. Ich glaube, ich bin nicht die einzige, die von Ihren unpassenden Beiträgen genervt ist!
Ich habe inzwischen den Verdacht, dass @Petra OWL ein Troll ist.
Das Ziel ist Lehrkräfte zu diskreditieren. Da diese Posts überall auftauchen und für Aufruhr sorgen, bleiben die Forderungen hängen. Mitlesende Nichtlehrkräfte mit Vorurteilen fühlen sich in diesen bestätigt. Ziel erreicht.
Anders kann ich mir das nicht erklären, denn viele Forderungen kommen ja sogar bei Lehrkräften negativ an. Dass davon irgendwelche umgesetzt werden, ist ja ausgeschlossen.
Ja, weil sie lediglich an den HO-Tagen zuhause die Kartoffeln selbst zubereitet und an den anderen Tagen in der Kantine oder beim Imbiss um die Ecke.
Oder meinten Sie, wie lange “Biodeutsche” in der woche selbst kochen – die Kochzeit von “Kartoffeln” eben.
Er macht halt gerne unser Minister Clemens. Und im Machen vergisst er regelmäßig und grundsätzlich die Eigentlichen,die die Ideen des sächsischen Kultus in Realität machen müssen. Danach bedankt er sich aber für die erzwungene Bereitschaft der eigentlichen Macher und findet deren bereitwillige Unterstützung ganz wunderbar. Vas Lehrervertretungen und Demos vor dem Ministerium sagen-alles Wurscht.
Das Handyverbot ist mal wieder eine Nummer fürs Schaufenster. Schulen mussten seit x-Jahren ohne irgendeine Direktive von oben klarkommen. Jetzt wo alles geregelt ist,gibt es Macher-Lorbeeren abzupflücken. Dabei brennt es zur Zeit an allen Ecken und Enden. Liest man den hauseigenen Blog des Kultus: Alles Tutti. So geärgert wie in den letzten Tagen habe ich mich über die sächsischen Schulbehörden noch nie. Aber wie heißt es von dort so schön: Lehrer werden in Sachsen aus Überzeugung.
Die Schüler brauchen kein Facebook, sondern Facebook braucht die Schüler! 🙂
Ich bin 100% für ein Handyverbot als Lehrerin Gesamtschule und als Mutter