JENA. Der Jenaer Pädagogikprofessor Winkler versteht den Ärger um G8. Die Reform sei schlecht umgesetzt worden. Zudem gibt es für ihn kein einziges wissenschaftliches Argument, das für das schnellere Abitur spricht.
Das verkürzte Abitur nach acht Schuljahren ist nach Ansicht des Jenaer Pädagogikprofessors Michael Winkler überhastet eingeführt worden. «Schulpolitik ist ein großer Tanker, der lässt sich nicht ohne weiteres von heute auf morgen umsteuern», sagte Winkler. «Die Reform war nicht ordentlich vorbereitet und begleitet.» Der Widerstand von Schülern, Eltern und Lehrern sei deshalb verständlich – und er hätte von der Politik vorhergesehen werden können.
Seines Wissens gebe es keine wissenschaftliche Untersuchung, die den schnellen Weg zum Abitur pädagogisch begründe, sagte der Professor an der Friedrich-Schiller-Universität. «Das war eine rein fiskalpolitische Entscheidung – mehr nicht.» Die Bundesländer hätten schlicht Lehrkräfte einsparen wollen.
Im Gegenzug gebe es einige Argumente, die eine verkürzte Gymnasialzeit pädagogisch infrage stellten. «Die Vorverlegung der zweiten Fremdsprache von der siebten auf die sechste Klasse etwa ist eine entwicklungspädagogische Katastrophe», sagte der Professor. Die Schüler müssten sich in der sechsten Klasse erst noch an die erste Fremdsprache gewöhnen, da überfalle sie schon die zweite. «Damit sind viele überfordert.»
Überfrachtung der Lehrpläne
Das Hineinpressen des Stoffs in zwölf Schuljahre habe zudem zu einer Überfrachtung der Lehrpläne geführt. In vielen Fächern werde bereits abgespeckt. «In den Sprachen gibt es weniger Übungsteile, Sozialkunde und Geschichte wird eingedampft, und in Bayern wird sogar in der Biologie gekürzt.» Dies führe unter dem Strich zu einem Abitur minderer Güte.
Als Beleg führte Winkler die jährliche Aufnahmeprüfung für das Medizinstudium in Österreich an, wo die Schüler nach acht Jahren die sogenannte Matura ablegen. «Bei den Prüfungen schnitten die deutschen Teilnehmer bislang regelmäßig besser ab, sehr zum Ärger der österreichischen Bewerber, die den Studienplatz einem Deutschen überlassen mussten.» Das belege eindrucksvoll, dass die längere Abiturzeit zu besseren Ergebnissen führe.
Auch die gesellschaftspolitischen Folgen dürften nicht unterschätzt werden. «Mit der Einführung von G8 sind die Kinder mehr in der Schule gebunden und haben kaum noch Zeit für Vereine oder ehrenamtliches Engagement», sagte der Pädagoge. Auf der anderen Seite verließen viele Abiturienten die Schule sehr jung und wüssten oft noch nicht, was aus ihnen werden soll. Dies führe zu einer deutlichen Steigerung der Nachfrage beim sozialen Jahr und ähnlichen Angeboten. «Wenigstens in diesem Sinn hat die Reform ihr Gutes.»
Dass G8 in den neuen Bundesländern weitgehend reibungslos funktioniere, hat für Winkler historische Gründe. «In der DDR konnte man nach acht Jahren Abitur machen. Diese Struktur wurde in einigen der neuen Länder nach der Wiedervereinigung übernommen.» So gebe es im Vergleich zum Westen deutlich mehr Ganztagsschulen. dpa
(17.11.2012)
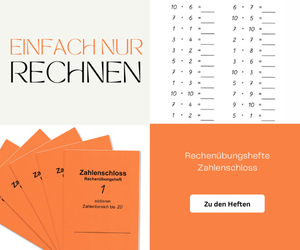
Wenn man die Gegenargumente von Herrn Winkler liest, muss man das 8-jährige Gymnasium wirklich für schlecht halten. Ich frage mich jedoch, wie das in der DDR so problemlos funktionieren konnte. Dass es im Osten mehr Ganztagsschulen gäbe, ist kein Argument. Die Ganztagsschulen gibt es jetzt, es gab sie früher nicht und es gibt immer noch mehr “Nicht-Ganztagsschulen” im Osten! Herr Winkler sollte noch einmal genauer schauen, warum in der DDR das Abitur nach 12 Jahren gut funktionierte (G 8 kann man ja gar nicht sagen, denn man wechselte erst nach der 8. Klasse, zuletzt sogar erst nach der 10. Klasse an die EOS, die dem Gymnasium entspricht).
Äpfel mit Birnen zu vergleichen wird der Diskussion nicht gerecht; d.h. ein DDR Schulsystem mit etwa dem in Bayern.
Allerdings, es gibt tatsächlich kein rationelles Argument im Sinne der Schüler und deren Entwicklung, welches das G8 rechtfertigen würde.
Es gibt allerdings eine Reihe von Argumenten, die schnelles Handeln im Sinne unserer Gesellschaft erfordern, wie etwa die fatalen Folgen des G8 für unsere Sozialsystem und damit auch die Wirtschaft.
Rechnet man die Entwicklung etwa durch Bewegungsmangel in Folge der massiv reduzierten Freizeit hoch auf die Entwicklung des Diabetes Typ II so resultiert ein Zusammenbrechen des Krankenwesens (wir haben kein Gesundheitswesen mehr.
Man mag also über die Inhalte der Lehrpläne trefflich streiten können, die Kursichtigkeit der politisch Verantwortlichen, was die gesunde psychische und physische Entwicklung des einzigen Potenzials das ein Land ohne Rohstoffe hat, d.h. kreativen Nachwuchses ist aber mehr als gefährdet.
Weitere Ausführungen finden sich unter change.org “G8 Abschaffen” im Rahmen einer Petition an den bayerischen Landtag und Ministerpräsidenten
Sehr geehrter Herr Wilckens,
herzlichen Glückwunsch zu Ihrer G9-Initiative!
Ich habe selbst vor kurzem eine Online-Petition für G9 in Baden-Württemberg gestartet:
https://www.openpetition.de/petition/online/wahlfreiheit-zwischen-g8-und-g9-in-bw-zulassen
Eine Bitte: Könnten Sie eventuell die Unterstützer Ihrer Petition über diese baden-württembergische Initiative informieren? Dann könnten diese sie bei Interesse auch unterstützen.
Viele Dank im Voraus und beste Grüße
Cord Santelmann
Zu sagen, man solle nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, ist ja ein beliebtes Gegenargument, wenn einen Vergleich “niederreden” will. Was sind denn die Äpfel und was sind die Birnen in diesem Falle? Also warum konnte in der DDR die Abiturreife nach 12 Schuljahren problemlos erreicht werden und warum geht das jetzt im Einheitsdeutschland nicht mehr? Das Abitur zu erwerben, heißt vor allem, Studierfähigkeit zu erwerben und die besteht eben nicht darin, von allem ein wenig und nichts richtig zu wissen. Sie besteht überhaupt nicht darin, Wissen anzusammeln, sondern zu lernen, wie man selbstständig Wissen erwirbt, und zwar das, das man in seinem künftigen Beruf braucht!!! In den Lehrplänen kann vieles entrumpelt werden, nur traut sich da leider keiner ran. Würde man das tun, gäbe es in 12 Schuljahren auch genug Zeit für den Erwerb der Studierfähigkeit und mehr Zeit für Freizeitaktivitäten. Aus diesem Grunde lehne ich z.B. auch das Ganztagsschulwesen ab, wo die Schüler von morgens bis spätnachmittags nur noch in der Schule sind.
Ergänzung: Wenn die zweite (obligatorische !) Fremdsprache für das Gymnasium abschafft, würde z.B. Zeit gewonnen für anderes. Wenn alle Englisch lernen müssen, reicht das heutzutage. Wer will, aber wirklich nur wer will, soll meinetwegen auch weitere Fremdsprachen lernen. Ich bin nur dagegen, dass das Pflicht ist.
@sofawolf: Was qualifiziert dich, zu beurteilen, wie wichtig eine 2. Fremdsprache ist?? Und warum funktioniert die Ganztagsschule in so vielen Ländern der Welt, nur in Deutschland will sie keiner??
In Frankreich und England z.B. funktioniert sie deshalb so gut, weil die Schüler ihre Aufgaben in der Schule unter Aufsicht und mit Hilfe erledigen können. Da ist es dann auch egal, ob die Eltern Latein oder Mathe können oder Analphabeten sind. Und anschließend haben die Schüler wirklich frei. Und sie haben dort auch vernünftige Sportangebote oder Musik-AGs etc. Da spielen viele Schüler ein Instrument und müssen nicht Extrastunden für Musikschule, Nachhilfeunterricht oder den Fußballverein bezahlen.
Was hier in D an vielen Schulen als Ganzstagsschule verkauft wird, ist doch ein Witz. In allen anderen Ländern ist sie eine Selbstverständlichkeit.
In Deutschland hat die Halbtagsschule eine zweifelhafte Tradition, die u.a. auf dem verfassungsrechtlich festgelegte Vorrang der Familie bei der Kindererziehung beruht. Mütter arbeiteten früher nicht sondern kochten zu Hause mittags die Suppe, oder die Kinder halfen auf dem Feld.
Ganztagsschulen sind Gemeinschaften mit vielen Angeboten, AGs, Hilfen, gemeinsamen Mahlzeiten und ja, auch Unterricht. In den USA, in Frankreich, Italien, England etc. käme kein Mensch auf die Idee, die Schule mittags enden zu lassen.
Und was die Fremdsprachen anbetrifft, kann man heutzutage im Zuge der Globalisierung nicht genug Fremdsprachen beherrschen. Oder lehnst du auch Unterricht in NT ab, weil man ja zu Hause am PC daddeln kann??
Wo und was unterrichtest du, dass du so ablehnend bist??
Was, in Frankreich funktioniert die Ganztagsschule gut???
@ teatoller
Warum soll ich dir Angaben zu meiner Identität machen und vor allem hier in aller Öffentlichkeit und zumal du dich selbst bedeckt hältst?!? Und sei mal ehrlich, würdest du dich meiner Meinung anschließen, nur weil ich Professor bin? Das tut doch alles nichts zur Sache. Es ging darum, dass das längere gemeinsame Lernen abgelehnt wurde mit der Begründung, dass die Kinder auch Freizeit brauchen. Wer das sagt, der hat meine volle Unterstützung. Deshalb bin ich in diesem Punkt ganz traditionell für die “Halbtagsschule”. Auch an ihr kann es nachmittags noch ein Angebot an Arbeitsgemeinschaften geben oder aber der Schüler nutzt das Angebot von nicht-schulischen Vereinen und Organisationen. Oder einfach sich nachmittags mit Freunden treffen. Was das Abschaffen einer zweiten Pflicht-Fremdsprache am Gymnasium anbetrifft, so war das eine Idee zur Entschlackung der vollgestopften Gymnasiallehrpläne und -anforderungen, um das Abitur (die Studierfähigkeit) auch in 12 Schuljahren erwerben zu können. Es war ja gesagt worden, das ginge aufgrund des hohen Lernpensums nicht. Was mich qualifiziert, das vorzuschlagen? Meine Meinung, dass man heutzutage nur Englisch braucht für die internationale Verständigung und dass es auch besser wäre, wenn alle die gleiche Fremdsprache lernen (auf der Welt) und nicht jeder überall eine andere. Wer sich für Sprachen interessiert, soll natürlich eine zweite oder dritte oder vierte lernen dürfen, aber eben nicht müssen! Und was qualifiziert dich denn nun, dafür zu plädieren, dass man am Gymnasium 2 Fremdsprachen lernen MUSS??? Kriege ich darauf auch eine Antwort?
Wenn du genau hinguckst, steht die Antwort schon am Ende meines Beitrags. Im Zuge der Globalisierung kann man gar nicht genug Fremdsprachen kennen, wobei auch die Vorherrschaft des Englischen mittelfristig eine starke Konkurrenz des Chinesischen bekommen wird. Ich selber spreche und unterrichte Fremdsprachen. Ansonsten wäre es sehr aufmerksam, wenn du endlich mal meinen Namen richtig schreiben könntest. Schon in früheren Kommentaren warst du nicht in der Lage, genau abzuschreiben. So viel Zeit sollte sein.
Wenn es Ihnen nur um die “internationale Verständigung” geht, genügt Englisch (Esperanto wäre aber besser, denn es lernt sich viel schneller). Aber Abitur sollte Bildung vermitteln. Da geht es darum, die Struktur von Sprache zu verstehen, so dass man einen Grundstock z.B. für weitere Sprachen hat, und dazu ist es gut, dass man (wenigstens) zwei fremde Sprachen nebeneinander stellen & vergleichen kann.
Ergänzung:
Insbesondere Schüler mit Lernschwierigkeiten sollten am Gymnasium neben Englisch keine weitere Fremdsprache lernen müssen. Der Zensurendurchschnitt könnte dafür ausschlaggebend sein. Und vielleicht auch erst ein paar Schuljahre später, nicht gleich nach dem Übertritt ans Gymnasium. Die Tochter eines Freundes quält sich gerade mit Französisch und ich frage mich wirklich, wozu sie eigentlich Französisch lernen MUSS (!). Es bringt ihr für nichts Vorteile! Da sollte sie sich doch lieber auf anderes konzentrieren.
Eine, wie ich zugebe, ketzerische Replik: Schüler mit Lernschwierigkeiten (die sich ja, wie die Erfahrung lehrt, nicht allein auf Fremdsprachen beschränken), haben auf dem Gymnasium nichts verloren.
unabhängig davon, dass sie auf einen 3,5 jahre alten kommentar reagiert haben, gebe ich ihnen recht …
SchülerInnen mit Lernschwierigkeiten haben mit Verlaub auf einem Gymnasium NICHTS zu suchen. Gerade das macht micht ja geradezu fassungslos, dass SchülerInnen bspw. mit Leseproblemen am Gymnasium angemeldet werden, und die Eltern dann auch noch wie selbstverständlich erwarten, dass den Sprösslingen mit Förderstunden – möglichst auch noch INDIVIDUELL – auf “die Sprünge” geholfen wird.
PS: Nach meiner Uhr ist es jetzt erst 23.30 h.
@ mehrnachdenken
Den Einwurf habe ich schon erwartet. Ich finde das auch richtig, nur es war nicht das, was ich meinte. So manche Schüler haben erst mal Schwierigkeiten, sich am Gymnasium einzuleben. Denen würde es helfen, wenn man sie von der 2. Fremdsprache (und jeder weiteren) befreite oder wenn diese einfach nicht (in Berlin) in der 7. Klasse begänne/begönne, sondern erst in der 9. Klasse oder so. Ansonsten bin ich auch der Meinung, dass man aufgrund des Zensurendurchschnitts entscheiden sollte, wer ans Gymnasium darf (vielleicht bis 2,0 ohne Weiteres und zwischen 2,0 und 2,5 nur mit “Positivprognose” durch die Lehrer). Es wären dann nach meiner Vorstellung wesentlich weniger Schüler als heutzutage, aber eben die leistungsstarken. Mittelfristig würde das die (in Berlin) Sekundarschulen auch aufwerten, weil dort eben nicht nur “der Rest” lernt. Ich meine, es sollte doch vom Beruf abhängen, den jemand anstrebt, ob er am Gymnasium weiterlernt oder nicht. Nicht zu studieren, ist keine Schande!!!!!!!
@ teatotaller
Das klingt wieder ein bisschen oberlehrerhaft, aber meinetwegen … Es sei dir gegönnt. Natürlich habe ich deine Bemerkung am Ende gelesen. Dass sie der Grund dafür ist, dass man mehr als eine Fremdsprache lernen soll, stand da nicht (so explizit). Die Globalisierung ist auch kein Argument dafür, so viele Fremdsprachen wie möglich zu lernen – im Gegenteil: Die Globalisierung ist ein Argument dafür, dass alle Menschen auf der Welt die EINE GLEICHE Fremdsprache lernen. Am liebsten natürlich Deutsch, aber die Realität ist eine andere. Dann ist es eben Englisch. Wichtig ist doch nur, dass wir uns alle miteinander verständigen können und das können wir nicht, wenn überall andere Fremdsprachen gelernt werden! So viele Fremdsprachen wie möglich zu lernen, ist da der absolut falsche Weg, weil total unrealistisch. Wer schafft das schon?!? Wie gesagt (bevor ich falsch gelesen werde), ich bin nicht gegens Fremdsprachenlernen, aber alles andere als Englisch sollte freiwillig sein und eher im Rahmen einer AG/IG. Das ist meine Meinung.
Na, das ist doch mal interessant für unsere Diskussion: G 8 verbessert die Leistungen Hamburger Schüler. Siehe: https://www.news4teachers.de/2012/11/vergleichsstudie-g8-verbessert-leistungen-bei-hamburger-schulern/
@ Sofawolf
Ist ja aufschlussreich! Studien, die Ihre Meinung bestätigen, halten Sie offensichtlich für seriös. Studien von sehr anerkannten Wissenschaftlern und Psychologen über die beste Betreuung von Babys und Kleinkindern passen Ihnen nicht in den Kram, und sie werden von Ihnen abgelehnt. So kann ich mir meine Welt auch schönreden!!
Bei mir ist es übrigens erst 17.50 h.
@ mehrnachdenken: Nein, das ist allein Ihre Interpretation. Ich habe diese Studie hier nur eingefügt, um mal zu hören, was die dazu sagen, die das Abitur nach 12 Schuljahren so vehement ablehnen und sich dabei auf (andere) Studien u/o. Wissenschaftler berufen. Also, was sagen Sie zu der obigen Studie und ihren Ergebnissen, dass die Leistungen der G-8-Schüler sogar besser sind?
@ sofawolf
Nein, das ist nicht meine Interpretation, so erlebe ich Sie in diesem Forum.
Abitur nach 12 Schuljahren?
Ich kann die ganze Aufregung überhaupt nicht verstehen. Ich “baute” mein Abi auf dem 2. Bildungsweg und erlangte so die allgemeine Hochschulreife. Die damalige gymnasiale Oberstufe dauerte zwei Jahre. Wir wurden lediglich in den Klassen 12/13 auf das Abi vorbereitet.
Weiter erinnere ich an die bereits mehrmals erwähnte Orientierungsstufe (5./6.Klasse. Dort kamen die SuS in die 7. Klasse eines Gymnasiums, und sie legten dann nach SIEBEN Jahren das Abitur ab. Niemand regte sich damals darüber auf. In den 5./6. Klassen orientierte sich der Lernststoff lediglich in zwei Hauptfächern (E/M) am Gymnasialniveau. In allen anderen Fächern gab es keine äußere Differenzierung. Allerdings erhielten tatsächlich fast ausschließlich potentielle GymnasialschülerInnen die Empfehlung für diese Schulform, und bis auf wenige Ausnahmen schafften sie dann auch das Abitur.
Bei mir ist es übrigens erst 10.12h.
@ mehrnachdenken
Doch, das ist Ihre Interpretation. *schmunzel* Ich habe nicht gesagt, dass die Studie, die dem G-8-Abiturienten bessere Leistungen zuspricht, nicht hinterfragt werden kann und nun das “einzig Wahre” verkündet. Ich habe sie nur als Gegenbeispiel hier reingestellt bzw. darauf verwiesen. Inwiefern Ihr persönlicher Lebensweg das Abitur nach 12 Jahren widerlegt, erkenne ich nicht. Mein Lebensweg ist durch ein Abitur nach 12 Schuljahren gekennzeichnet. Ich sage nicht, dass es nicht auch in 13 Jahren ginge, ich sage nur, es reichen auch 12. Das ist alles.
@sofawolf
Bestimmt haben Sie meinen Beitrag gelesen. Haben Sie ihn aber auch verstanden? Da habe ich gewisse Zweifel!
Ich bestätige Ihre Position und verdeutliche dies am Beispiel meiner eigenen Schulbiographie und am Beispiel der OS.
Auf meiner Uhr ist es gerade 20.51 h.
*lach* Sehen Sie, da haben wir uns wirklich missverstanden bzw. ich Sie. Ich schrieb also zurecht, dass ich nicht erkennen kann, wieso Ihre Stellungnahme einem 12-jährigen Abitur widerspricht. Sie widerspricht diesem ja auch nicht. (Wahrscheinlich war es schon Routine für mich, dass Sie mir widersprechen. Mein Fehler. Punkt für Sie! *schmunzel*)
@ sofawolf
Schön, dass wir das geklärt haben.
Übrigens müssen Lehrkräfte vor allem bei der Bewertung von SchülerInnen höllisch aufpassen, nicht diesem von Ihnen geschilderten Mechanismus zu unterliegen. Den passenden Terminus aus der Psychologie habe ich gerade nicht “auf dem Schirm”.
Ein Schüler schreibt in Aufsätzen immer Fünfen. Einmal gelingt ihm jedoch ein besonders guter Aufsatz. Der Lehrkraft fällt das aber zunächst gar nicht auf, weil die vorherigen schlechten Ergebnisse sie nur in eine Richtung denken lässt. Die “Routine” macht es der Lehrkraft schwer, die gute Leistung zu erkennen. Für den Schüler kann das zusätzlich bedeuten, dass die Lehrkraft nun mit Akribie geradezu nach Fehlern sucht, um ihre vorgefasste Meinung bestätigen zu können.
Sie meinen, ich würde Ihnen immer widersprechen (das stimmt übrigens so auch gar nicht!). Deshalb fällt Ihnen meine Zustimmung auf den ersten Blick gar nicht auf.
Schreibt nun ein guter Schüler einmal eine schlechte Arbeit, wird das von der Lehrkraft als “Ausrutscher” bagatellisiert und gar nicht weiter hinterfragt. Die positive Grundeinstellung des Lehrers kommt nun dem Schüler zugute. Fehler werden dann gerne einmal “übersehen”.