HANNOVER. Gerald Hüther, Professor für Neurobiologie an der Universität Göttingen, Mannheim/Heidelberg, erläuterte in einem Vortrag „Wie die Hirnforschung zur Verbesserung der Unterrichtspraxis beitragen kann“, welche Rahmenbedingungen für gutes Lernen nötig sind und was Schulen und Lehrer tun können, um Kinder beim Lernen zu unterstützen. So weit so gut. Allerdings würzte der Hirnforscher seine Ausführungen mit provokanten Thesen.
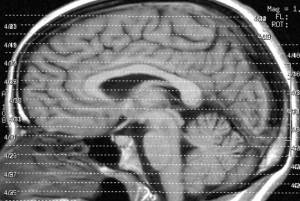
„Man kann Kinder nicht unterrichten“, sagte Hüther gleich zu Beginn seines Vortrags. Schließlich könne man keine Vernetzungen im Gehirn machen. Allerdings können Lehrer und Schulen – auch mithilfe der Erkenntnisse der Hirnforschung – einen Rahmen schaffen, damit Bildung gelingt, so der Fachmann. Entscheidend sei es, sich von den Vorstellungen der Leistungsgesellschaft, erfolgreich zu sein, zu verabschieden. Denn: Im Gegensatz zum Sport und einem Sieg beim Fußball könne Bildung nicht erfolgreich sein, sondern nur gelingen und dafür wiederum müsse man als Lehrer ein inneres Bild haben, wie dies aussehen könnte.
„Kinder sind keine Fässer, in die Wissen abgefüllt wird“, sagte der Hirnforscher. Die größte pädagogische Leistung der vergangenen 50 Jahre ist für Hüther die Tatsache, dass Schüler mit Downsyndrom ihr Abitur gemacht hätten und nun studieren würden. Damit dies möglich werde, müssten Pädagogen sich auf die Stärken der Kinder fokussieren und ihre Vorstellungen über Bord werfen. „Vorstellungen sind etwas ganz Elendes, denn sie hindern einen daran zu sehen, was es wirklich ist“, so der Wissenschaftler.
„Jedes Kind ist hochbegabt“, sagte Hüther. Es habe einen Überschuss an Nervenzellen, die es eigentlich nicht braucht und könne im Grunde alles lernen. Jedes Kind habe das Gehirn, das zu seinem Körper passe. Die Kinder seien schon zum Zeitpunkt der Geburt unterschiedlich, wobei das eine Gehirn nicht besser sei als das andere, betonte er. „Das Gehirn ist kein Muskel“, erklärte der Experte. Deshalb können Kinder laut Hüther nur das verankern, was für sie bedeutsam ist und ihnen „unter die Haut“ geht. Aber wie kann man für Schüler etwas bedeutsam machen, was sie gar nicht lernen wollen? Derzeit werde Lernstoff an vielen Schulen mit Bedeutung aufgeladen, indem Schülern mit Bestrafung gedroht wird oder sie mit Belohnung gelockt werden. Kinder würden dressiert, Belohnungen zu ergattern und Bestrafungen zu vermeiden. Aber selbst wenn Schüler einen 1,0-Abiturdurchschnitt bekämen und gute Noten ergatterten, fehle ihnen die Leidenschaft – und die ist nun mal entscheidend fürs Lernen.
Um Lernstoff für Schüler bedeutsam zu machen, ist laut dem Hirnforscher der Lehrer als Person zentral. Er müsse den Schülern Mut machen, sie motivieren, inspirieren und einladen können. Hüther forderte von den Pädagogen, die Kinder mit einem „offenen Blick“ anzuschauen, sich nicht zufriedenzugeben und die eigenen Vorstellungen über Bord zu werfen. Darüber hinaus müsse man als Lehrer selbst begeistert sein. Die gute Nachricht: Laut Hüther kann hirntechnisch jeder Mensch „wiedererweckt“ werden. Also gelte es, zunächst die Sehnsucht in sich selbst zu erwecken und sie dann weiterzugeben.
Abschließend warb der Hirnforscher dafür, die „peergroup-Effekte“ und Teamarbeit unter den Schülern zu nutzen, weil diese für die Mitschüler der „bedeutendste Lehrer“ seien. Das Teilen von Wissen und Erfahrungen, das Gefühl beteiligt zu sein und gebraucht zu werden, würde Kinder begeistern. Zentral sei es, keine gleichartigen Gruppen zu bilden. Hüther: „Je verschiedener die Schüler, desto stärker können sie zu einem Gelingen beitragen.“ Lobend hob er die Zusammenarbeit der Kinder und Jugendlichen in einem Theaterprojekt, Orchester oder das Singen im Chor hervor. Diese zeigten, dass Großes nur gelingt, wenn man es gemeinsam in einer Gruppe macht.
„Schulen sind keine Gewächshäuser“, sagte Hüther, mit EU-genormten Gurken und PISA-Gestesteten. Schulen müssen sich öffnen und den Kindern zeigen, wofür sie draußen – außerhalb der Schule – gebraucht werden. Dann könne Schule gelingen. FRAUKE KÖNIG
(23.2.2012)
Ich finde die Thesen wunderbar, aber den Satz, jedes Kind sei hochbegabt, unpassend und der Diskussion zum Thema “Hochbegabung” nicht förderlich. Denn durch solche Sätze geraten Eltern und Kinder, die diagnostiziert hochbegabt sind, und soziale Probleme, eine schwierige Schullaufbahn oder einfach sonderbare Interessen und auffällige Fähigkeiten zeigen, in den Verdacht, sich nur aufzuspielen mit einem Modebegriff. Es wäre für ein hochbegabtes Kind sicher nicht gut, wenn in der Schule seine Besonderheit vom Tisch gewischt würde mit dem Satz “Ach, hochbegabt ist doch eh jeder heutzutage!”. Dagegen an zu kämpfen, ist schwieriger für die Betroffenen, als mit der eigenen Hochbegabung umgehen zu lernen!
Leider, Herr Professor Hüther, ist das alles überhaupt nicht neu.
Hätte der Satz gelautet: “Jedes Kind ist begabt” hätte ich zugestimmt. Aber so muss ich mich meiner Vorschreiberin anschliessen – diese Zuordnung ist in der Tat Familien mit hochbegabten Kindern nicht dienlich.
Und solange hochbegabte Kinder diesen Stempel benötigen, damit etwas in ihrem Namen bewegt wird, solange wird man auch diesen Begriff benötigen. Mir wäre es sehr recht, wenn JEDES Kind nach seinen Fähigkeiten und Neigungen lernen könnte – dann bräuchten wir keine solchen Schubladen mehr.
Lernen erfolgt durch Belohnung oder Bestrafung, wobei Belohnung nachhaltiger wirkt und die Gefühlswelt der Kinder positiv beeinflußt. Die Bestrafung findet heute zum Glück nicht mehr in dem Maße statt.
Wie soll man die Gefühle auf einem anderen Weg positiv beinflussen? Wenn der Lehrer seine Begeisterung für eine Sache gut rüberbringen kann, ist sehr viel gewonnen, aber nicht jeder Lehrer ist ein guter Schauspieler, der die Gefühlswelt der Kinder in jeder Stunde ansprechen kann.
Kinder sind von Natur aus neugierig, können sich aber nicht immer für alles sofort begeistern, vor allem, wenn es schwer ist bis man zum Erfolg kommt.
Dies gilt besonders beim Lesen lernen. Erst müssen die Buchstaben gekannt werden, dann müssen sie zusammengeschliffen werden, aber gleichzeitig sprachliche Abweichungen wie “ch”, “sch” oder …s-ch… z.B. bei Mäuschen erkennen. Das geht nur mit Belohnung oder extra leichten Texten, siehe: http://www.selberlesen.wordpress.com
“Entscheidend sei es, sich von den Vorstellungen der Leistungsgesellschaft, erfolgreich zu sein, zu verabschieden.” – das ist Unsinn, denn die Schule lebt ja nicht im luftleeren Raum und es gibt tatsächlich Kinder, die gern Leistung zeigen und auch Stoff lernen, der im Moment des Lernens für sie keine spezifische Bedeutung hat. Prof. Hüther erweist den Hochbegabten Kindern und denen, die sich für sie einsetzten, einen Bärendienst, durch seine Aussage, jedes Kind sei hochbegabt. Es ist auch nicht jedes Kind ein Sportass oder ein begnadeter Künstler. Das muss auch nicht sein, es ist durchaus gut, dass wir Menschen vielfältige Wesen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Begabungen sind!
LEISTEN kommt (wie LEHREN & LERNEN) von germ. LAISTI = DIE FÄHRTE. In einer wirklichen LEISTUNGSgesellschaft, geht es darum, dass jeder SEINE LEBENSFÄHRTE VERFOLGT. Wir praktizieren aber genau das Gegenteil: Schon die Schule zwingt jeden von seiner originalen Lebensfährte herunter auf ihren künstlichen Trampelpfad hinauf. Du darfst KEINEN EIGENEN KOPF haben in dieser Lehrplanvollzugsanstalt, Du hast Dich einzufügen, zu unterwerfen und mitzumachen. DAS ist LEISTUNG?????
REIN IN DIE SCHABLONE!
REIN IN DIE SCHABLONE!
REIN IN DIE SCHABLONE!
Und wir tun keinem einen Gefallen, wenn wir diesen Troot, der Trottel macht, hinterfragen und allen sagen, sie seien hochbegabt? Als Ich-kann-Schule-Lehrer sage ich gewöhnlich lachend: “Gib´s zu, Du bist ein Genie!”
Ich grüße freundlich.
Franz Josef Neffe
Es ist schon merkwürdig, dass in allen vorangegangenen Kommentaren sofort Partei ergriffen wird für die “hochbegabten Kinder”. Die wohlmeinenden Kritiker Gerald Hüthers übersahen aber offensichtlich, dass mit dem oben veröffentlichten Aufsatz so gut wie alle Kinder zur Hochbegabung veranlagt sind, wenn sie nach den ihren Voraussetzungen entsprechenden Bedingungen lernen dürfen. Denn auch sogenannte Hochbegabte sind so gut wie immer Spezialbegabungen. Gerald Hüther hat nicht behauptet, dafür schon das alleinige Patentrezept gefunden zu haben. Einig dürften sich aber wohl alle darin sein, dass er einige gute Vorschläge zur notwendigen Richtung gemacht hat und überhaupt kein Ende der dazu erforderlichen pädagogischen Entwicklung abzusehen ist.
News 4teachers setzt sich zum Ziel, über alle relevanten Bildungsdebatten in Deutschland zu berichten. Die Plattform will also den Lehrerinnen und Lehrern einen aktuellen Überblick über wichtige Informationen bieten.
In diesem Zusammenahng möchte ich auf das neue Buch von Prof. Spitzer: “Digitale Demenz” hinweisen, das den angeblich so hohen Lehrnutzen der digitalen Medien kritisch hinterfragt. Auch wenn das Buch durchaus kontrovers dikutiert wird, ist es m.E. allemal lohnend, sich mit den Thesen des Psychiaters und Gehirnforschers zu beschäftigen.
Kann die Redaktion die Diskussion in diesem Forum mit einer kurzen inhaltlichen Wiedergabe anschieben, oder ist das wegen der “Dicke” des Buches schwierig bis unmöglich?
Liebe(r) pfiffikus,
wir sind bereits bei der Recherche des Themas.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Liebe Redaktion,
vielen Dank für die Rückmeldung. Da freue ich mich schon jetzt auf die Ergebnisse Ihrer Recherche.
Herzliche Grüße
pfiffikus
Jetzt muss ich mich aber mal wundern. Wenn @pfiffikus sich beschwert, bekommt er Antwort von der Redaktion, wenn andere was mitteilen oder fragen (öffentlich oder nicht öffentlich) bekommen sie keine Rückmeldung. Was lernen wir daraus? Wer am lautesten schreit, wird auch erhört. Oder: Wer trotz Kritik freundlich bleibt, wird übergangen; wer sich vehement beschwert, dem wird nachgelaufen. Oder wie mal vor Jahren jemand sein Buch zu Steuertricks nannte: Der Ehrliche ist der Dumme. So züchtet man sich selbst Beschwerden heran. Ok, kein Problem, ich finde es auch unmöglich und unfair, dass @pfiffikus Antworten bekommt und andere keine bekommen.
… und ich werde, wie @pfiffikus ja auch schon mal schrieb, auch nicht mehr kommentieren, weil es ja sowieso nichts bringt.
Lieber Sofawolf,
wenn ich mitbekomme, dass ich oder die Redaktion direkt angesprochen werden – dann versuche ich zu antworten. Egal, wer der Absender ist. Nicht immer allerdings (und das gilt genauso für die Kolleginnen in der Redaktion) können wir uns um jedes Anliegen kümmern. Das hat folgenden Hintergrund: Wir sind professionelle Journalisten, die von ihrer journalistischen Arbeit leben. Aber nicht von News4teachers. News4teachers ist ein Gratis-Angebot, das – irgendwann einmal – durch Werbung finanziert werden soll. Bislang allerdings geht es uns wie den meisten Online-Medien in Deutschland und andernorts: Wir schießen zu. Um uns das leisten zu können, müssen wir eben auch andere (bezahlte) Aufgaben übernehmen. Und die haben dann Vorrang. Ebenso die tägliche Berichterstattung auf News4teachers. Erst wenn das erledigt ist, können wir uns um einzelne Leser kümmern. Manchmal reicht dafür die Zeit nicht mehr. Und dafür bitte ich um Ihr Verständnis.
Lieber Sofawolf, es wäre wirklich schade, wenn Sie nicht mehr auf News4teachers kommentieren würden. Wir freuen uns über jeden Ihrer interessanten und geistreichen Beiträge. Vielleicht überlegen Sie es sich doch nochmal – Sie unterstützen uns und unsere Arbeit damit sehr.
Herzliche Grüße
Andrej Priboschek
Herausgeber
Zitat sofawolf: “ich finde es auch unmöglich und unfair, dass @pfiffikus Antworten bekommt und andere keine bekommen.”
Oooch, du Armer, hat man dir jetzt dein Spielzeug kaputt gemacht?? Soll das eine souveräne Reaktion eines gestandenen Lehrers sein?? Wie oberpeinlich… Aber schade wäre es schon, wenn es nun keine Kommentare von dir mehr gäbe, war immer sehr amüsant zu lesen 😉
@ teatotaller
Vielen Dank für Ihre Worte. An sich brauche ich ihnen nichts hinzuzufügen.
@ sofawolf
Befinden wir uns jetzt im Kindergarten oder einer Grundschule? “Herr Lehrer, jetzt melde ich mich schon das fünfte Mal, aber Sie nehmen mich einfach nicht dran. Pfiffikus braucht aber nur einmal seine Hand zu heben, schon darf er etwas sagen.” Auch in der Sache liegen Sie ziemlich daneben. Es ist durchaus nicht so, dass mir die Redaktion immer antortet. Zudem warte ich bis heute auf eine Antwort des Herausgebers, den ich sogar direkt anschrieb.
@ teatoller
Manche sind immer so richtig mutig – hinter ihren Pseudonymen. 😉
Liebe Redaktion, ich habe selbstverständlich nicht vor, auf das Kommentieren zu verzichten, wenn ich etwas kommentieren will. Ich habe an dieser Stelle nur @pfiffikus nachgemacht, der ja auch schon mal “erbost” verkündete (oder war es sogar 2x), nicht mehr zu kommentieren, weil es ja nichts bringt bzw. weil er keine Antwort bekam. Und ich sehe – ein Selbstversuch sozusagen -, wenn man nicht mehr geduldig und freundschlich “erscheint”, bekommt man tatsächlich (eher) eine Antwort. Wie gesagt, auf diese Weise züchten Sie sich selbst diese “Beschwerden” und diese “eingeschnappten Reaktionen” (wenn die anderen einem kein Recht geben) heran.
w.z.b.w.
… achso, ja, und danke für die “Schmeicheleien”. Ich kann das einordnen. Es erinnert mich an die Stellungnahmen eines Ex-Chefs bei Beschwerden von Kunden. 🙂 🙂 🙂
Herr Hüther wiederholte die Aussage im ZDF (Precht/2.9.),dass Kinder mit Trisomie 21 (in Deutschland?) Abitur gemacht hätten, suggeriert damit eine Leistungsfähigkeit die bislang wohl bei 99% dieser Kinder nicht festzustellen war.
In der populistischen “Inklusions-“debatte werden nun gerade die bisherigen (schulischen)Fördersysteme denunziert , als ob gerade dieses wettbewerbsorientierte Regelschulsystem dazu eine gute Alternative sei..,daneben wird der medizinisch-therapeutische Sektor aufgerüstet und in Anspruch genommen ,vermutlich weil er immer noch Heilserwartungen bedient. (Ganz zu Schweigen von Delfintherapie und anderen esoterisch anmutenden Angeboten.)
Kinder mit DownSydrom können/ könnten(?) also Abitur machen, eine Zielvorgabe für Eltern und Lehrer …??
Sind die grundsätzlichen Erkenntnisse von Hüther pädagogisch “neu” ?
Vielleicht hat das “System Schule” (vgl. historisch )wenig mit “Pädagogik” sondern mehr mit der Produktion von Arbeitskräften zu tun ???
mit freundlichen grüßen
Frage an die Redaktion: Warum kann man diesen Artikel mit der Diskussion nicht als Link in eine Diskussion bei 4teachers setzen? Weil er schon im Archiv verschwunden ist? Es erscheint immer nur: Page not found. Danke.
Liebe/r klexel,
könnte es sein, dass Sie auf eine alte Version des Beitrags verlinken? Der vorliegende Text ist jedenfalls gut zu erreichen.
Herzliche Grüße
Die Redaktion