BERLIN. Die Rechtschreibreform sei „ein Flop“, meint der Germanist Uwe Grund. Er hat Schriftstücke von Schülern der Unterstufe (5. bis 7. Klasse) seit den 1970er-Jahren untersucht – und kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Reform äußerst negativ auf die orthografischen Leistungen ausgewirkt hat. Philologenverbands-Chef Meidinger widerspricht: Nicht die Rechtschreibreform sei die Ursache, sondern eine Bildungspolitik, die Orthografie seit 20 Jahren vernachlässige. Dass heutige Schüler tatsächlich beim Schreiben kaum mit den vorherigen Generationen mithalten können, bezweifelt er allerdings nicht. Doch: Ist das wirklich so? Bildungsforscher legen eine differenziertere Sicht nahe.
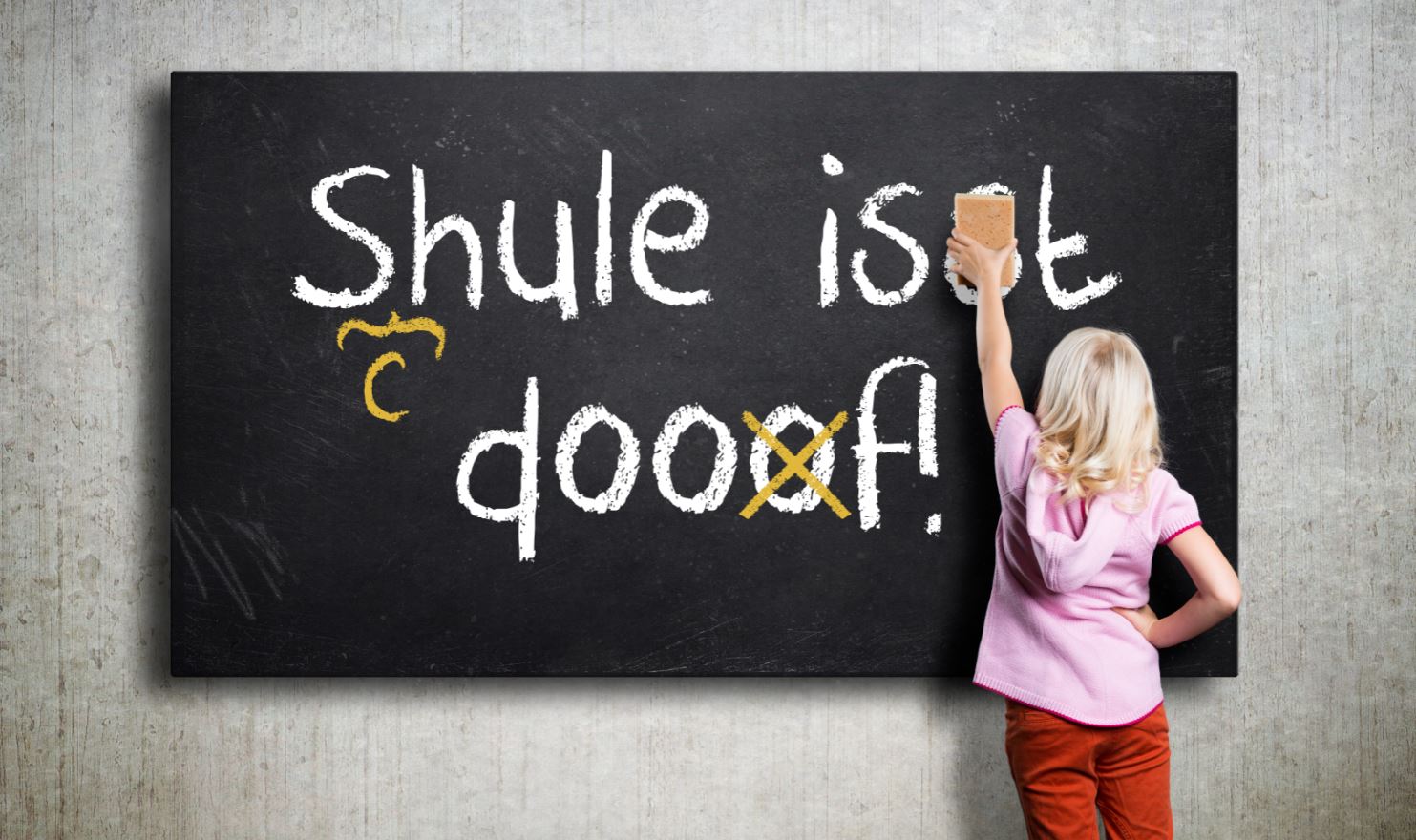
Schon 2008 hatte der heute emeritierte Professor Grund (Saarbrücken, heute Hannover) in einer umfangreichen Studie aufgezeigt, dass sich die Fehlerquote in Schülerdiktaten und -aufsätzen gegenüber der Zeit vor der Reform erhöht habe. Jetzt hat er nochmal die Datenbasis seiner Untersuchung erweitert – und kommt zum gleichen Ergebnis: Die durchschnittliche Fehlerzahl in Vergleichsdiktaten ist ihm zufolge von vier Fehlern in den 1970er-Jahren auf sieben Fehler in den 2000er-Jahren gestiegen. Grund meint laut Medienberichten, dass heute bei rund der Hälfte aller Schüler der 9. Klasse von „nicht ausreichenden“ Rechtschreibkenntnissen die Rede sein müsse. Die Rechtschreibreform, so Grund, treibe die Fehlerzahl nach oben.
Meidinger hingegen wirft der Bildungspolitik vor, den Rechtschreibunterricht in den Lehrplänen seit den 90er-Jahren systematisch zu vernachlässigen. Weil Rechtschreibung als Bildungsbarriere gelte, führe sie in manchen Bundesländern insbesondere in der Mittelstufe ein Randdasein. „Ich halte es für einen schweren Fehler, dass es Bundesländer gibt, in denen zumindest in bestimmten Jahrgangsstufen keine benoteten Rechtschreibdiktate mehr geschrieben werden dürfen“, kritisierte Meidinger.
Wichtiger: Lesekompetenz
Werden heutzutage tatsächlich zu wenige Diktate geschrieben? Nein, antwortet Nanna Fuhrhop, Sprachwissenschaftlerin am Institut für Germanistik der Uni Oldenburg, gegenüber dem „Tagesspiegel“. In der Deutschdidaktik habe sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es „pädagogisch nicht sinnvoll ist, Texte schreiben zu lassen, nur um den Schülern Fehler nachzuweisen“. Wichtiger sei die Lesekompetenz und das Textverständnis, das vor allem durch Schriftstücke gefördert werde, die Schüler selber verfassen. Diktate würden ihnen dagegen inhaltlich nichts vermitteln, betont die Professorin.
Ganz ausschließen, dass die Rechtschreibreform doch einen Einfluss auf den Unterricht hat, mag Furhop gleichwohl nicht: Sie beobachtet eine Verunsicherung bei vielen Lehrkräften. „Weil man sich selbst nicht mehr so sicher ist, wird eine korrekte Rechtschreibung von den Schüler nicht mehr unbedingt verlangt“, meint sie.
Auch was die Rechtschreibfähigkeiten von Schülern angeht, werden Zweifel an der Grund’schen These laut, dass heute bei der Hälfte der Neuntklässler von „nicht ausreichenden“ Leistungen gesprochen werden müsse. Petra Stanat, Direktorin des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB), verweist laut „Tagesspiegel“-Bericht auf einen Ländervergleich von 2009, bei dem auch die Orthografie-Kenntnisse von Neuntklässlern überprüft wurden, die den Mittleren Schulabschluss anstreben. Dabei seien zwar große Unterschiede zwischen den Bundesländern festgestellt worden, doch: Der Anteil derjenigen, die nicht einmal die Mindeststandards erfüllten, war überall vergleichsweise gering. In Berlin beispielsweise lag die Quote bei gerade mal 4,4 Prozent. „Das ist nicht so schlecht“, meint Professorin Stanat. Selbst bei Grundschülern ergab sich 2011 eine bundesweite Quote von 12,6 Prozent – ein Wert, fernab von „der Hälfte“, die Grund ausgemacht haben will.
Kein Selbstzweck
Auch der Bildungsforscher, Grundschulpädagoge und Schriftsprachdidaktiker Prof. Hans Brügelmann mag keinen Leistungsverfall beim Schreiben erkennen: Im Gegenteil, einige Untersuchungen für die Grundschule ließen zumindest für die letzten zehn Jahre „eher eine Leistungszunahme“ erkennen. Zudem müsse man sich vor Augen halten, dass Rechtschreibung eine „dienende Funktion“ im Rahmen einer umfassenden Schriftsprachkompetenz habe. Das Ziel, möglichst korrekt zu schreiben, dürfe andere Formen der Schriftsprache – wie das Lesen und Verfassen von Texten – nicht dominieren.
Im Klartext: Orthografie ist kein Selbstzweck. Brügelmann laut „Tagesspiegel“: „Wem nutzt es, Belanglosigkeiten oder inhaltlichen Unsinn orthografisch korrekt schreiben zu können?“ News4teachers
Die Ministerin hat bestimmt einen Grund, weshalb sie nur die unterste Kompetenzstufe erwähnt, weil streng genommen geschaut werden muss, wer Kompetenzstufen III übersteigt und wer nicht. Noch betrüblicher werden die Ergebnisse, wenn man die deutlich härteren Standards von vor dem PISA-Schock anlegt. Kompetenzorientierung ist halt eine Niveliierung aus niedrigem Niveau.
Naja, ich weiß nicht recht, Fahrrad fahren lernt man, indem man Fahrrad fährt; Schwimmen lernt man, indem man schwimmt; Schuhe zubinden lernt man, indem man Schuhe zubindet (und einem jemand sagt, wie es geht). Lernt man nicht auch korrektes Schreiben, indem man korrekt schreibt (und einem jemand sagt, wie es korrekt ist/wäre)?
Hoffentlich setzt sich in der Deutschdidaktik bald wieder die Erkenntnis durch, dass Diktate den Schülern nicht nichts bringen, sondern ihnen helfen, korrekte Schreibweisen zu lernen,
a) weil sich in ihnen viele Wörter des Grundwortschatzes wiederholen und dadurch jedes Mal wieder geübt werden,
b) einzelne Regeln gezielt bewusst gemacht werden und dadurch ein Verständnis wachsen kann, das man auf nicht-geübte Wörter übertragen kann und
c) weil es nicht darum geht, dem Schüler nachzuweisen, was er nicht schreiben kann (So ein Quatsch!), sondern ihm zu helfen, richtig zu schreiben (Schreiben durch Schreiben).
Außerdem kann man mit Diktaten ja auch noch andere Dinge machen – davor, danach und mittendrin als nur sie zu schreiben (ausgehend vom inhaltlichen Thema) !!!
PS: Womöglich muss ich hinzufügen, dass ich von geübten Diktaten ausgehe und nicht von ungeübten.
wenn sie auch noch meinen, rechnen lerne man durch rechnen (nachdem es jemand erklärt hat), fallen viele bildungsexperten in Ohnmacht. mit Spaß hat das alles nichts mehr zu tun, eher mit Arbeit, Ehrgeiz und Selbstdisziplin. nebenbei auch noch mit Erziehung seutens der Eltern (also das Kind, nicht den Lehrer über einen Anwalt).
“Übung macht dem Meister”, kann ich dazu nur sagen. Das weiß die Menschheit seit ihrem Bestehen. Die Vernunft und der gesunde Menschenverstand sagen das auch noch heute.
Vor allem im Bildungsbereich machen immer wieder Studienergebnisse und Expertenmeinungen Schlagzeilen, die gegen jede Vernunft und Lebenserfahrung geglaubt werden sollen.
Als Agnostikerin fühle ich mich heute frei von religiösen Glaubenszwängen. Dafür soll ich an anderer Stelle fragwürdige Lehrsätze glauben, die zwar nicht mehr aus himmlischem, sondern irdischem Mund kommen.
Wenn es “Experte” oder “Wissenschaftler” heißt, stehe ich vor ähnlichen Wahrheitsansprüchen wie die Leute vor Jahrhunderten in der Kirche.
Für mich sind die Schüler heute eindeutig schlechter im Lesen und Schreiben als früher. Meiner festen Meinung nach liegt das zum großen Teil an der Bildungspolitik mit ihrer Geringschätzung des Lernens durch Übung.
“Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen”, heißt es absolut richtig und keineswegs altmodisch, sondern “nur” zeitlos und wahr.
Ich stimme sofawolf, xxx und Sabine zu. Die Rechtschreibung kann man nur durch Üben, das einen höheren Stellenwert als heute hat, erlernen. (Es gibt natürlich auch Ausnahmen.)
Das sind meine Erfahrungen in der Grundschule By:
Heute haben wir den umgekehrten Fall wie vor längerer Zeit. Früher schlug das Pendel in die Richtung aus, dass man durch das bildhafte Merken von Wortbildern am weitesten kommt. Da wurden Lernwörter noch und nöcher mit “Kästchen” geübt mit geringen Anteilen an Regelbewusstsein. Schüler lernten Texte auswendig mit dem Nachteil, dass sie z.B. Wörter, die im Übungsdiktat am Satzanfang groß geschrieben wurden, immer groß schrieben. Die Kritik daran ist und war, dass Wörter mehr oder weniger “sinnfrei” auswendig gelernt wurden. Das falsche Textbewusstsein ist noch in de Köpfen vieler Eltern vorhanden, denn sie diktieren immer wieder den ganzen Text, statt auf einzelne Fehler einzugehen.
Jetzt haben wir die Gegenbewegung, nämlich den fast ausschließlichen Zugang zur Rechtschriftlichkeit über das Regelbewusstsein; auch die Übungen sind so aufgebaut. Einerseits finde ich den Zugang richtig, andererseits gibt man sich bei den Automatisierungsübungen zu früh zufrieden, d.h. Übungsdiktate bzw. längere Anwendungstexte fehlen zumeist und man übertreibt oft mit den Übungen zur Regelhaftigkeit.
In der Grundschule hat man vor über ca. 15 Jahren erst die Rechtschreibung einigermaßen geübt und dann Geschichten ab dem 3. Schuljahr geschrieben. Jetzt werden schon früh ab der ersten Klasse freie Texte geschrieben. Allerdings können die Schüler rechtschriftlich noch gar nicht so weit sein, was sie textlich schreiben.
Die meisten Lehrer korrigieren zwar die Rechtschreibung, aber nicht jeden Text schreiben die Schüler zweimal, bis er richtig da steht, man will ja nicht die Freude am Schreiben nehmen, was die Schüler wirklich haben, außerdem fehlt – vermute ich einmal – die Zeit dazu. Das geht leider auf Kosten des Rechtschreibbewusstseins.
Meine Erfahrungen: Im 3. Schuljahr ist in den letzten Jahren in den Klassen, die ich übernommen habe, die Rechtschreibung so katastrophal gewesen, dass ich erst einmal viele Rechtschreibübungen gemacht habe, bevor ich längere Geschichten schreiben ließ. Und das lag nicht an den einzelnen KollegInnen oder Klassenzusammensetzungen. Egal, von wem ich die Klassen übernahm, es zog sich durch. Da Korrigieren dieser Geschichten war nämlich zuerst von der Rechtschreibung her uferlos. Es dauerte lange, bis einfache Wörter so automatisiert waren, dass sie sie in Geschichten auch richtig schrieben.
Man sollte sich in der Deutschdidaktik einmal überlegen, ob der Ansatz im 1./2. Schuljahr in Bezug auf Rechtschreibung und freies Schreiben verändert werden muss, denn bisher setzte sich in den Köpfen hier schon ein untergeordneter Stellenwert der Rechtschreibung fest und das rechtschriftliche Denken wird auf den falschen Weg gebracht.
Nicht mehr zurück möchte ich zum sturen Pauken der Lernwörter. Vielleicht sollte man die Erkenntnisse im Regelbewusstsein und das Üben des Wortschatzes besser zusammenbringen.
Dann sollte man sich Gedanken machen, wie man in den ersten beiden Schuljahren das kreative Schreiben und die Rechtschreibung besser zusammenbringt.
Nachtrag:
“Diktate würden ihnen dagegen inhaltlich nichts vermitteln, betont die Professorin.”
Dann sollte man sich in der Deutschdidaktik einmal Gedanken machen, wie man Rechtschreibung so vermitteln kann, dass sie zwei Kriterien erfüllt: effektiv und nachhaltig (erstes und wichtigstes Kriterium) und sprachlich weiterführend. Mir ist in dieser Beziehung bisher nur eines begegnet: Die Rechtschreibgeschichten (die Schüler erfinden zu Wörtern eines Rechtschreibphänomens kurze, lustige Geschichten), aber das ist ziemlich wenig für dieses Gebiet.
Warum kommen als Experten immer nur Theoretiker mit mindestens Dr.-Titeln, am besten aber noch Prof.-Titeln, zu Wort und beeinflussen somit das Bildungsgeschehen?
Stinknormale Lehrer mit Praxiserfahrung (aber möglichst ohne Karriere-Ambitionen) sind für mich viel kompetenter.
Genauso gut, Sabine, können Sie fragen: Warum sind es immer Ingenieure, die Autos konstruieren – für mich sind Busfahrer viel kompetenter. Es sind schlicht unterschiedliche Berufe, Lehrer oder Bildungsforscher zu sein (und die Ausweise wissenschaftlicher Tätigkeit sind nun mal die Promotion bzw. Habilitation – deshalb Doktoren und Professoren -, beim Lehrer ist die Qualifikation eben das Staatsexamen). Wer ein guter Lehrer ist, weiß deshalb noch lange nicht, wie sich das Schulsystem entwickelt. Aber natürlich kann auch ein Lehrer wissenschaftlich argumentieren – wenn er sich mit dem Stand der Forschung auseinandersetzt. Praxiserfahrungen können das nicht ersetzen.
Aber Ingenieure machen Crash-Tests bevor das Auto auf die Bevölkerung zugelassen wird, Didaktiker meist nicht.
Aber gegen die Praxis geht es halt nun mal nicht. Was nützt einem das genialst konstruierte Auto, wenn es im Anschluss nicht fährt, also dem Praxistest nicht standhält.
Das ist doch selbstverständlich. Aber wenn ein Autofahrer – um im Bild zu bleiben – den Wagen dann gegen eine Wand setzt, muss das Auto nicht schuld sein, oder?
Es ist leider nicht selbsverständlich. Wie sagte mal ein Didaktiker, der wegen Lehrermangel an einer Schule aushalf: “Dass der Unterschied zwischen Theorie und Praxis so groß ist, hätte er nie gedacht.”
Es kann nicht sein, dass es Didaktik-Lehrstühle gibt, denen nicht eine Schule angeschlossen ist, wo das Zeugs ausprobiert wird – und nicht nur für einen Durchgang sondern mehrere Durchgänge.
Um im Bild zu bleiben: Didaktik-Lehrstühle sind heutzutage wie Entwicklungslabore (für Autos) ohne Teststrecke.
Wenn deren Konzept dann nicht funktioniert war eben der Lehrer schuld, der es schlecht umgesetzt hat. Statt diesen gleich auch noch mitzugeben, wie es umzusetzen ist – aber das ist wohl zu viel verlangt.
Das ist jetzt so pauschal, dass die Diskussion langsam unsinnig wird – klar, alle Professoren sind doof und praxisfern, und alle Lehrer sind faul.
Nur mal so nebenbei: Alle Didaktiker, die ich kenne (und das sind schon ein paar), haben als Lehrer und/oder Schulleiter gearbeitet – kennen die Praxis also schon ganz gut. Darüber hinaus erfolgen die Evaluationen von didaktischem Material natürlich immer im Praxistest, alles andere wäre schlichter Unfug.
Wo findet man dann dieses Material? Ich finde Unterrichtsmaterial und Praxistaugliches fast ausschließlich auf den Homepages schweizer Unis.
In Buchläden. Und/oder auf den Homepages der Universitäten, etwa hier:
https://www.uni-kassel.de/fb10/institute/physik/forschungsgruppen/didaktik-der-physik/materialboerse/physikalische-experimente-fuer-den-sachunterricht/vorbemerkungen.html
Oder hier:
http://www.ipn.uni-kiel.de/de/das-ipn/abteilungen/didaktik-der-biologie/materialien-1
Kommt eben drauf an, was Sie interessiert.
“Alle Didaktiker, die ich kenne …, haben als Lehrer und/oder Schulleiter gearbeitet ” – als Gegenbeispiel möchte ich Herrn Klippert nennen, zwar kein Didaktik-Professor, aber mit unglaublicher Breitenwirkung auf die Schule, der nur ganz ganz wenige Jahre Unterricht vorweisen kann.
Vielen Dank für die Links. Hab es mir angesehen – überzeugt hat es mich nicht.
Zumindest das, was für Physik angeboten wird.
Nochmal eine Ergänzung aus meiner Erfahrung:
Schüler tun sich viel schwerer, ein Wort richtig zu schreiben, wenn sie es vorher schon x- mal falsch geschrieben haben. Sie haben entweder den Blick für die Richtigschreibung dieses Wortes verloren, weil sie es in unterschiedlichen Varianten geschrieben haben oder sie haben es – das ist etwas seltener – es sich falsch eingeprägt. Das Umlernen/ richtige Schreiben lernen verbraucht viel mehr Zeit, weil das Wort praktisch “vorbelastet” ist. Das wäre einmal ein Projekt für die Gehirnforschung.
Die Gehirnforschung weiß es schon längst. Umlernen ist schwerer als Neulernen.
Wo kann man das nachlesen mit Forschungsberichten?
Lesekompetenz
Gut ist, dass man inzwischen eingesehen hat, dass die Lesekompetenz wichtig ist. Das war ja ganz lang out. Bis vor kurzem ging es nur um inhaltliche Dinge. Inzwischen beschäftigt man sich in der Deutschdidaktik mit Methoden um die Lesetechnik (z.B. Lautlesetandems) zu verbessern. Und da geht es um das reine Üben.
xxx, 31. August 2016 um 06:29
Das war Satire?
Einerseits die Formulierung ja, andererseits die Tatsachen (Üben unerwünscht, Erziehung durch Lehrer statt durch Eltern usw) leider nein.
Insgesamt also eher ja …
@ Bernd und Sabine,
ich denke, das ist schon so. Gewissen “Bildungsexperten” haben kaum oder keine Praxiserfahrung. Sie haben selbst nicht ausprobieren müssen, was sie sich da so schön ausgedacht haben. Auch mit Lehrbüchern ist es leider so. Viele Lehrbuchautoren haben nie als Lehrer gearbeitet und so sind die Aufgaben dann auch. 🙁