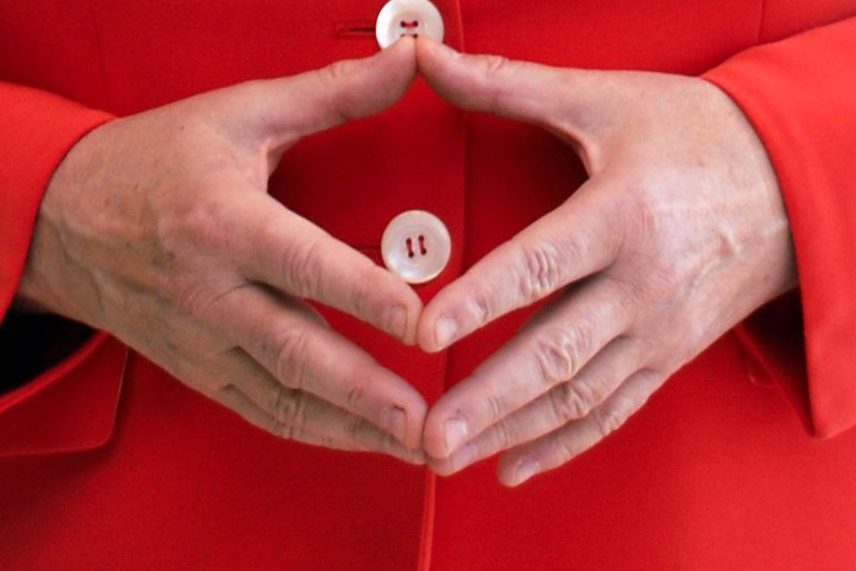
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), so scheint es, hält nach wie vor eine Einigung in Sachen Digitalpakt für möglich. Der Widerstand der meisten Bundesländer gegen die Grundgesetzänderung für das Zustandekommen des Digitalpakts Schule ist nach ihrer Einschätzung auf die Kostenaufteilung zurückzuführen, die durch die vom Bundestag beschlossene Grundgesetzänderung auf die Länder zukommen würde – also keine prinzipielle Frage. „Beim Digitalpakt soll die Kostenaufteilung 90 zu 10 sein – 90 der Bund, 10 die Länder. Soweit so gut“, sagte Merkel am Dienstag beim Digitalgipfel der Bundesregierung in Nürnberg. Aber bei weiteren Investitionen im Bildungsbereich ab 2020 ist dann eine Kostenaufteilung von 50 zu 50 vorgesehen. „Und das gefällt den Ländern nicht so richtig. Da liegt der Hase im Pfeffer, glaube ich.“
Merkel betonte, der Bund wolle nicht nur die Schulen mit Computern ausstatten, sondern etwa auch eine gemeinsame Lehr-Cloud anbieten, aus der sich jedes Bundesland und jede Schule das herausnehmen könne, was sie wolle. Derzeit lässt das Bundesbildungsministerium ein entsprechendes Angebot entwickeln. „Das sind alles, glaube ich, sehr willkommene Dinge“, so Merkel.
Zuvor hatte VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann seinen Ärger darüber zum Ausdruck gebracht, dass sich Merkel bislang mit Äußerungen zum Digitalpakt weitgehend zurückgehalten und ihrer Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) bei den Verhandlungen das Feld allein überlassen hat. „Wir haben kein Verständnis dafür, dass die Kanzlerin auf dem Digitalgipfel visionäre Reden hält, aber sich in die unsäglichen Debatte der Gegner der Abschaffung des Kooperationsverbotes als Voraussetzung für die Umsetzung des Digitalpakts nicht einschaltet. Es muss Schluss damit sein, Wein zu predigen, aber hinzunehmen, dass die Ministerpräsidenten nur Wasser ausschenken wollen“, schimpfte er.
Beckmann forderte: „Digitalisierung an Schule muss zur Chefsache werden! Eine Einigung muss schnellstmöglich gefunden werden. Dafür ist es notwendig, die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten an einen Tisch zu holen und zum Wohle der Kinder diese wichtige Entwicklung voranzutreiben.“ Und weiter: „Wir dürfen nicht weiter zusehen, wie ganze Schülergenerationen abgehängt werden. Großen Reden muss deshalb entschlossenes Handeln der Kanzlerin folgen!“
“Trauerspiel ohne Ende”
Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, bezeichnete das Ringen um den Digitalpakt gegenüber der „Rheinischen Post“ als „ein Trauerspiel ohne Ende“. Die Ministerpräsidenten, die sich gegen die vom Bundestag verabschiedete Grundgesetzänderung wehren, nahm er in Schutz. „Man kann den Schwarzen Peter nicht einseitig den Ländern zuschieben”, sagte Meidinger. Er verwies auf die kurzfristigen umfänglichen Erweiterungen der ursprünglich geplanten Grundgesetzänderung und an die schlechte Kommunikation darüber mit den Ländern. „Ich bin auch enttäuscht von der Bundesbildungsministerin. Das hätte so nicht passieren dürfen”, sagte Meidinger mit Blick auf Karliczek. Er betonte, das Beste sei, wenn nun der Vermittlungsausschuss zwischen Bund und Ländern angerufen werde. Meidinger betonte: „Wir brauchen den Digitalpakt Schule dringend.“
Susanne Lin-Klitzing, Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbands, warb unterdessen für einen anderen Weg zum Digitalpakt – ohne Grundgesetzänderung. „Eine Einigung zwischen Bund und Ländern für den Digitalpakt jenseits der umstrittenen Grundgesetzänderung ist möglich, wenn bei allen Beteiligten der politische Wille dazu vorhanden ist. Dies geht auf der Basis der bestehenden verfassungsrechtlichen Lage bereits jetzt und ist nötig!“, meinte sie. Die rund 40.000 Schulen in Deutschland bräuchten den Schub nach vorne und endlich Planungssicherheit für eine zeitgemäße digitale Ausstattung mit Breitbandversorgung. Darüber hinaus benötige jede Schule zusätzlich zu einer Anschubfinanzierung im fünfstelligen Bereich allerdings auch eine IT-Fachkraft, die von der zuständigen Kommune dauerhaft gestellt werde. „Denn die neue digitale Infrastruktur muss professionell instand gesetzt und gehalten werden“, so erklärte Lin-Klitzing. Eine Einigung „ist kein Hexenwerk und kann mit soliderer Planung als bisher gelingen.“
Berlin lehnt Investitionen in den Bildungsbereich aus Bundesmitteln ohne Grundgesetzänderung ab, weil sonst keine Zweckbindung möglich wäre. Die Länder wären dann nicht verpflichtet, die für die Digitalisierung der Schulen vorgesehenen Mittel auch tatsächlich dafür auszugeben. Dafür gibt es einen Präzedenzfall: 2014 übernahm der Bund für die Länder Bafög-Kosten in Höhe von 1,1 Milliarden Euro. Diese sollten im Gegenzug mehr in ihre maroden Hochschulen stecken. Tatsächlich kam das Geld in einigen Bundesländern, wie die „Welt“ berichtet, nie dort an. Agentur für Bildungsjournalismus
Susanne Lin-Klitzing, Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbands, hat einen politischen Forderungskatalog aufgestellt. Sie verlangt:
- “Keine digitale Infrastruktur an Schulen ohne professionelle Wartung!
- Keine hausgemachte Lösung ohne eine Standardisierung der Hardware in Schulen über die Ländergrenzen hinweg!
- Keine Schule ohne ein didaktisches Konzept für die Digitalisierung!
- Endlich eine professionelle und langfristig angelegte Lehrerfortbildung mit Input, Durchführung im Unterricht und Reflexion, für die die Lehrkräfte ohne Wenn und Aber vom Unterricht freigestellt werden müssen.”
Das ist nun aber auch schon der rund 10. Artikel zu diesem Thema.
Machen das normale Zeitungen auch?
Es wäre schön, wenn wir die geplanten Änderungen im Grundgesetz mal im Detail erfahren dürften.
Dieser Ruf nach der Kanzlerin vom VBE ist ja niedlich, ganz so, als hätten wir noch eine Monarchie, wo sich, die Königin ihre Kinder zur Brust nimmt und ein Machtwort spricht.
Wir haben aber eine Demokratie, in der GG-Änderungen einer Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat bedürfen. Der eigentliche Skandal ist doch, dass der Bundestag ganz kurzfristig seinen bisherigen Gesetzesvorschlag massiv abgeändert hat und sich dann darüber beklagt, dass die Bundesländer diesen Überrumpelungsversuch nicht mitmachen. Unsere zwei obersten parlamentarsischen Organe, BT und BR sind offensichtlich unfähig, bei solch wichtigen Entscheidungen zu kommunizieren. Da braucht man sich über steigende Politikverdrossenheit nicht zu wundern.
Wie lautet denn der geplante GG-Text nun genau in der aktuellen Fassung? Es ist wie beim UN-Migrationspakt: alle reden darüber, kaum einer weiß, was drin steht.
Trotz aller Unkenrufe merkt man doch immer wieder, dass ein wenig Kompetenzorientierung in der Bildung ganz gesund ist. Oder wie ist das mit der selbstständigen Aneignung von Informationen?
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/034/1903440.pdf (S.7)
und
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/061/1906144.pdf
Mein Kommentar war eigentlich nicht nur als Antwort an Cavalieri gedacht, sondern allgemein in die Runde. Sorry
@Bernd
Danke für die Vorlage. Schließe mich dem Dank an
Danke, aber ich würde eigentlich erwarten, dass die Redaktion von sich aus auf solche Links aufmerksam macht und vielleicht kommentiert, worin der Streit nun eigentlich genau besteht. Sowas hält die Redaktion aber offenbar nicht für ihre Aufgabe. So soll jede(r) im Prinzip selbst suchen, wenn’s um die wirklichen Dinge geht. Im übrigen war Pälzer ganz oben der erste mit dieser Frage, aber es gab keine Antwort.
Wenn ich allerdings jetzt die geplanten Änderungen in Art. 104b der neueren Fassung ansehe, würde ich spontan sagen, sowas gehört nicht ins Grundgesetz. Das ist finanzielle Erpressung. Solche Faktoren bei der Misch-Finanzierung müssen offengehalten werden und flexibel bleiben. Außerdem wird genau diese Misch-Finanzierung kaum erwähnt in Presseberichten über die ganze Sache.
Nebenbei: Ich hatte hier schon mal den deutschen und englischen Text des geplanten UN-Migrationspakts gepostet und auch sonst öfter Links eingestreut. Das zum Thema “Medienkompetenz”.
Toll, dass Sie sogar googeln können. Wie viel zahlen Sie nochmal dafür, dass Sie der Redaktion Arbeitsaufträge erteilen? Wie viel bezahlen Sie überhaupt dafür, dass Sie News4teachers nutzen – und zum Dank regelmäßig in Ihren Leserzuschriften beschimpfen? Oder dafür, dass Sie Ihre AfD-Werbeposts hier platzieren?
Bestellen Sie sich doch z. B. ein FAZ-Abo für 900 Euro im Jahr – dann können Sie deren Leserbriefecke vollmeckern (die haben auch das Geld und die Leute dafür, um die dann regelmäßig zu bereinigen).
Von meiner Seite: Dank an die Redaktion für die umfassende Berichterstattung (nicht nur) zum Digitalpakt, die nach meiner Wahrnehmung alle wesentlichen Informationen zur geplanten Grundgesetzänderung einschloss – hier etwa in einem einordnenden Kommentar mit allen Hintergründen: https://www.news4teachers.de/2018/11/der-digitalpakt-wird-zum-desaster-die-woche-endet-mit-einer-niederlage-fuer-karliczek-und-fuer-deutschlands-schulen/
PS. … und oben beschwert sich “Herr Mückenfuß”, dass News4teachers zu viel über das Thema berichtet. Ach Deutschland – wie man’s macht …
@Cavalieri
Deswegen schrieb ich ja hinterher, dass mein Kommentar nicht nur an Sie ging. Was die Kritik am Digitalpakt angeht, so ist das vor allem eine juristische Argumentation. Mit dem Bildungsthema hat das nicht mehr viel zu tun. Die Länder empfinden die ganze Art als übergriffig (was ich auch nachvollziehen kann). Kurzer überblick zb hier:
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/grundgesetz-aenderung-bildung-digitalpakt-schulpolitik-foederalismus-wettbewerb-bundesrat/
Was die Kritik an der Redaktion betrifft:
Hier kann man ruhig mal halblang machen. N4t ist kostenlos und im Gegensatz zu anderen Nachrichtenseiten wird man nicht mit penetranter Werbung zugebombt.
Mich stört die verbreitete Haltung im Internet alles an jeder Stelle serviert bekommen zu wollen. Ein bischen Eigeninitiative kann man schon aufbringen und Sachen in den Kommentaren ergänzen…dazu sind sie da.
ps: Das Auffinden und Auswerten von Information wird in den meisten Lehrplänen zur Methodenkompetenz gezählt 😉
Es wird in den obigen Artikeln immer nur beschrieben, welcher Politiker oder Funktionär nun was zu welchem Thema gesagt hat. Ob das stimmt oder nicht, bleibt offen. Die wirklich wichtigen Dinge erfährt man meist erst in der Diskussion im Forum. Es ist grundsätzlich die Aufgabe von Journalisten, Hintergrundinformationen zu beschaffen und diese auszuwerten. Wer soll das denn sonst können? Ist nicht “Journalist” ein Beruf? Ich fühle mich nicht als Amateur-Journalist. WARUM jetzt z.B. bestimmte Leute bestimmter Parteien für oder gegen diesen Digitalpakt sind, das erfährt man nie aus dem Internet. Alles, was wirklich wichtig ist, das kann man nicht so einfach googeln. Googeln kann man meist nur das, was das einfache Volk denken soll. Typischerweise führt solch eine Suche auf Massen von Zeitungsartikeln, jeder in mehrfacher Ausfertigung. Oder auf Reklameseiten von Ministerien nach diesem Muster:
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ministerin-loehrmann-digitalpakt-ist-guter-baustein-fuer-moderne-schulen-im
Klingt das nicht ganz wunderbar? Der schöne Digitalpakt!
Was ist nun mit Art. 104b ? Gehört solche 50:50-Aufteilung von Finanzierungen ins Grundgesetz? Dann kann das nur schwer wieder geändert werden. Diese Misch-Finanzierungen sind eine richtige Seuche geworden.
Zusatz: Die Arbeitsbelastung der Redaktion ist sicher ein Argument. Aber ich beobachte, dass auch die bezahlten Profis von tagesschau.de fast nie auf Original-Texte verlinken. Auch die berichten immer nur, wer was worüber gesagt hat. Den UN-Migrationspakt haben sie schließlich in der englischen Fassung verlinkt, die deutsche musste man selbst herausfinden. So ist das Prinzip. Immer hübsch im dunkeln halten.
@Cavalieri
“Googeln kann man meist nur das, was das einfache Volk denken soll.”
Mit Verlaub, das ist doch Unsinn. Das Problem mit der 50/50 Finanzierung steht im ersten Absatz des Artikels. Weitere Infos stehen in dem Artikel den Bernd verlinkt hat, unter dem Sie auch kommentiert haben.
Lesen Sie die Artikel eigentlich, oder schreiben Sie einfach unter jeden Artikel, dass Sie mehr über den Migrationspakt wissen wollen?
Beim Digitalpakt geht es um Kompetenz- und Finanzierungskonflikte, die so alt sind, wie föderale Systeme selbst. Welche unglaublich geheimen Hintergrundinfos fehlen denn da?
ps: auch beim Migrationspakt bin ich gerne behilflich. Schauen Sie mal hier vorbei:
http://Www.verfassungsblog.de
Tiefgehende Infos mit jeder Menge links zu schwer verdaulichen Rechtstexten.
@ Stobbart: Wer wollte denn die 50/50-Finanzierung haben und warum? Das verstehe ich unter Hintergrundinformation. Dass die Länder das nicht mögen, war doch wohl jedem vorher klar. Also warum gibt’s den Streit, und worum geht es wirklich? Mir scheint das mittlerweile ein Theater zu sein, bei dem das wesentliche hinter den Kulissen stattfindet.
Der Bund kann im Prinzip mit solchem Verfahren die Länder erpressen. Das geht so: Eine spätere rot-rot-grüne Bundesregierung könnte (befristet) Geld geben für inklusive Gesamtschulen mit irgendwelchen weiteren Besonderheiten (Reformpädagogik), wohl wissend, dass manche Länder die gar nicht haben wollen. Dann müssten diese Länder sowas erst einrichten, um überhaupt etwas vom Geld abzubekommen, und zusätzlich müssten sie auch noch (unbefristet) Geld drauflegen, denn Folgekosten hat das immer. Das geht auch innerhalb von Bundesländern, wenn bestimmte Schulformen bevorzugt ausgestattet werden. Man kann eben doch mit Geld Politik machen. Und davon ist kaum die Rede. Alle reden hauptsächlich von den digitalen Geräten als solchen und wie schön die doch sind. Ich halte das für ein Ablenkungsmanöver. Solche Überlegungen finden Sie nicht im Internet.
Den Text vom Migrationspakt habe ich diagonal gelesen und viele Kritikpunkte gefunden. Das sind aber nicht die, die die AfD so pauschal herausstellt. Verdächtig ist dabei, dass derText seit Juli feststeht, dass das aber kaum diskutiert wurde. Haben Sie das schon im Juli mitbekommen, was da kommt? Ums Juristische gehts weniger, sondern: “Rechtlich nicht bindend, aber politisch (angeblich) verpflichtend”.
@Cavalieri
“Wer wollte denn die 50/50-Finanzierung haben und warum? ”
Der Bund, um eine Zweckbindung seiner Gelder zu erreichen. Steht aber auch so im letzten Absatz des Artikels. Warum die Länder das nicht mögen, haben Sie ja grob beschrieben und es steht auch nochmal im aktuellsten Artikel hier auf N4T. Weiteres erfahren wir, wenn die Sache in den Vermittlungsausschuss geht.
Dass sich zu diesen Sachen aber keine Informationen fänden, ist schlicht nicht war. Bund- Länder- Finanzbeziehungen und Bildungföderalismus sieht seit Jahren Themen und waren es auch im Bundestagswahlkampf.
Beim Digitalpakt soll die Aufteilung aber 90:10 sein, das steht oben. Und der soll ja wohl auch zweckgebunden sein. Also warum später 50:50 ?
Das Geld kann man auch gleich verbrennen., Doof bleibt doof! 50% der Schulabgänger können nicht richtig lesen und schreiben. Obwohl das Bildungssystem schon teuer genug ist. Siehe auch die unnützen Angestellten die sich da rumtreiben, wie Sozialarbeiter, Dolmetscher, Psychologen etc.. Mit noch mehr geld , kommen noch mehr solcher unsinnigen Stellen hinzu.
Hier steht eine Kritik an möglichen Gefahren der Digitalisierung schlechthin:
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/hoch-schule/digitalisierung-der-schulen-nicht-fuer-das-tablet-fuer-das-leben-lernen-wir-15923245.html
Nebenbei wird klar gesagt, dass es auch ohne Grundgesetzänderung ginge. Die Gelder für die Unterbringung von Flüchtlingen konnte man ja auch ohne Grundgesetzänderung verteilen. Also könnte man das jetzt analog machen, und die Frau Lin-Klitzing vom Philologenverband hat recht. Wenn jetzt die Bundeskanzlerin sagt, aha, die 50:50-Regelung ist das Problem, so ist das einfach heuchlerisch. Sie wusste das ja wohl vorher.
Ob der Digitalpakt auch ohne GG-Änderung kommen kann, ist sehr umstritten. Sowohl der Bundesrechnungshof, der kontrolliert, ob Bundesausgaben legitimiert sind, als auch führende Verfassungsrechtler haben da große Bedenken. Zwar kann der Bund nach Art. 91c auch Geld für “Informationssysteme” in den Ländern und Kommunen geben. Aber dieser Artikel ist ins GG aufgenommen worden, um dem Bund zu ermöglichen Geld für Informationssysteme bei Polizei und Steuerverwaltung auszugeben, nicht im Bildungsbereich, der aufgrund der föderalen Struktur seiner Zuständigkeit verfassungsrechtlich bislang klar entzogen ist.
Und Art 106, auf den der Philologenverband verweist, regelt die Verteilung von Steuern. Die Länder hätten gerne einen größeren Anteil von der Umsatzsteuer. Die spannende Frage ist allerdings: Geben dann die Länder diese höheren Steuereinnahmen auch vermehrt für Bildung aus? Da können einem schon Zweifel kommen, wenn man die Prioritätensetzung mancher Länderhaushalte in der Vergangenheit kennt.
Also wird an einer begrenzten Aufweichung des Kooperationsverbots im GG kein Weg vorbeiführen, wenn man den Digitalpakt retten will.