BERLIN./STUTTGART. Wenn das Chaos im Kopf am größten ist und die Identitätsfindung wichtiger wird als gute Noten, lohnt sich dann der Schulbesuch überhaupt noch? „Absolut“, sagt Anne Nadolny. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Die Pädagogin an der Jugendschule des Montessori Campus Berlin Köpenick hat auf der Bildungsmesse didacta im März gemeinsam mit Schülerinnen das besondere Konzept ihrer Schule vorgestellt – einer „Schule, die keine Schule ist“ und die die Bedürfnisse von Teenagern ernst nimmt.
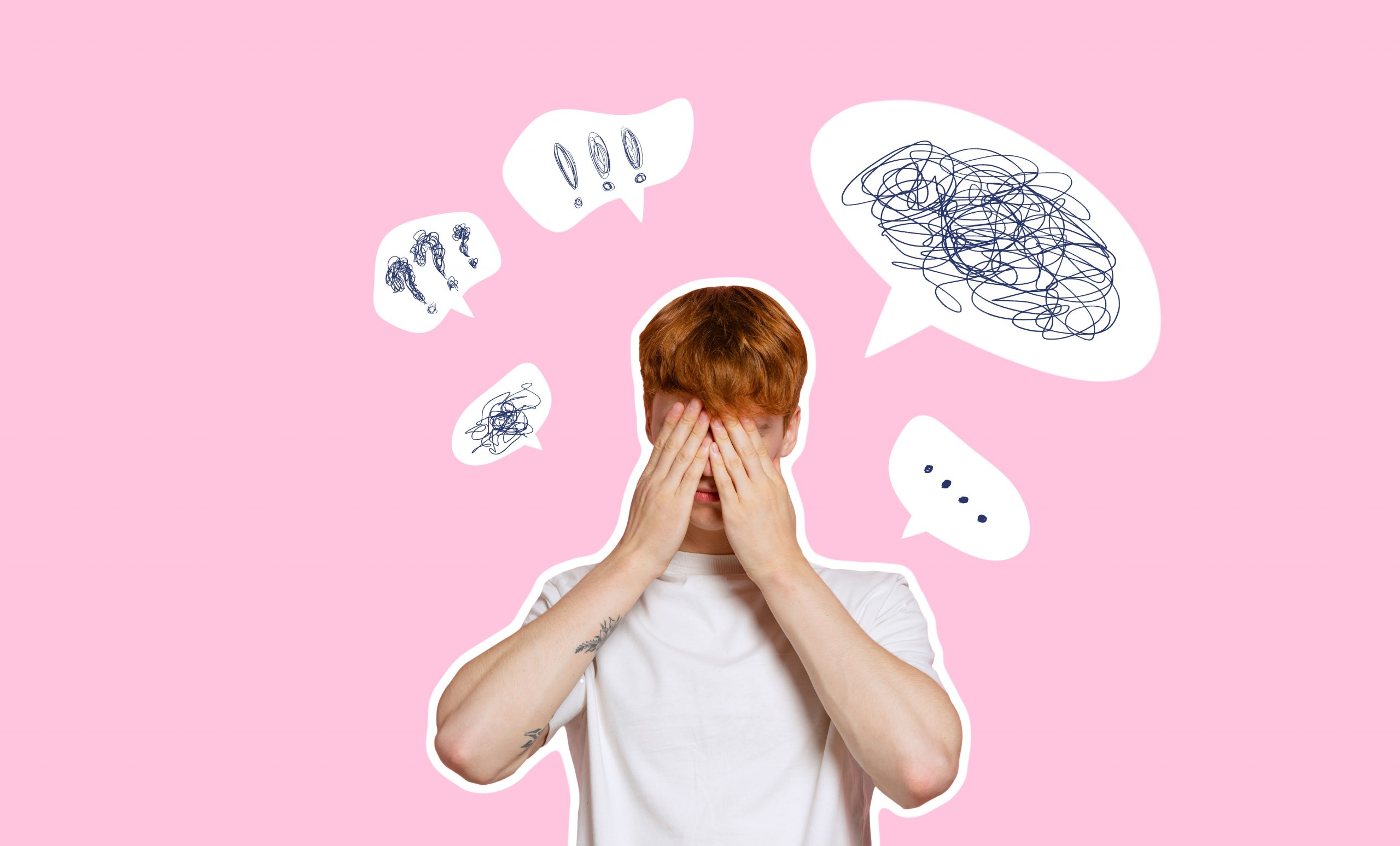
Dass sich bei Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 16, der Hochpubertät, oft nur das Handy im Online-Modus befindet, der Kopf hingegen – insbesondere während des Unterrichts – häufig offline geschaltet ist, dürfte jede Lehrkraft schon erlebt haben. Kein Wunder, denn in dieser Altersklasse finden enorme neuronale Umbauprozesse statt. Lediglich in den ersten drei Lebensjahren verändert sich das Gehirn noch stärker.
Und das hat Folgen: Von der Vergesslichkeit und der gelegentlichen langen Leitung bis hin zu ernsthaften Schwierigkeiten wie einem gesteigerten Aggressionspotenzial, leichtsinnigem Verhalten, Angststörung und Depression. Lange Zeit lag der Fokus der Wissenschaft auf diesen Schattenseiten der Adoleszenz. Erst seit den 2000er Jahren, so das Wissenschaftsmagazin Spektrum, widmeten sich Entwicklungsforscher:innen vermehrt dem Potenzial des jugendlichen Gehirns.
Mitte April 2023 – unmittelbar nach den Osterferien – laufen auf News4teachers, mit 2,5 Millionen Seitenaufrufen monatlich Deutschlands meistgelesenes Bildungsmagazin, die Themenwochen Privatschulen. Ein Schwerpunkt dabei: Was die pädagogische Arbeit an einer freien Schule ausmacht.
Privatschulen können das Umfeld der redaktionellen Berichterstattung nutzen, um mit Anzeigen und Pressemeldungen auf sich aufmerksam zu machen. Unser besonderes Plus: Alle Pressemitteilungen und Content-Marketing-Anzeigen, die im Rahmen unserer Aktion gebucht werden, gehen ohne weitere Kosten in das News4teachers-Dossier „Blickpunkt Privatschulen 2023“ ein, ein attraktiv gestaltetes PDF-Heft, im dem wir nach Abschluss der Themenwochen alle Beiträge bündeln. Hier geht es zum „Blickpunkt Privatschulen 2022“.
Interessiert? Informieren Sie sich über die Konditionen! Anfragen bitte an: andrej.priboschek@bildungsjournalist.de
Dazu gehöre das Interesse der Jugendlichen an Status und Respekt, ihr sich entwickelndes Selbstverständnis, einen Platz in der Welt zu finden, und ihr Bedürfnis, einen Beitrag zu leisten und Sinn zu erleben. Ähnliche Ideen gebe es in der Pädagogik zum sozialen und emotionalen Lernen. Die Phase von Rebellion und Widerstand der Teenager sei so betrachtet ein Fenster der Möglichkeiten, heißt es in dem Magazin. Dies könnten sich Schulen zunutze machen. So fanden Forscher beispielsweise heraus, dass Botschaften effektiver bei Teenagern wirken, wenn sie respektvoll und authentisch kommuniziert werden. Und Freiwilligenprogramme, in denen Jugendliche bei der Arbeit mitentscheiden und reflektieren dürfen, seien besonders erfolgreich.
Selbstwirksamkeit kommt an Regelschulen zu kurz
Doch gerade in der Schule erfahren Jugendliche hierzulande kaum Möglichkeiten für Mitbestimmung. Im Gegenteil: Schule wird als statisches und kaum gestaltbares System erlebt. Zu diesem Ergebnis kam die Sinus-Jugendstudie 2022, die alle vier Jahre die Lebenswelten 14- bis 17-jähriger Teenager in Deutschland untersucht. Schule sei eher ein Ort des Stresserlebens als des Wohlfühlens, heißt es darin. Die Corona-Krise habe den Wirkraum von Jugendlichen zusätzlich eingeschränkt. Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS), die an der Studie mitgewirkt hat, plädiert daher dringend dafür, die Selbstwirksamkeit Jugendlicher mehr denn je zu fördern.
In der Praxis sehen sich Schulen allerdings gravierenden Problemen gegenüber: Neben pandemiebedingten Bildungslücken, klaffen die Personalleerstellen wie noch nie. Bildungsgerechtigkeit bleibt auf der Strecke, denn es fehlt schlichtweg die Zeit, um benachteiligte Kinder und Jugendliche adäquat und individuell zu fördern. Das bestätigen laut der im März veröffentlichten Cornelsen Schulleitungsstudie acht von zehn Befragten. Wie sollen Lehrkräfte also unter diesen Bedingungen Selbstwirksamkeit fördern?
Eine Schule, die keine Schule ist (wie wir sie kennen)
Das Lehrerehepaar Anne und Timo Nadolny kennt den Spagat zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Der Gymnasiallehrer und die Grund- und Hauptschullehrerin hatten beide bereits Jugendliche an Regelschulen unterrichtet, bevor sie sich zu Montessori-Pädagogen ausbilden ließen. Im Laufe seiner Arbeit an der Oberschule des Montessori Campus Berlin Köpenick, entdeckte Timo Nadolny dann die Vorzüge des schuleigenen über 2,5 Hektar großen Grundstücks im benachbarten Strausberg, Brandenburg.
Er begann, das ehemalige Klostergelände zunächst regelmäßig als außerschulischen Lernort zu nutzen und machte einmal pro Woche einen Ausflug mit einer Gruppe von Schüler:innen dorthin – darunter auch solche, die Schwierigkeiten hatten, sich an das System Schule anzupassen. Das Ziel: Theoretisches und praktisches Lernen miteinander zu verknüpfen und den Teenagern Erfahrungen von Selbstwirksamkeit zu ermöglichen. Aus diesen Anfängen entwickelte sich die Idee, eine Jugendschule nach dem Vorbild einer in Schweden und den USA erfolgreichen „Farmschool“ zu gründen, einem sogenannten „Centre for Work and Study“ mit Wurzeln in der Montessori-Pädagogik.
Das reformpädagogische Konzept, das die italienische Ärztin Maria Montessori vor über einhundert Jahren auf Basis ihrer Beobachtungen entwickelte, geht von den Bedürfnissen des Kindes in seinen jeweiligen Entwicklungsphasen aus. Die Adoleszenz umspannt darin das Alter von 12 bis 18 Jahren. Speziell für diese Jugendlichen hatte Montessori ein besonderes Lernarrangement entwickelt: eine „Erfahrungsschule des sozialen Lebens“, möglichst auf dem Lande, in der die angehenden Erwachsenen lernen, in der Gemeinschaft Gleichaltriger Verantwortung zu übernehmen, Raum für ihre Selbstfindung erhalten und durch landwirtschaftliche Tätigkeiten beginnen, sich ihren Lebensunterhalt selbst zu erwirtschaften.
Im Kern konzentriert sich dieses im letzten Jahrhundert entstandene Konzept des Studien- und Arbeitszentrums (wegen der Nähe zur Natur auch „Erdkinder-Plan“ genannt) also auf genau das, was die Gehirnforschung heute als Faktor für den Schulerfolg in der Pubertät bestätigt: das emotionale und soziale Lernen.
Wie funktioniert „Work and Study“?
Während der pandemiebedingten Lockdowns konnten Timo und Anne Nadolny die Jugendschule Strausberg bereits im Ganztagsbetrieb ausprobieren, denn der Unterricht beziehungsweise „Work and Study“ kann komplett im Freien stattfinden. Zahlreiche Medien berichteten über den ungewöhnlichen Ansatz.
„In der ersten Lerngruppe in Strausberg waren Jugendliche dabei, die eigentlich als nicht beschulbar galten“, berichtet Anne Nadolny. „Teilweise zeigten sie aggressives Verhalten. Die Jugendlichen beschäftigen sich generell in dieser Altersgruppe sehr mit sich selbst. Und bei den Tätigkeiten, die bei uns anfallen, haben sie auch ausreichend Zeit und Raum das zu tun.“ Das gemeinsame Lernen und Arbeiten habe die Gruppe zusammengeschweißt und der erste Durchlauf des Programms sei ein toller Erfolg gewesen: Alle Jugendlichen haben den MSA, Berlins Mittleren Schulabschluss, geschafft und eine Lehrstelle gefunden.
Wie das Work und Study Prinzip in Strausberg konkret umgesetzt wird, berichteten drei Schülerinnen gemeinsam mit Anne Nadolny am Stand des Montessori Bundesverbands Deutschland auf der diesjährigen didacta in Stuttgart. Larissa (13), Antonia (14) und Joli (14) gehören zu einer inklusiven Gruppe von mittlerweile 40 Schüler:innen zwischen 12 und 16 Jahren, die einen Tag pro Woche auf dem Strausberger Gelände verbringt. An den anderen Tagen findet der Unterricht noch auf dem Berliner Campus Köpenick statt, bis das Land Brandenburg die Schulanerkennung ausgesprochen hat – eine bürokratische Hürde, die die geografische Lage mit sich gebracht hat.
Noten, erzählen die Schülerinnen, gibt es in der Jugendschule erst ab der 10. Klasse, wenn die Schulabschlüsse anstehen. Entscheidend für das Weiterkommen seien dafür Leistungsbeurteilungen durch zwei sogenannte „Abschlüsse“ in jedem Fach pro Halbjahr. Zu den Fächern zählen derzeit Mathe, Englisch, Deutsch und Spanisch sowie Natur- und Gesellschaftswissenschaften. Die Jugendlichen befassen sich nach einer Einführung durch die Lernbegleiter:innen tiefergehend mit einem Thema und stellen ihre Arbeitsergebnisse dann in der Gruppe vor. Ob das in Form von Texten, Erklärvideos, Präsentationen oder Protokollen geschieht, ist ihnen selbst überlassen.
Wie für Montessori-Einrichtungen typisch sind die Lerngruppen altersgemischt. „Die jüngeren Schüler:innen orientieren sich an den älteren“, erklärt Anne Nadolny. „Die Zehntklässler geben die Richtung vor und haben eine Vorbildfunktion. Auf diese Weise reguliert sich die Gruppe selbst.“ Im Gleitzeitsystem startet der Schultag in Strausberg zwischen 8 und 9 Uhr. Nach einer Besprechung im Morgenkreis arbeiten die Schüler:innen in der sogenannten Freiarbeitsphase projektbezogen. Dann folgt das gemeinsame Mittagessen und weitere Freiarbeit beziehungsweise praktisches Arbeiten draußen bis etwa 15 bis 16 Uhr.
„Nicht für die Schule sondern für das Leben lernen wir.“
Hauptsächlich, erklärt Antonia, gehe es in ihrer Schule um die Verknüpfung von Praxis und Theorie. „Es gibt Gemeinschaftsaufgaben, die wir wirklich machen müssen, weil sie wichtig sind. Zum Beispiel müssen wir die Tiere, die wir halten, versorgen. Wir müssen uns auch um die Instandhaltung und Pflege der Gebäude kümmern und kochen“, erklärt die 14-Jährige. „Die Freiwilligenarbeiten suchen wir uns selbst aus. Einige Schüler:innen kümmern sich um unsere Bienen, andere haben zum Beispiel einen Zaun gebaut, um die Wildschweine aus unserem Garten rauszuhalten, weil wir sonst nichts ernten können. Das führt dazu, dass wir Schüler selber lernen, Verantwortung zu übernehmen und das Lernen zu lernen.“
Am Beispiel der Kaninchenhaltung führt sie aus, wie Praxis (Work) und Theorie (Study) ineinandergreifen. Die Schüler:innen müssten sich zum Beispiel überlegen, welche Kosten dadurch entstehen und ob sich die Haltung überhaupt lohnt. Auch ethische Überlegungen kämen ins Spiel: Ist es überhaupt in Ordnung für uns, die Kaninchen später zu essen? Verkaufen wir sie weiter, damit andere sie womöglich schlachten können? All das würden die Jugendlichen vorab besprechen.
Für bestimmte Bereiche, wie die Schülerfirma, die Finanzen, die Kommunikation über Internet und Newsletter oder das schuleigene Gästehaus, gibt es das sogenannte Managersystem an der Schule. Manager, erklärt Joli, seien ein bis zwei Schüler und ihre Stellvertreter, die für einen dieser Bereiche verantwortlich sind. Die Manager treffen sich mit den Pädagog:innen zum Wochenrückblick und zur Planung. Neue Ideen tragen die Manager in ihre Lerngruppe und stimmen sie dort ab. Joli selbst engagiert sich für die Schülerfirma, die Apfelsaft und Marmelade herstellt und verkauft. Sogar einen Cateringauftrag bei einer Veranstaltung des Montessori Bundesverbands Deutschland haben die Schüler:innen schon erfolgreich gemeistert. Strategisches Denken, Planen und Organisieren, also die Bereiche, die das jugendliche Gehirn erst allmählich ausbildet, können die Teenager hier in einer sicheren Umgebung trainieren.
Digitalität und Erdkinder-Konzept? Passt.
Dazu gehört auch der Umgang mit digitalen Medien. Larissa, Antonia und Joli weisen das didacta-Publikum ganz selbstverständlich auf den Aufsteller mit ihrem QR-Code hin, der auf die Website der Schule führt. Das Besondere: Die Schüler und Schülerinnen kümmern sich selbst um den Internet- und Social Media Auftritt. Auch den Schul-Newsletter, planen und schreiben sie selbst.
Ihre Handys müssen sie für die Zeit des Unterrichts zwar abgeben, dafür bekommen sie aber ein iPad als Arbeitsgerät. „Wir setzen Lernsoftware ein, erstellen digitale Präsentationen und arbeiten seit den guten Erfahrungen während der Lockdowns auch hybrid“, erzählt Anne Nadolny. „Wenn eine Schülerin oder ein Schüler nicht nach Strausberg kommen kann, dann kann er oder sie sich über Video-Call dazuschalten oder unsere Cloud nutzen. Das klappt wunderbar.“ Auf diese Weise kommunizieren die Jugendlichen zum Beispiel gerade mit einer Englisch-Lehrkraft, die eine Weltreise macht. Auch der Vortrag für die didacta sei digital über eine App abgesprochen und dann auf der Zugfahrt noch einmal gemeinsam eingeübt worden, sagt die Lehrerin. „Die Mädchen haben das selbstständig erarbeitet. Sie hatten da mein volles Vertrauen und ich bin sehr stolz auf sie.“
Schritt für Schritt ins Erwachsenenleben
Bei allem, was die Jugendlichen tun, gehe es hauptsächlich darum, die Resultate des eigenen Schaffens zu sehen und zu erleben, betont Anne Nadolny. „Dazu gehören sowohl Erfolge als auch Misserfolge. Wer zum Beispiel nicht genügend Portionen für das Mittagessen berechnet oder den Putzdienst nicht ernst nimmt, spürt die Konsequenz sofort“, erklärt sie. Auch wenn die Jugendschule als Außerschulischer Lernort schon sehr gut funktioniere: Diese Selbstwirksamkeit könne sich eigentlich erst bei Umsetzung des Vollzeitkonzepts richtig entfalten, so die Pädagogin weiter. „Jugendliche brauchen keine Schule, sondern Work and Study, davon bin ich fest überzeugt“, sagt sie.
Deshalb ist nicht nur der Vollbetrieb mit einer flexiblen, an den Biorhythmus der Teenager angepassten Gleitzeitstruktur an fünf Tagen pro Woche geplant. In fünf Jahren soll die Jugendschule auch ein Residenzprogramm anbieten können. Dann könnten Schüler:innen unter der Woche in Strausberg wohnen – freiwillig und von individueller Dauer. „Manchen Jugendlichen wird in der Familie noch sehr viel abgenommen“, sagt Anne Nadolny. „Eine Ablösung kann ein wichtiger Schritt in die Selbständigkeit sein, auch wenn es nur für einige Wochen ist. Besonders, wenn die Schülerinnen und Schüler schon etwas älter sind“, fügt sie hinzu. Auch für die Familie könne eine Trennungsphase positive Effekte haben: Ein Kind, dass sich vielleicht schon sehr selbständig fühle und zuhause rebelliert, könne merken, dass es die Eltern doch noch braucht, wenn es die Familie eine Zeit lang verlässt und die gemeinsame Zeit am Wochenende vielleicht ganz anders genießen.
Wie können Schulen Teenager besser unterstützen?
Dass es bislang in Deutschland nur wenige vergleichbare Schulen gibt, die ihr Konzept so nah an die ursprünglichen Ideen Maria Montessoris anlehnen, lässt sich mit den Kosten für ein passendes Außengelände erklären. „Viele Schulen würden gerne so arbeiten, aber die wenigsten sind in einer so glücklichen Lage, über ein derartiges Grundstück zu verfügen“, sagt Anne Nadolny. Viele Montessori-Sekundarschulen seien aber auf dem Weg dorthin und auch Regelschulen könnten sich durchaus inspirieren lassen, um das Lernen für Pubertierende erfolgreicher zu gestalten.
„Da, wo es Spielräume für Tagestrukturen und Schülergleitzeit gibt, sollte man sie zu nutzen versuchen“, sagt Nadolny. „Work and Study-Zyklen lassen sich wie Projektarbeit organisieren. Damit Jugendliche Selbstwirksamkeit spüren können, brauchen sie allerdings Raum für die praktische Arbeit. Das kann ein Gewächshaus sein, eine Lehrküche oder eine Schülerfirma.“ Wichtig seien dabei immer das Nebeneinander und regelmäßige Gespräche von Lehrkräften und Schüler:innen. Am allerwichtigsten sei es aber, den Schüler:innen ihr Projekt von der Planung bis zur Durchführung der Idee zu überlassen, ihnen Verantwortung zu übergeben für den Prozess und Misserfolge als Lernchancen zu begreifen. Sonja Mankowsky, Agentur für Bildungsjournalismus
Derartige Ansätze aus dem Montessori-Umfeld (und anderen) hat es immer wieder gegeben, mehr oder weniger nachhaltig.
Was es auch dafür braucht wie für Schule überhaupt: ausreichend Personal (eher mehr als für Unterricht nach Lehrplan), Zeitressourcen (die an staatlichen Schulen nicht freigeschaufelt werden können), kleinere Gruppen zur Interessendifferenzierung und für intensivere Arbeit, Unterstützung durch außerschulische Stellen, Möglichkeiten (Transportverbot für Lehrkräfte) und Finanzierung von Schülertransport (zum Schwimmbad vom Schulträger finanziert kein Problem – alles andere bringt unendlich Bürokratie und Eltern müssen es finanzieren).
Montessoris Ansatz weitergedacht könnte man Ressourcen der Lehrkräfte (Hobby-Musiker, -Landwirte, -Gärtner, -Maler, -Schauspieler…) und Kontakte zu außerschulischen Lernorten im Stadtteil nutzen. Für all das ist leider im Schulalltag keine Zeit und kein Geld da.
Es reicht gerade für ein zwei- oder dreiwöchiges Praktikum – und selbst dafür ist die Betreuung nicht sichergestellt und bei den Schülern ist es nicht wirklich willkommen, weil sie nicht auf reales Lernen vorbereitet sind.
So viele verschenkte Chancen 🙁
Ansätze Ihres Konzeptes finden sich auch in dieser Hamburger Reformschule, die z.B. Pubertierende eigenständig eine Fahrradtour durch Europa planen ließen mit allen Konsequenzen. Lebensnäher gestellte Aufgaben gibts kaum und soweit ich weiß, wurden sie prima umgesetzt von den Pubertieren 😉
https://sts-winterhude.de/
Ich muss sagen, dass solche Ansätze wie Montessori eher schädlich sind. Die Jugendlichen müssen lernen sich an Regeln zu halten und ihnen mehr Freiheiten zu geben ist kontraproduktiv. Vielen meiner Schüler tut es gut, wenn man klare Regeln aufstellt und diese auch durchsetzt!
Nicht “Freiheit von…” ist gemeint, sondern “Freiheit für”!
Dafür braucht es unabdingbar Regeln. Auch und gerade bei Montessori.
Wenn es gut gemacht ist, lernen sie gerade durch diese Ansätze Regeln!
Wesentlicher Bestandteil der Pädagogik, die an Montessori orientiert ist, sind Regeln für den Umgang miteinander, mit dem Material, mit den Inhalten, der Natur, das Erkennen von Naturgesetzen, die sinnvolle, zweckgebundene Verwendung der Dinge und Lernmittel.
Regeln helfen zu verstehen, zu kategorisieren und am Ende kreativ zu sein – wenn sie sinnvoll gesetzt werden.
M.E. sind Regeln in “normalen” Schulen oftmals eher dazu da, Schüler “in einen Guss” zu bringen. Individuelle Stärken sind da wenig gefragt, wenn sie nicht sogar unterdrückt und dem Lehrplan untergeordnet werden.
Ich verstehe nicht, was an dem im Artikel geschilderten Ansatz schlecht sein soll.
Die Jugendlichen lernen doch gerade durch die natürlichen Konsequenzen, die sich aus dem eigenen Fehlverhalten, wie z.B. Schlampigkeit oder Leichtsinnigkeit ergeben, sich an Regeln zu halten.
Und das wahrscheinlich für sie selbst nachvollziehbarer und nachhaltiger, als durch willkürlich von Erwachsenen aufgestellte Regeln und “Strafmaßnahmen”, die oft gar keinen Bezug zueinander haben.
Hier lernen die jungen Menschen auch ganz lebenspraktische Dinge, die für ihr späteres Berufsleben wahrscheinlich nützlicher sind, als so manche “graue Theorie.”
Hier überzeugt mich, die ich digitaler Technik sonst überaus kritisch gegenüberstehe, sogar der Einsatz digitaler Medien im Unterricht, weil er im gesunden Verhältnis zu natürlichen, analogen, und praktischen Erfahrungen steht.
Wenn ich so etwas lese, denke ich immer, so müßte Schule eigentlich sein.
Ich glaube auch, daß viele Lehrer guten Willens wären, Schule zu so einem Ort zu machen.
Ich fürchte nur, daß es dazu in der Breite nie kommen wird, weil: Zu teuer, zu wenig Personal, zu wenig Platz, zu wenig Zeit.
Gefragt wäre hier die Politik, die die erforderlichen Ressourcen schaffen müßte, damit an Schulen so gearbeitet werden kann.
Absolut.
Und auch in einem solchen Setting kann man durchaus Regeln und v.a. gemeinsame Absprachen etablieren. Sehe da keinen Widerspruch.
Ich glaube, in einer idealen Welt hast du recht, allerdings müssen wir berücksichtigen, dass es in der „Erwachsenenwelt“ auch viele willkürliche Regeln, die man befolgen muss und das muss auch in der Schule vermittelt werden durch strenge. Da gibt es viele Studien, die zeigen, dass Kinder strenge Regeln brauchen, um im späteren Leben klarzukommen.
Darum dein Ansatz ist aller ehrenwert, aber leider funktioniert es nicht.
Könnten Sie mir wenigstens eine von den vielen Studien nennen? Interessiert mich wirklich.
Haben Sie je mit Menschen gesprochen/Menschen kennen-gelernt, die mit Montessori groß geworden sind oder in diesen Systemen unterrichten???
Dann käme sicher kein Urteil nach dem Motto “…funktioniert leider nicht”…
Ich finde nicht, daß Kinder “strenge” Regeln brauchen.
Kinder brauchen “klare” Regeln und Erwachsene, die sowohl liebevoll als auch konsequent auf deren Einhaltung achten.
Klar kann man Menschen dressieren indem man klare Regeln aufstellt und diese auch durchsetzt. Sie gewöhnen sich daran und es ist ja auch viel viel einfacher als sich selbstbestimmt durchs Leben zu schlagen. Man kann natürlich nur hoffen ; Hoffentlich kommt dann nicht wieder so ein Mensch wie Anno 33 der mit Menschen die es gewohnt sind klare Regeln zu befolgen prima umgehen kann.
Das heißt, die Regeln im Straßenverkehr sind nur zur Dressur da? Das BGB ist zur Dressur da? Wenn Sie meinen.
Gibt es keine Regel, gilt das Recht des Stärkeren oder des Skrupellosesten. Die beiden Teenies, die mutmaßlich die 12-jährige Luise ermordet haben, haben sich auch nicht an Regeln gehalten.
Die haben sich an die Regeln gehalten solange sie überwacht wurden. Da man ihnen aber stumpfe Regeln wegen Sanktionen einhalten andressiert hat und eben nicht intrinisisch richtiges Verhalten beigebracht habt haben sie eben gemordet. Die Nazis die die Konzentrationslager betrieben haben waren mit 100%iger Sicherheit als Jugendliche Schüler*innen gewesen die absolut diszipliniert und gehorsam in der Pubertät dem Unterricht gefolgt sind.
Ohne Regeln ist ein Zusammenleben nicht möglich. Bräuchte man sonst eine Straßenverkehrsordnung oder Gesetze?
Montessori-Verbände fahren offensichtlich eine große Marketing-Kampagne, es fehlt jedoch noch der Beweis, dass das Konzept aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts in der Fläche funktioniert und finanzierbar ist.
Außerdem ist es sehr verwunderlich, dass mit vollem Recht sensibel um rassismusfreie Abilektüren gestritten wird, ohne im gleichen Bildungsmagazin auf die tiefen Verstrickungen Frau Montessoris mit dem italienischen Faschismus zu verweisen:
https://sciencev1.orf.at/science/news/50885
Ich wünsche mir sehr, dass im von mir sehr geschätzten Bildungsmagazin news4reachers auch hierüber offen diskutiert werden kann.
Hat Montessori sich nicht in erster Linie mit Behinderten beschäftigt und ihnen durch ihre Methoden zu großen Lernfortschritten verholfen?
Muss man auch berücksichtigen.
Es mag sein, dass Montessori sich auch eingeschränkten Kindern gewidmet hat, aber bei weitem nicht nur: Im Zentrum stand für sie generell das Kind unabhängig von seinen Möglichkeiten.
Welchen Beweis bedarf es denn bitte noch, wenn Schulen und Verbände auch heute noch einen große Bestätigung erfahren durch entsprechende Anmeldungen, es seit Jahrzehnten Ausbildungen gibt, die ebenfalls gut frequentiert sind.
Apropos Nazis und Montessori: Ihre Methode wurde von Nazis verboten, was unverwunderlich ist, da ihr höchster Wert Freiheit für das Kind und faschistische Ideale ein Widerspruch in sich sind.
Zu kritisieren wären vielmehr ihr Dogmatismus hinsichtlich ihres selbst hergestellten Lernmaterials und eine rein naturwissenschaftlich orientiertes Weltbild.
Mich beeindruckt ihr Menschenbild: Nur das Kind kennt seinen “inneren Bauplan”, wir sollten dafür sorgen, dass es diesen möglichst uneingeschränkt entwickeln kann in einer entsprechend reizvollen Umgebung.
https://www.zeit.de/2007/02/A-Montessori/seite-5?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Hier gibt es ausführliche Infos auch dazu:
https://www.deutschlandfunkkultur.de/freude-freiheit-und-verantwortung-100.html
https://www.zeit.de/2007/02/A-Montessori/seite-5?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
“Die triumphierende Rasse besteht aus weißen Menschen, deren Staturtyp eine Harmonie der Formen des Körpers aufweist.” (Maria Montessori)
https://www.furche.at/gesellschaft/wie-faschistisch-ist-montessori-8339289
Kann ein Mensch ein Vorbild sind, der solche Sätze schreibt und zudem 1931 beteuert, „dass meine Methode mit dem Faschismus vereinbar ist“? Die biologischen und psychologischen Thesen von Frau Montessori sind zudem wissenschaftlich längst widerlegt.
Kolleg*innen, die jungen Menschen ein sog. Montessori-Diplom ausstellen, sollten sich mit diesen Fakten auseinandersetzen. Warum braucht es überhaupt in pädagogischen Fragen einen Personenkult? Keine Disziplin, auch nicht die Erziehungswissenschaft oder die Schulpraxis, kann im 21. Jahrhundert ernsthaft einen Menschen auf ein Podest stellen, der scheinbar auf alle Fragen eine Lösung weiß. Das ist weder “linksliberal” noch “fortschrittlich” oder gar “bildungsbürgerlich”, es hat eher einen unseriösen Anstrich.
“Kolleg*innen, die jungen Menschen ein sog. Montessori-Diplom ausstellen, sollten sich mit diesen Fakten auseinandersetzen.”
Ich kann sicherlich nicht für alle sprechen, aber soweit ich weiß, wird das durchaus getan – anders als bei der Waldorf-Pädagogik, bei der sich auch heute noch massiv auf die Steiner’schen Thesen konzentriert wird, ohne sie zu hinterfragen.
Montessori hat in einer schlimmen Zeit, in der solche Annahmen im Mainstream anerkannt waren, einen Grundstein gelegt. Ihre Arbeit wurde aber weiterentwickelt und ist heute gar nicht mehr so einheitlich vertreten. Da kochen viele ihre eigenen Süppchen und machen es in der Umsetzung sicherlich mal besser und mal schlechter.
Also ich denke, dass dieses ganze Konzept und history wieder nur den Lehrgang in die Hände spielt, die versuchen wollen ihre Verantwortung abzugeben und das in diesem Fall an die Leidtragenden Schüler. Ich denke nicht dass es grundsätzlich ein gutes Konzept ist, da es einfach nur als Arbeitserleichterung missbraucht wird um weltweitigen Fehlern den schwarzen Peter anderen zu schieben zu können. Das ist ja auch am einfachsten, die Fehler bei den anderen zu suchen und nicht bei sich selbst
Oh je, gründlicher lässt sich dieses Konzept vermutlich nicht missverstehen…
@Cornelia Maier
“Das ist ja auch am einfachsten, die Fehler bei den anderen zu suchen und nicht bei sich selbst”
Sie zeigen mit Ihrem Beitrag sehr schön wie einfach das geht.
Haha, gut erkannt.
Aber ich muss sagen, dass es zum Glück auf dieser Seite generell sehr wenig Trolle gibt 🙂
Haben Sie noch nie mit ihren Kindern zum Beispiel gebacken und ihnen – je nach Alter – eine Teilaugabe gegeben?
Zutaten holen, abwieden, verrühren, Backform fetten, … Temperatur einstellen … Backzeit im Blick haben, Stäbchenprobe …. Da muss eine Teilverantwortung übernommen werden.
Aus (Teil) Verantwortungen entsteht Selbstständigkeit. Lernerfolg und Misserfolg mit entsprechender Korrektur (nicht auf Zeit geguckt – Rauchmelder in der ganzen Siedlung zu hören 😉 )
Kinder müssen t u n, h a n d e l n, dadurch stellen sie fest, dass sie was können und was ihnen liegt.
Nein, ich betreibe keine Bäckwrei und lasse meine Kinder die Kuchen und Brötchen backen und verkaufen.
Aber in der Schule machen wir das.
Rezept aussuchen – bekannt, neu, spannend? – Zutatenliste erstellen, Mengen berechnen, prüfen, was vorhanden ist, was gekauft werden muss, einkaufen, loslegen.
Soo lernen Kinder praktisch – soo lernen sie überhaupt.
Ach, der unattraktive Abwasch gehört natürlich auch zum Gesamtpaket “learning by doing”!
Menno!
Und ich spring natürlich wieder drauf an..
*schlagdiehandvordenkopf*
“Zu diesem Ergebnis kam die Sinus-Jugendstudie 2022, die alle vier Jahre die Lebenswelten 14- bis 17-jähriger Teenager in Deutschland untersucht. Schule sei eher ein Ort des Stresserlebens als des Wohlfühlens, heißt es darin.”
Das ist mir ein bisschen zu undifferenziert als Fazit – unsere Schülys würden das auch schreiben, obwohl die wirklich unheimlich viel Selbstwirksamkeit erleben, sehr ernst genommen werden und viel Mitspracherecht haben.
Stress – Liebeskummer und er/sie/es hat schon wen anders.
Stress – zu Hause Ärger und der Stress wird in der Schule besprochen – kocht hoch.
Stress – Klassenarbeit und keinen Bock und/oder keinen Schimmer.
Stress – Handyakku ist leer.
Stress – (wenig) Mobbing, Beleidigungen, Blicke der besonderen Art..
Stress – kein Bock auf Sport – Sportzeug nicht mitgebracht, Extraarbeit, da nicht ohne Aufsicht.
Gleichzeitig würden nämlich fast alle sagen, dass sie sich bei uns wohlfühlen.
Sonst hört sich das Gelesene wie ein Träumchen an. (Allerdings – ganz ehrlich, weder neu noch überraschend – Lehrys wissen so etwas meist 😉 )
Wer steht im Wege? Ich könnte auf Anhieb 16 Namen nennen…..
Sehr guter Beitrag. Zum Teil sind SuS schon gestresst und beschweren sich beim Klassenlehrer über mich, weil ich sie auf wiederholtes Zuspätkommen anspreche. Ich habe seit Corona auch viel mehr Panikattacken erlebt. Die sozialen Medien und allgemein Medien präsentieren unseren SuS sehr schlechte Vorbilder. Mal etwas kommentarlos anzunehmen oder zu reflektieren bringt keine Views/Likes/Shitstorms.
Verwundern Sie vermehrte Panikattacken insbesondere von Jugendlichen während einer Pandemie?
Ich bin irritiert.
Vor Kurzem hieß es noch, die SuS seien aufgrund von coronabedingten Schulschließungen über Gebühr gestresst gewesen.
@Mary-Ellen
Liebe Mary-Ellen,
bitte sei vorsichtig, denn: Irritationen können Stressempfinden (JAWOLL: – empfinden!) verstärken … 😉 🙂
Jetzt….wo du es sagst…..OH MEIN GOOOTT!!!!…
*hektisch vor dem Gesicht rumwedel*
Aber mal im Ernst: So wie @Riesenzwerg weiter oben schrieb: “Sonst hört sich das Gelesene wie ein Träumchen an”, gefallen mir die im Artikel beschriebenen Möglichkeiten der Selbstwirksamkeit für SuS durchaus.
Leider müssten nur zahlreiche Schulen vorerst überhaupt erst mal menschenwürdig ausgestattet sein, bevor sich mit “Träumchen” loslegen lässt.
Ich bin auch irritiert 😉
Die sind inzwischen dauergestresst – und das meine ich weder verächtlich, herabwürdigend noch als Witz.
A l l e s ist ein Drama. Darunter geht nichts mehr. Die Emotionen kochen dermaßen hoch (oder sie versinken vollkommen, was auch nicht wirklich gesund ist), dass wir quasi die Hälfte der Zeit zur Bwruhigung benötigen oder weggelaufene Schülys suchen lassen müssen.
Und ich spreche nicht von denen, die kein Bock auf Unterricht haben und den mal gerade verhindern wollen.
Die Überdramatik hat deutlich zugenommen, wobei klar ist, dass sie die Situation in ihrer Intensität für sich selbst tatsächlich so wahrnehmen.
Vielleicht liegt es ja doch noch an den corona bedingten Schulschließungen (wir waren nicht zu) und wir arbeiten gerade den Nachholbedarf ab… 😉
@Riesenzwerg
1)
“A l l e s ist ein Drama. Darunter geht nichts mehr.”
Stimmt.
Beliebt ist z.B. “Ohne mein Handy sterbe ich! Ich schwör!!!”
2)
“Die Überdramatik hat deutlich zugenommen, wobei klar ist, dass sie die Situation in ihrer Intensität für sich selbst tatsächlich so wahrnehmen.”
Auch da gehe ich mit.
Rückgriff auf Punkt 1):
Ohne Handy hat dann erstaunlicher Weise doch noch jeder überlebt 😉 egal ob das Handy Zuhause vergessen wurde oder ob der Akku leer ist.
Genau aus diesem Grund schrieb ich weiter oben in der Antwort an @Mary-Ellen auch vom Stressempfinden.
Es ist ein Riesenstress,
die dauerpräsente tiktok-insta-&Co-welt verlassen zu müssen, wenn ein Riesenzwerg 😉 wissen will, wie viel Eier in den Teig müssen und zwar gleich, jetzt, ohne Vorwarnung.
Da muss der Befragte aus seiner Scheinrealität heraus…..der stressige Alltag droht….
@So ist das
“Es ist ein Riesenstress,
die dauerpräsente tiktok-insta-&Co-welt verlassen zu müssen, …”
Alternativ:
“Hör’ ich da Lieferandoooooo?!”
Die Fast-Food-Kreationen kann man – in Fast-Fashion gehüllt – dann noch rasch posten … Alles “schnellschnell”.
Da macht man sich auch nicht mal die Fingerchen klebrig. 😉
Allerdings:
Wenn man da “gnadenlos” (Huiuiui!) dranbleibt, dann bröckelt die “Star-Fassade” mancher Kids … und dann kann man buchstäblich sehen (!), wie selten einige (nicht alle, nein nein) solche “echten” Erlebnisse haben (können/dürfen).
Schade eigentlich. (Auch schade, dass so etwas wieder in den Bereich Schule “abgeturft” wird!)
Wie haben wir und die früheren Generationen nur die Zeit der Pubertät überlebt? Die meisten (und gefühlt mehr als heute) haben trotzdem ihren Schulabschluss und Ihre Ausbildung bzw. Studium geschafft. Meine Eltern und Großeltern begannen mit 14 Jahren (mitten in der Pubertät!) ihre Ausbildung.
Naja, so ganz unterschätzen darf man die Schwierigkeiten der Pupertät auch nicht.
Bei mir ging es damit so um 1982/83 los und hat sich über einige Jahre hingezogen.
Ich war orientierungslos, unglücklich verliebt und wollte um jeden Preis “cool” sein. Rauchen z.B. war “cool”. Schule war Scheiße und Lehrer waren doof. Ich besaß nicht im mindesten die Reife um einzusehen, daß ein gelingendes Leben auch stark vom schulischem Erfolg abhängig war. Ich war aber keineswegs völlig desinteressiert.
Es gab schon Themen, für die ich mich begeistern konnte. Die spielten damals aber im Unterricht nicht unbedingt eine übergeordnete Rolle. Außerdem war ich nur mit einem sehr instabilen Selbstwertgefühl ausgestattet.
Nun fielen die Jahre der Pupertät aber ausgerechnet in die Zeit, wo ich meinen Schulabschluß (Quali) machen, sowie mir darüber klar werden mußte, welchen Weg ich beruflich einschlagen möchte.
Den Quali habe ich letztlich so einigermaßen hingekriegt. Berufswahl, Ausbildung und schließlich weiterer Schulbesuch waren für mich damals jedoch begleitet von einem Gefühl der Ziellosigkeit, einem Getriebensein und Nichtwissen darüber wer ich eigentlich bin, was ich wirklich gut kann und welchen Weg ich damit beruflich beschreiten will und kann.
Das hatte gravierende Auswirkungen auf mein weiteres Leben und es hat lange gedauert, bis ich die Fehler, Mängel und Defizite meiner Jugend wieder einigermaßen ausgleichen konnte.
Trotzdem wäre ich zum damaligen Zeitpunkt, mit meinem damaligen Entwicklungsstand, meiner Unreife, nicht in der Lage gewesen anders zu handeln, auch wenn ich aus heutiger Sicht wahrscheinlich ALLES anders machen würde.
Meine Eltern hatten es damals wahrlich nicht leicht mit mir.
Sie haben sicher nicht alles richtig gemacht, aber ohne sie, vor allem ohne meine Mutter, wäre ich damals möglicherweise völlig aus der Bahn geraten.
So habe ich es immerhin gerade noch geschafft, zunächst eine (ungeliebte) Ausbildung abzuschließen und danach (mit Ach und Krach) meine Mittlere Reife nachzuholen.
Was ich damit sagen will: Pupertät verläuft bei jedem unterschiedlich.
Menschen, die, aus welchen Gründen auch immer, kein stabiles psychisches Grundgerüst haben, können in dieser Zeit wirklich den Boden unter den Füßen verlieren. Jugendliche, die dann vielleicht auch noch über kein stützendes Umfeld verfügen, finden ihn, wenn’s dumm läuft, auch nicht wieder.
Eine Schulsituation, wie sie im obigen Artikel geschildert wird, hätte mir damals vielleicht helfen können, den Weg ins Erwachsenenleben ein bißchen weniger holprig zu gestalten.
Beschwören kann ich das nicht. Aber vorstellen könnte ich es mir schon.
Vielen Dank für den Perspektivenwechsel!
Pubertät bitte. Hat nix mit Pupsen zu tun!
Und mein Opa hat mit 18 in Russland große verwüstungen angerichtet und dann noch 15 Jahre beim Wiederaufbau Russlands geholfen. Hat ihm auch nicht geschadet!
Meinem Opa schon, denn der kam schwerverletzt und völlig traumatisiert aus Stalingrad zurück.
Immerhin, er kam zurück….
Meine Großväter saßen im KZ.
Auch die waren traumatisiert.
Oh. Ich glaube doch.
Ob jemand innerlich zerbrochen ist, ist nicht immer leicht zu erkennen.
Oder ear das ironisch, sarkastisch? Mein Ironiedetektor ist verunsichert.
@Riesenzwerg
“ironisch, sarkastisch? Mein Ironiedetektor ist verunsichert.”
Mindestens 😉
… vielleicht aber auch nahezu überirdisch und darum für Riesenzwerge einfach eine Nummer zu groß – für mich aber auch, das kann ich ganz offen zugeben.
*schnüff*
@uwe ist da regelmäßig gedanklich ganz groß unterwegs, so dass mir schon mehrere Ironiedetektoren verglüht sind, also einfach mal so stehen lassen. 🙂
Klar was das ironisch, ich finde das Argument “Früher hat man uns Scheiße behandelt und das hat uns auch nicht geschadet sondern nur härter gemacht” halt nicht besonders überzeugend.
Mein Opa ist seelisch vollkommen zerstört aus dem Krieg zurückgekommen, überzeugter Nazi bis zu seinem Tod.
Ich konnte die Ironie oder sollte es Sarkasmus sein, auch nicht erkennen…..aber gut.
Und ja, bei vielen malt die Erinnerung mit güldenen Farben. Ich musste gar nicht sehr lange nachdenken, damit mir mindestens 10 Menschen aus meinem damaligen näheren Umfeld eingefallen sind, die die Pubertät nicht einfach so überstanden haben…..viele sind schulisch so dermaßen abgestürzt, dass sie die Schule verlassen haben und gerade so einen Abschluss geschafft haben und wenige sind mit Drogen und Alkohol konfrontiert auch sehr beschädigt worden…..
Das vergisst man so leicht, aber Pubertät war auch damals schwer…..zumindest für viele….
Ich habe nirgendwo behauptet, dass man uns (und die Generationen davor) Sch… behandelt hat. Nur waren die Zeiten andere und wir wurden nicht dauernd in Watte gepackt.
@potschemutschka
Sei’s drum …
Jede Generation hat so “ihr eigenes Päckchen” zu tragen.
Das lässt sich nicht kleinreden, nicht wegreden und auch nicht mit den Geschichten von Opas … ja was eigentlich? (Muss man nicht vertiefen.)
Jeder hat einen eigenen Lebensweg und damit eine eigene Sicht auf die Dinge und das Leben.
Man kann im Rückblick für positive und negative Entwicklungen von Lebenswegen Beispiele finden, innerhalb und außerhalb der eigenen Familie.
Wenn man selbst ein gewisses Alter erreicht hat – hoffentlich mit ein wenig Lebenserfahrung und auch mit kritischer Distanz zum eigenen Lebensweg in jüngeren Jahren (und vielleicht dem von Freunden aus jüngeren Jahren) – ist das meist nicht so schwer. Allerdings macht jede Generation und jedes Individuum halt auch Fehler, idealerweise die eigenen (!) Fehler und die Erkenntnis darüber ist ja auch ein Teil eines Lernprozesses und dann möglichst wieder die Motivation zu einem vertieften Lernprozess. (Nein, ich bin jetzt nicht mehr bei @uwes Nazi-Opa-Story! Ich rede von Fehlern und Lernprozessen im Allgemeinen.)
Man lernt ja dazu … wenn es gut läuft.
Heute gelernt: @uwe (mit dem kleinen “u”) und @Uwe (mit dem großen “U”) sind offensichtlich identisch. (Und unter dem Artikel https://www.news4teachers.de/2023/04/mathematische-analphabeten-wie-ein-mathe-professor-auf-youtube-mit-abiturienten-und-lehrkraeften-abrechnet/ taucht auch noch ein @UweUwe auf … Das Leben wird aber auch immer komplizierter … 😉
Richtig! Jeder hat seinen eigenen Lebensweg, macht seine eigenen Fehler und Erfahrungen. Ja, die Zeit der Pubertät ist für die meisten nicht einfach (selbst durchgemacht, bei meinen beiden Kindern erlebt und jetzt mutieren meine Enkel zu Pubertieren). Mir ging es nur darum, dieses Gejammer, dass es die heutige Jugend ja sooo schwer hat, (niemand nimmt Rücksicht und die Schule soll es wieder richten, indem man noch weniger Anforderungen stellt) zu relativieren. Um einigermaßen unbeschadet durch diese Zeit zu kommen, hilft es nicht, jedes noch so kleine Steinchen den Kindern und Jugendlichen aus dem Weg zu räumen und sie in Watte zu packen. Im Gegenteil! Sie müssen ihre eigenen Fehler machen und aus diesen lernen und ihre Grenzen testen und erkennen. Dafür brauchen sie ein stabiles Umfeld (Familie) und gute Schulen (Lehrer), aber keinen Weichspüler.
Da stimme ich ihnen zu.
Sie meinen sicherlich die Sowjetunion?
Den Unterschied Russland/Sowjetunion, sowie Rote Armee/Sowjetarmee kennen leider die wenigsten. Wird selbst in den öffentlich-rechtlichen Medien sehr oft falsch gemacht.
So ein bisschen Trauma durch aktive Teilnahme am Krieg mit 18 Jahren und anschließender Kriegsgefangenschaft bis 33 Jahren hat ihm nicht geschadet? Ich glaube, doch.
Und zwar so tief, dass weder er noch seine Familie das jemals zugeben konnten, ohne zusammenzubrechen.
Ich kannte auch solche Veteranen. Manche haben kurz vor ihrem Tod in hohem Alter plötzlich angefangen, einige wenige, grausame Details zu erzählen, aber nur kurz, als würde für einen Augenblick ein Lichtkegel im völligen Dunkel einen einzigen Punkt beleuchten. Und dann haben sie abgewunken und sehr tief weiter geschwiegen.
Und in der Küche haben die Großmütter hinter vorgehaltener Hand ebenso kurz von den Alpträumen erzählt, wegen denen er jahrelang nachts wach im Haus herum gelaufen ist.
Eine Generation, die den Schmerz so mit ins Grab genommen hat, dass ihre Nachkommen den Eindruck haben, es habe ihnen nicht geschadet.
Ich unterrichte viel lieber Pubertiere als 5. oder 6. Klassen. Da ist eben jedeR anders.