DÜSSELDORF. Ob Pisa, IQB, Iglu oder Vera – zuletzt wiesen die Ergebnisse der Bildungsstudien immer wieder auf die enormen Kompetenzdefizite der Schülerinnen und Schüler in Deutschland hin. Noch läuft die Suche nach den Ursachen und möglichen Lösungen. Einen Denkanstoß bietet unsere Gastautorin Rebekka Emersleben, Lehrerin aus NRW und nebenberuflich neurosystemische Coachin. Sie fordert in ihrem folgenden Beitrag „dringend nervensystemgerechte Bildungsmilieus“, denn nur dann seien nachhaltiges und ganzheitliches Lehren und Lernen möglich.
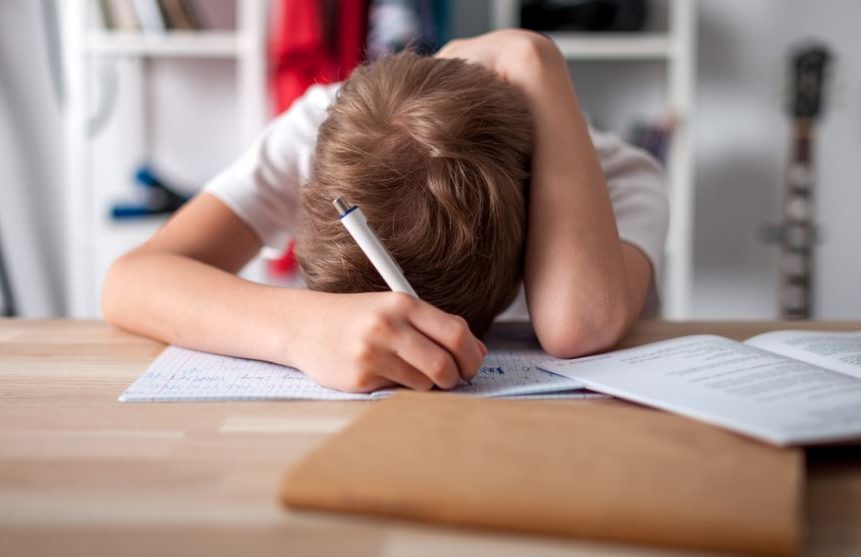
Nervensysteme am Limit – eine Bestandsaufnahme aus der Perspektive des autonomen Nervensystems
Einer ist immer schuld. Aus Sicht der PolitikerInnen sind es die Eltern, die sich entweder zu viel („Helikoptereltern“) oder zu wenig kümmern („fehlender Bildungswille“). Aus Sicht der SchülerInnen sind es die LehrerInnen oder eben die „scheiß Schule“, die ihnen das Leben unbequem machen. Eltern regen sich beispielsweise über langzeiterkrankte Lehrpersonen auf oder über „ungerechtfertigte“ Noten ihrer Kinder. Aus Sicht der Lehrkräfte sind es wahlweise die SchülerInnen, die Eltern, die PolitikerInnen oder eben das gesamte Schulsystem, die sinnvollen Unterricht verunmöglichen. Vorwürfe und Forderungen gibt es viele. Ob sie immer gerechtfertigt und sinnvoll sind, bleibt hier offen. Offensichtlich ist allerdings – zumindest aus der Perspektive des autonomen Nervensystems – der dysregulierte Zustand der Nervensysteme der verschiedenen Akteure.
„Auch bei Lehrkräften zeigt sich Dysregulation“
Augenscheinlich sind die Nervensysteme am Limit, wenn wir etwas näher in die Bildungsmilieus in Schulen und Kitas „hineinzoomen“ und uns das beobachtbare Verhalten vor Augen führen: Es gibt Kinder und Jugendliche, die sind regelmäßig „aufmüpfig“, aggressiv, respektlos oder überdreht. Sie ärgern, mobben, finden schwer zur Ruhe und sind ständig abgelenkt. Es fällt ihnen schwer, sich auf den Unterricht und andere Abläufe konzentriert einzulassen. Andere wirken desinteressiert, gelangweilt, verträumt, abwesend und meiden (Blick-)Kontakt. Ihr Blick ist leer, Bewegungen langsam und sie reagieren häufig verzögert. Wieder andere wirken hoch aufmerksam, latent angespannt, ängstlich und überangepasst. Schulabstinenz, (körperliche) Konflikte, psychische Erkrankungen und Leistungseinbußen nehmen zu.
Auch bei Lehrkräften, ErzieherInnen, SonderpädagogInnen etc. zeigt sich Dysregulation. Manche wirken gereizt, gehetzt, fahrig, angespannt, unruhig und belastet. Sie sind kurz angebunden, antworten mürrisch und wirken wie auf der Flucht: „Schnell noch kopieren. Schnell noch auf‘s Klo. Schnell noch den Elternanruf machen. Schnell noch ins Brot beißen. Schnell, schnell, schnell…“ Nicht selten fallen unsensible, sarkastische oder gar abwertende Kommentare im Unterricht und Lehrerzimmer – nicht immer hinter vorgehaltener Hand. Es wird geschimpft und Druck gemacht. Der empathische, feinfühlige und wohlwollende Umgang mit Kindern und MitarbeiterInnen bleibt auf der Strecke, wenn ein Nervensystem im Überlebensmodus ist. Nicht nur Motivationsverlust, Krankheitstage und langfristige Dienstunfähigkeit nehmen zu, sondern auch die Zahl derer, die sich diesem Milieu nicht mehr aussetzen wollen. Diese Menschen kündigen oder beantragen ihre Entlassung aus dem Beamtenverhältnis, obwohl sie doch „so gut bezahlt“ werden und „so viele Ferien“ haben.
„In diesem Zustand sind wir im Kampf- oder Fluchtmodus“
Die beschriebenen Phänomene sind Ausdruck von dysregulierten Nervensystemen, also Nervensystemen, die so gestresst sind, dass sie sich außerhalb ihres Stresstoleranzfensters (nach Daniel Siegel – window of tolerance) befinden. In diesem Zustand der Über- oder Untererregung sind wir im Kampf- oder Fluchtmodus (oder im shut down) und können schlicht nicht zugewandt und entspannt mit unserer Mitwelt in Verbindung sein.
Wenn also individuell empfundene Sicherheit fehlt (Ergebnis des unwillkürlichen Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesses unseres autonomen Nervensystems und limbischen Systems), übernimmt der Sympathikus (als Teil des autonomen Nervensystems) die Leitung, wir werden weniger empathisch, kreativ, neugierig, interessiert und flexibel, sondern eher kühl, engstirnig, ignorant und rigide. Steigt das Erregungsniveau weiter, mobilisiert das sympathische Nervensystem mehr Energie, die uns in Handlungsbereitschaft versetzt. Wir werden hypervigilant und angespannt. Häufig zeigt sich die Übererregung in Gereiztheit, Aggression, Schreckhaftigkeit, Angst- oder Panikattacken, einer erhöhten Schweißsekretion und einem erhöhten Pulsschlag sowie verminderter Speichelsekretion. Aber auch eine Vermeidungs- und Abwehrhaltung sind typisch.
Menschen, die hingegen (chronisch) untererregt sind oder die Umgebung als lebensbedrohlich wahrnehmen, auch weil sie zu lange im energieraubenden Kampf-/Fluchtmodus waren, fallen aus ihrem Stresstoleranzfenster in die Untererregung. Das ganze Körpersystem wird in einen Modus der Immobilität versetzt. Jetzt ist das Erregungsniveau so niedrig, dass Menschen sich selbst, ihre Mitmenschen und Umwelt nur noch gedämpft wahrnehmen. Die emotionale Beteiligung und das Schmerzempfinden sind stark gedrosselt. In diesem Zustand wirken wir teilnahmslos, gleichgültig, antriebslos, verträumt, lethargisch und der Blick wird leer. Wir fühlen uns emotionslos, taub, erschöpft, deplatziert und unverbunden.
„Genetisch verankerte Notfallprogramme“
Ursprünglich sind die autonomen Zustände der Über- oder Untererregung genetisch verankerte Notfallprogramme für Ausnahmesituationen, in denen unser Überleben bedroht wird. Gerade die Übererregung ist energetisch äußerst kostspielig, sodass es überflüssig ist zu sagen, dass dysregulierte Zustände auf Dauer krank machen.
Chronisch dysregulierte Nervensysteme können drastische Folgen nach sich ziehen wie psychische (z. B. Burnout/Erschöpfungsdepression, Suizidalität, Sucht) und körperliche (z. B. Hörsturz, Bluthochdruck, Reizdarm) Erkrankungen, Schulabbruch, Dienstunfähigkeit und Kündigungen.
Auch nachhaltiges und ganzheitliches Lernen wird stark erschwert, wenn Nervensysteme dysreguliert sind: der Neocortex, der für rationales und komplexes Denken zuständig ist, verliert die Kontrolle und ältere Gehirnareale (Limbisches System und Stammhirn), die für unser Überleben zuständig sind, übernehmen die Führung – das passiert unwillkürlich, wenn nicht genügend Anzeichen für Sicherheit gefunden werden, sodass Stressreaktionen ausgelöst werden. In einem Zustand der Über- oder Untererregung können eingehende Informationen nur noch vermindert oder desorganisiert kognitiv verarbeitet werden.
Vielen Bildungseinrichtungen fehlen bislang noch das nötige Wissen und die Kompetenz, sichere Bildungsmilieus zu kreieren und damit versäumen sie, die Voraussetzungen für alle Bildungsbeteiligten zu schaffen, langfristig (psychisch) gesund zu bleiben. Denn so wie Lernende leiden auch Lehrpersonen unter Milieus, die nicht ausreichend Sicherheit spenden. Lehrpersonen geraten deshalb nicht selten in einen Zustand der chronischen Übererregung: Sie sind eventuell gereizt, unsensibel, beschämend, laut, unempathisch und ungeduldig.
Das nervliche Erregungsniveau einer Lehrperson spielt eine wichtige Rolle für die empfundene Sicherheit ihrer Schützlinge. Für Lernende ist eine dysregulierte Lehrperson ein Bedrohungsfaktor, da es ihr in diesem Zustand nicht gelingen kann, eine zugewandte und wertschätzende Verbindung aufzubauen. Selbst wenn sie äußerlich ruhig bleibt, nehmen die autonomen Nervensysteme der SchülerInnen permanent und unbewusst Signale aus der Umwelt wahr und bewerten sie unwillkürlich auf ihre potenzielle Gefahr hin. Selbst kleine Veränderungen in der Tonlage, Mimik, Gestik und Körperhaltung werden registriert und haben einen großen Einfluss auf die empfundene Sicherheit. In der Konsequenz steigt dann auch das Erregungsniveau der SchülerInnen und sie zeigen gegebenenfalls Signale ihrer eigenen Übererregung, die in Wechselwirkung mit den anderen im Raum befindlichen Nervensystemen tritt.
„Die maßgeblichen Prinzipien eines nervensystemgerechten Bildungsmilieus“
Wir brauchen dringend nervensystemgerechte Bildungsmilieus, die Voraussetzungen schaffen und dazu beitragen, dass die Nervensysteme aller Beteiligten innerhalb ihres Stresstoleranzfensters bleiben, oder ermöglichen, sich wieder zu regulieren. Denn regulierte Nervensysteme sind die Basis für nachhaltigen Lernerfolg, Potenzialentfaltung, Kreativität, Neugierde, Empathie, Toleranz, Resilienz, gesunde Beziehungen und (Selbst-)Führung.
Die maßgeblichen Prinzipien – Wertschätzung und Wohlwollen, Transparenz und Augenhöhe, Ressourcenorientierung sowie Sicherheit – eines nervensystemgerechten Bildungsmilieus können in den Kategorien
- Umgebung und Ausstattung
- Haltung und soziales Miteinander
- Unterricht und Lehrmaterialien
- Selbst- und Co-Regulation realisiert werden.
Das ist eine Aufgabe für die gesamte Bildungseinrichtung, die systematisch durch Fortbildungen, Training und Coaching umgesetzt werden muss, um eine nachhaltige Veränderung für alle zu erzielen.
Mehr Informationen unter: www.bindungstierchen.de
Gefahr durch Stress im Schulalltag: Können Fortbildungen helfen?
Diagnose: stressiges Umfeld. OK, wer wollte das bestreiten – Lehrer sicherlich nicht. Aber was genau führt denn dazu, dass das Umfeld Schule so toxisch ist?
Therapie: Schwer anhand der Schlagworte zu beurteilen, inwieweit es tatsächlich um die Reduktion der Stressfaktoren (=sinnvoll) oder doch wieder mal nur um den „richtigen Umgang“ mit dem Stress gehen soll, der mir in einer Fortbildung in meiner Freizeit nahegebracht werden soll (=überflüssig).
na woanders wurden auch die Arbeitsbedingungen verbessert/in der Schule nicht seit Corona.
Haben SuS 4 Tage Woche? Haben SuS freitags und montags home office bzw. heimarbeit?
ja, und ihre Eltern schon und von Lehrkräften Freunde und Bekannte oder Familienangehörige auch.
Da sehen wir die Ungerechtigkeit und das für die Nullrunde, die hier von Realist so oft angesprochen wurde.
Schlimm und unfair
Unfair. Finde ich auch.
Ich habe nämlich nicht jedes Jahr ne Fortbildung.
Und ich habe keine 9 Wochen zur freien Verfügung, um Überstunden abzubauen oder in der Nase zu bohren.
Ich habe auch keinen Freifahrschein was Leistung angeht.
Und ebenfalls fange ich nicht jedes Jahr mit nem leeren Schreibtisch an und schere mich einen Dreck um die Versäumnisse des vergangenen Jahres.
Da sehen Sie mal, wie ungerecht die Arbeitsbedingungen verteilt sind.
Und nun??
Wir suchen noch dringend neue Kollegen…
Wenn Sie so ein “Held der Arbeit” sind, warum machen Sie sich nicht einfach selbständig um den “ungerechten” Arbeitsbedinungen zu entkommen und kassieren so richtig ab?
Neue sind dringend gesucht. Da Sie scheinbar zur Kategorie der “krassen Wirtschaftsmacker” gehören hier ein Grundkurs BWL:
“9 Wochen Nasebohren” wären monetär grob zwei Monate voll bezahlte Freizeit pro 12 Monate.
Da wird ein knallhart kalkulierender BWL-Justus wohl sofort dem homo-eco-dingens-Modell folgen – und Lehrer werden.
Das Schulwesen wartet auf Sie.
Deal?
Ach…wieso denn nicht?
Weil Sie doch selbst wissen, dass Sie kompletten Unfug reden.
In Deutschland ist die Berufswahl frei.
Dann machen Sie doch (so wie wir) einfach mal mehr Überstunden: dann können Sie die auch abbauen. Ob Sie dabei in der Nase bohren, bleibt ganz Ihnen allein überlassen.
Sie haben keine Fortbildung? Ja dann kümmern Sie sich! Ihr AG kann Ihnen ja nicht verbieten, sich so wie wir außerhalb Ihrer Arbeitsplatz – Arbeitszeit fortzubilden.
Den Teil mit dem leeren Schreibtisch verstehe ich nicht: glauben Sie, wir wechseln jedes Schuljahr alle Klassen durch?
Sie würden sich 9 Wochen lang in der Nase bohren???
Zu mehr reicht sie nicht, die Fantasie.
… wie kommen Sie auf 9 Wochen?
Ich habe immert 13 Wochen lang gebohrt – außer an den 28 Tagen, die ich Tarifurlaub hatte und den gesetzlichen Feiertagen, die in die unterrichtsfreie Zeit gefallen sind sowie den Wochenenden.
Wenn Sie nach 9 Wochen aufhören, heißt das, da kommt nix Substantielles mehr:)
Der Urlaub ist Ihnen auch gegönnt!
Sie könnten jedoch jedes Jahr ne’ Fortbildung machen. Wer hält Sie davon ab? Bei mir/uns sind Fobis verpflichtend. Die meisten Fobis von mir sind auch außerhalb der Unterrichtszeit (“Freizeit”). Wenn es gar nicht anders geht und die Fobi bspw. von Schulseite intern und verpflichtend in meine Unterrichtszeit fällt, dann ist das halt so. Hat aber dann natürlich nicht unbedingt (nur) Vorteile ….
Überstunden aufbauen, um Überstunden abzubauen. Leichte Mathematik (eigentlich). Genügend aus meinem Freundeskreis (Ingenieure/ITler/Leiter) haben genug Überstunden … Auch dort ist eben Fachkräftemangel und es gibt eigene/betriebliche Fristen. Im Urlaub wird dort allerdings dann auch nicht gearbeitet und sind weitgehend frei wählbar zur Verfügung.
Leistung ist vom Betrieb (Führungsebene) und v. A. von einem selbst abhängig. So ziemlich egal bei welchem Beruf. Sooo schwer ist es nicht bei einigen Berufen einen auf “chillig” zu machen. Und ja, ich habe nicht nur als Lehrkraft bisher gearbeitet. Den Arbeitseifer, welchen Sie hier “in der Wirtschaft” darstellen ist jetzt nicht unbedingt überall Realität.
“Und ebenfalls fange ich nicht jedes Jahr mit nem leeren Schreibtisch an”
Dann sollten Sie vielleicht effektiver (und mehr) Arbeiten. Positiv: Sie hätten dann auch Überstunden, wahlweise um Nase zu bohren und/oder Fortbildungen zu besuchen. [Nehmen Sie es mit Humor. Ihren Beitrag nehme ich nämlich ebenso mit Humor.]
“und schere mich einen Dreck um die Versäumnisse des vergangenen Jahres.”
Gibt es natürlich in der Wirtschaft gar nicht. Dort bekommen die “Clienten/Kunden” auch sofort alles und total unproblematisch. Sieht man bei Sanitär, Baubereich, Schreinerei, Gesundheitswesen, Psychologen, Pflege, Ressourcen/Materialien (Eisen/Stahl/Holz usw.) usw. usf. Alles ohne ewige Termine und fristgerecht. Dazu zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten. Politiker schieben auch nie Sachen auf. Kennt man doch. Die gute Wirtschaft.
“Zwei mal drei macht vier,
widewidewitt und drei macht neune,
ich mach mir die Welt,
widewide wie sie mir gefällt.”
Ja, Sie haben mich: Das war schon etwas ironisch/sarkastisch.
“Da sehen Sie mal, wie ungerecht die Arbeitsbedingungen verteilt sind.”
Echt mal – allen gezeigt. So realitätsnah. Wären Sie nur an der Schule … Das wäre doch mal was. Woran liegt es? Solchen Traumberuf mit derzeitigen Arbeitsbedingungen nicht zu bereichern? Berufliche Wahlfreiheit. Einstiegsbedingungen so einfach wie möglich. “Lehrer kann jeder!” Verbeamtung obendrauf. Easy Job. Fortbildungen (meist) gratis.
Sie wären schon ziemlich bescheu…, wenn Sie die Chance nicht nutzen – oder?
“Den Arbeitseifer, welchen Sie hier „in der Wirtschaft“ darstellen ist jetzt nicht unbedingt überall Realität.”
Da gebe ich Ihnen vollens Recht. Aber in der Ebene, mit der sich die werte Lehrerschaft so gerne vergleicht wird erwartet, dass Leistung geliefert wird. Ansonsten ist sehr schnell Schicht im Schacht.
Ich habe den Eindruck, dass Lehrer sehr gerne aus den Augen verlieren, dass andere Professionen – egal wie hoch dotiert – als Alternative NULL Einkommen haben.
Ich sage auch nicht “Lehrer kann jeder”. Aber die, die es können, sollen es bitte auch machen.
Die Kommentare hier strotzen nur so von Selbstbeschäftigung und Aufblähen von Nebentätigkeiten, dass es als Außenstehender unerträglich ist. Und wären Eltern nur Außenstehende, wäre es vielleicht auch in Ordnung. Aber jeder hat das Ansinnen, dass die Kinder in die Schule gehen, um etwas zu lernen und die Zeit, die sie in der Schule verbringen auch Sinnvoll nutzen können. Aber das ist nicht der Fall. Und es nervt auch gewaltig, dass sich Lehrer komplett dagegen wehren, zur Kenntnis zu nehmen, dass sie eine Außenwirkung haben und dass es das Recht von allen ist, diese Wahrnehmung rückzumelden.
Auch der Handwerker bekommt eine Rückmeldung, wenn er statt Fliesen zu verlegen die Etiketten vom Fliesenkleber abzieht und an die Wände klebt. Da ist es egal, ob sich das Etikett gut ablösen läßt oder die Schrift eine Norm erfüllt oder ob der Zahnarzt mehr verdient. Wenn die Fliesen nicht verlegt sind wird der Kunde nicht zahlen. Und der Fliesenlegerbetrieb wird sich gut überlegen, ob er diesen Fliesenleger weiter beschäftigt. Fachkräftemangel hin oder her.
Und ich finde es bemerkenswert, dass sich Lehrer beim Einkommen gerne mit Juristen, Ärzten, … vergleichen. Aber wenn es um die Verlässlichkeit, die Qualität oder die Leistung geht, werden gerne Sachbearbeiter, Handwerker und Pfleger als Vergleich herangezogen.
Und genau das ist der Eindruck, den die ganze Lehrerschaft vermittelt: ja keine Verantwortung übernehmen wollen, auf Einhaltung der Arbeitszeit pochen (wohl wissend, dass ohne Überstunden das Konstrukt “Ferien” gar nicht aufrecht zu erhalten ist) und klagen, dass sie viel zu wenig verdienen. Lange studieren, um dann einen Job ohne Verantwortung zu haben und sich auf Regularien zurückziehen, das ist wahrlich nicht jedermanns Sache. Das kann aber der Grund sein, warum ein bestimmter Menschenschlag Lehrer wird.
Keine Ahnung, völlig abgedrehte Vorurteile – und davon jede Menge.
Ich bitte um Nachsicht: Sie haben vom Lehrerberuf so viel Ahnung wie ein Chinese von einer fränkischen Dorfkirchweih. Und noch etwas: Ich vermute, Ihre Schulzeit war eine sehr schöne Zeit in Ihrem Leben.
@Mokka, machen Sie doch gern mal ein, sagen wir, zweiwöchiges Praktikum an einer/der Schule Ihrer Kinder.
Dieser Perspektivwechsel könnte bewirken, dass Sie die Arbeit der Lehrkräfte doch etwas wertschätzender beurteilen würden – vorsichtig ausgedrückt.
Wir hatten vor ein paar Jahren einen Schüler mit einer ähnlich mäkeligen Mutter.
Für das Studium eines sozialen Berufes absolvierte sie sodann ein zweiwöchiges Praktikum an unserer Schule.
Zu dessen Ende hatte sich ihre negative Einstellung um 180° gedreht: Sie hätte nie gedacht, wie engagiert und fürsorglich das gesamte Schulpersonal handeln würde und vor allem, wie hoch auch die allgemeine Arbeitsbelastung sei!
Für ihr ursprüngliches Urteil würde sie sich inzwischen sehr schämen….
Traumatische Schulzeit gehabt, richtig? Kann man therapieren…
Welcher Schreibtisch? (Ich hab jedenfalls keinen am Arbeitsplatz.)
Ach, Sie korrigieren/planen/… auf dem Sofa?
Sehr interessant!
Wenn ich mir das nicht alles selbst kaufe, dann ja. Wenn ich mir keine Arbeitszimmer leisten kann, dann auch. Nur mal so zur Info: Es kommt keiner vom Shculamt und guckt, wie er einem zu Hause einen Arbeitsplatz heimelig einrichten kann und Geld dafür gibt es auch nicht. Auch nicht für Drucker, Druckerpatronen, Stifte, Programme die man zum Arbeiten gebrauchen könnte, gute Laptops o.ä., Stifte fürs Tablet (so man eins gestellt bekommt). Das ist alles Privatvergnügen. So viel dazu.
Und zu dem Rest sage ich mal nichts. Sie hatten wahrscheinlich eine miese Schulzeit und gehen deswegen hier auf alle los. Wenn man so andere Menschen angeht und runterputzt und über einen Kamm schert, muss man sich nicht wundern, dass man evtl. ein ähnliches Echo bekommt. Wenn mir jemand in der Shcule so gegenübertritt (und ja, das tun Eltern leider öfter), brauchen wir gar nicht in das Gespräch gehen. Dann geht es idR nämlich gar nicht um das Wohl den Kindes, sondern nur darum, sich selbst mal richtig schön auskotzen zu können und seinen Frust am Lehrpersonal abzubauen.
Zum Thema Ferien wurde ja schon was gesagt, wenn die Ferein tatsächlich Ferien wären, dann wären Überstunden in der Schulzeit echt okay. Da würde keiner etwas sagen. Allerdings sind die Ferien (ähnlich wie an der Uni die vorlesungsfreie Zeit, da gibt es übrigens auch Seminare und Klausuren und Hausarbeiten zu erledigen) nur schulfreie Zeit aber keine arbeitsfreie Zeit. Ich sitz zwar nicht in der Klasse, aber zu Hause liegen Klausuren und Hefter, Unterricht muss vorbreitet werden etc. das schafft man nämlich trotz Überstunden in der Schulzeit meistens nicht (evtl die Sport-LuL ohne Korrekturen?), schon gar nicht mit Oberstufenunterricht.
Und weiterhin: Ich fände es mal richtig toll anspruchsvollen Unterricht zu machen und den Kids richig, richtig viel beizubringen. Ist halt leider oft a) nicht erwünscht, weil anstrengend oder b) nicht möglich, weil es schon z.B. am Lesen scheitert oder c) weil eingei der SuS keine Lust haben und deshalb auch den anderen den Unterricht mies machen. Wann immer es eine Lerngruppe gibt, die mal so richtig Gas geben will, bin ich der erste, der in die Luft hüpft und überlegt, was man den Kindern bieten kann.
Vielleicht gehen Sie zur Abwechslung mal auf die Eltern los, die ihre Kinder nicht zur Bidlung anhalten, oder auf Schulleitungen, denen es nur um die Außenwirkung bei den nächsten Abischnitten geht (Stichwort: Noteninflation im 1,x Notenbereich) oder gehen Sie ne Runde auf die Kultusminister los, mit ihren oft sehr zauberhaften aber nicht umsetzbaren Ideen. Wie war das noch: WIr sind hier nicht bei wünsch dir was , sondern bei so isses. Ich kann mit viel Geduld und liebe Enteneier bebrüten, es wird eben am Ende dann ne tolle Ente aber niemals ein Schwan. Und zu sagen, dass ich schlecht gebrütet habe, weil leider nur ne tolle Ente geworden ist, ist doch absurd, Aber genau so wird es gemacht. Und falls Sie aufmerksam hier gelesen haben, dann werden Sie feststellen, dass es vielen nicht primär um das Gehalt geht, sondern eher um Ressourcen und Arbeitsbedingungen die am Ende ja auch den Kindern nützlich sind. Kleine Klassen, weniger gehetzte LuL, bessere Ausstattung, größere Räume, die nutzen doch alles wasa. Als würden das LuL nur machen, weil sie es dann hübscher hätten.
Ich glaube, dass ein Problem ist, dass es weder DIE Lehrer noch DIE Eltern gibt. Ich finde daher, dass niemand auf irgendwen los gehen sollte. Tatsache ist, dass man als Nichtlehrer schlecht den Arbeitsalltag von Lehrern beurteilen kann. Allerdings können die meisten Lehrer auch nicht den Arbeitsalltag anderer Berufe beurteilen. Ich meine damit bestimmt nicht Sie, aber in diesem Forum melden sich einige ihrer Kollegen in einer Wortwahl, die sicherlich nicht unbedingt bei der Normalbevölkerung einen guten Eindruck vermitteln, ob subjektiv berechtigt oder nicht. Ich persönlich finde es schlicht unangemessen Lehrer, von denen die Mehrzahl einen guten und wichtigen Dienst an unseren Kindern und damit unserer Gesellschaft verrichten, pauschal zu kritisieren. Vorallem , weil es neben wenigen Negativbeispielen, viele sehr engagierte Lehrer gibt. Ich würde mir aber auch manchmal weniger Pauschalisierung von Seiten der Lehrer wünschen und auch ein wenig Verständnis für Kritik, insofern sie in angemessenem Ton vorgebracht wird. Vielleicht führt das dazu, dass Lehrern auch mehr Verständnis entgegen gebracht wird.
Ich denke nämlich, dass auch die Mehrzahl der Eltern unkompliziert sind und ein positives Bild der jeweiligen Lehrer ihrer Kinder haben. Zumindest ist das bei mir der Fall.
Der “Arbeitsplatz” im Lehrerzimmer hat durchschnittlich 100 x 80 oder 90 cm, dazu 1 Regalmeter und 1 kleines Schließfach – auf dieser Basis sollen bis zu 120 SuS pro Arbeitstag verwaltet werden? JEder A-12-/A-13 “Sitzbeamte” in irgendeinem Amt hat da reichlich bessere Arbeitsgrundlagen – auf jeden Fall Schreibtisch, PC, Regale usw. usw.
Also, liebe(r) Mokka, werden Sie bitte hier nicht komisch.
Sie haben ein Schließfach und einen Meter Regalfläche? Ich bin neidisch!!
Vor allen vermutlich auch noch einen festen Sitzplatz, Sachen gibt’s!
Ich kenne Kollegien, da wird in jeder Pause “Reise nach Jerusalem” gespielt. Wer keinen Sitzplatz hat, hat halt Pech gehabt.
Haben wir auch….jeder Kollege hat sogar mit seinem Team einen Vorbereitungsraum mit Schränken und so….
Vielleicht sogar mit Schreibtischen? Ich bin beeindruckt. Nee, haben wir nicht. Wir haben ne Abstellkammer für die Bücher und so, und ne Sammlung für die Physik, aber da mag man nicht arbeiten.
Ich fordere vernünftige Arbeitsplätze für alle an den Schulen.
Ich sprach von meinem Arbeitsplatz in der Schule, und das haben Sie ganz sicher auch verstanden, nicht von meinem heimischen Arbeitsplatz. (Und selbst der ist auch über die Sommerferien nie leer, einfach schon deshalb, weil ich nichts in der Schule lassen darf, mal ganz davon abgesehen, und außerdem das Material ein- und umsortieren muss, aufbereiten, was auch immer…).
@Ramon
Danke für den Lacher.
Vielleicht verstehen Sie das hier?
https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad/yt-traumjob-lehrer-100.html
Das könnte IHR Platz werden, denn dieser Schreibtisch ist jetzt leer …
Wieso “könnte”? Der Konjunktiv wird ja auch total überschätzt.
Leute, die nächste Folge kommt dann bald: “Ramon, der Retter“. 😉
Danke für den Link, eine wirklich sehenswerte Dokumentation
Jepp…sehe ich genau so!!… lieber Pit…
Der nächste Bundesverdienstorden ist quasi abonniert…Ramon, der Große räumt ihn konkurrenzlos ab.
“Ramon, ich will ein Kind von dir!”
…das ist der Satz, der in der Bild steht….bevor es von Ramons Seite tönt:
“Holt mich hier raus – ich bin ein Star!”
Triple-R:
Ramon rettet Realschule.
(Oder Alliteration für alle, die es gerne klassisch haben)
“Ref ist belastend und macht mehr Arbeit als gedacht“.
OK, und wo ist da jetzt der Neuigkeitswert?
Habe ich mir angeschaut. Zielgruppe ist doch hier eher die Nicht-Lehrerschaft.
Eben Leute wie Retter-Ramon.
Und nun?
Nun wäre es an der Zeit, dass Sie mal richtig Arbeiten gehen.
Beispielsweise in einer Schule.
Ärzte fordern z.B. aktuell 12,5% + höhere Zuschläge für Nacht-, Feiertags- und Wochenendarbeit + bessere Arbeitsbedingungen.
1-2 Tage Schule von zuhause ist doch voll ok.
Bin ich trotzdem nch 3 Tage da.
Pa ist auch zuhause im homeoffice und schläft immer aus.
@Paul
Wo ist Ma? Schläft die zusammen mit Pa im homeoffice? 😉
Es gibt sicher genug Aspekte, die am Lehrerberuf verbessert werden könnten.
Homeoffice ist in diesem Zusammenhang aber einfach lächerlich. Wenn HomeOffice für Erzieher möglich wird, dann auch für Lehrer.
Das stimmt. Homeoffice ist nicht das richtige Argument und Homeoffice geht für andere Berufsgruppen ebenfalls nicht. Das Geschrei nach Homeoffice übertönt nur das, was wirklcih geändert werden sollte und ist unnötig. AUßerdem ergäbe sich ein Tag Homeoffice von selbst, wenn man ein niedrigeres Deputat hätte und nur 4 Tage im Untericht wäre, weil man 20 Stunden auch auf 4 Tage verteilen könnte. Hätten eben alle LuL an einem anderen Tag frei, muss man flexibel sein (Konferenzen gibt es dann eben online). In anderen Branchen ist Homeoffice auch flexibel zu sehen, wenn es die Firma erfordert muss man eben mal hin.
Ich denke, diese Forderung sollten man echt sein lassen, das macht es nicht besser und schadet der Umsetzung anderer Forderungen nur.
An Umgebung (kleine Schüler*innenschaft auf großzügigem und lerndienlich gestaltetem Raum, schönes Außengelände …) und Ausstattung (Ruheräume, extra Arbeitsräume – mit angemessenem Arbeitsgerät für L*L sowie S*S etc.) können die Bildungseinrichtungen selbst schon einmal nichts ändern.
Haltung und soziales Miteinander hängt sehr stark vom Hintergrund der Schüler*innenschaft ab. Und wenn das Lehroersonal bereits am Stock geht, ist die Haltung vorgegeben.
Bitte übernehmen …
Sehr interessant! Während ich den Artikel las, fielen mir spontan drei Kolleginnen ein, die seit geraumer Zeit gehetzt wirken und agieren, denen zunehmend die Empathie fehlt, die genervt über ihre Schüler berichten, die aber auch eine zunehmende Anzahl von problematischen Schülerverhalten verzeichnen.
Ich überlege tatsächlich, ob sich zu diesem Thema nicht eine ganztägige schiLf lohnt…..
Wohl eher eine ganzjährige schiSchF (schulinterne Schülerfortbildung).
Wir dürfen laut Schulamt ganztägige SchilF nur noch in den Ferien machen…
Wir haben zwei im Schuljahr zur Verfügung, letztes Schuljahr drei, wenn einer für Digitalisierung genutzt wurde….NRW
Ja klar, SchilF sollen wir auch machen, aber bitte in der unterrichtsfreien Zeit (die eigentlich zum Korrigieren und Überstundenabbau dienen soll).
Was ich mich frage: die von Ihnen angesprochenen Kollegen zeigen deutliche Anzeigen von Überlastung, und es handelt sich gleich um mehrere Kollegen, was auf ein strukturelles Problem hindeutet. Und Ihnen fällt dazu echt nur ein: dann machen wir eine Fortbildung „besserer Umgang mit Stress“? Es geht hier wohl kaum um Symptombekämpfung, eher sollten gerade die Schulleiter sich für ihre Lehrkräfte stark machen und die systemisch bedingte Überforderung der Lehrkräfte zu bekämpfen! Das ist allerdings ein altbekanntes Vorgehen: überlaste Deine Untergebenen, indem Du ihnen immer mehr zu tun aufgibst, und wenn sie unter der Last stöhnen, gib ihnen gute Ratschläge, wie sie mit Achtsamkeit und Yoga die Symptome der Überforderung wegignorieren können und bessere Lastenträger werden, denen man noch mehr überhelfen kann. Immer fein davon ablenken, dass es das Arbeitspensum ist, welches zur Überlastung führt. Würde man das anerkennen, müsste man das Arbeitspensum ja reduzieren, und das geht ja garnicht!
Welche Entlastung schwebt Ihnen denn vor? 4 Tage Woche bei vollem Deputat und an weiteren Tagen Homeoffice?
Was konkret ist es also, was Sie von Ihrer Schulleitung fordern?
Eine Schulleitung kann nicht:
– etwas an Ihrer Unterrichtsverpflichtung ändern,
– etwas an der allgemeinen Dienstordnung ändern,
– etwas an Vorgaben und Erlassen ändern,
– etwas am Schuletat ändern,
– etwas an Ihrer privaten Situation ändern,
– weitere Urlaubstage zur Verfügung stellen,….
Eine Schulleitung kann:
– den Stundenplan so gestalten, dass er keine unnötigen Springstunden enthält,
– durch sorgsame Schulorganisation Teamteaching in Kernstunden und schwierigen Stunden ermöglichen,
– Teilzeitkollegen weniger außerunterrichtliche Aufgaben übernehmen lassen,
– Teilzeitkollegen Freikarten zur Verfügung stellen, um nicht an jeder Konferenz teilnehmen zu müssen,
– Konferenzen online stattfinden lassen
– dafür sorgen, dass Kollegen niemals in schwierigen Situationen alleine gelassen werden,
– Ansprechpartner sein,
– ein waches Auge auf etwaige Überlastung haben,
– geräuschlos im Hintergrund alles „wegräumen“, um die Kolleginnen nicht noch mehr Aufgaben erledigen zu lassen,
– …..
Und ja, im Rahmen von konzeptioneller Schulentwicklung kann das oben vorgestellte Coaching eine sinnvolle Maßnahme sein über die eigene Belastung nachzudenken, sie wahrzunehmen und Startegien zu entwickeln, aus diesem Teufelskreis herauszukommen….
Ich glaube sehr, dass das weit entfernt von Yoga ist…..
Ich würde mir von meiner dem Kollegium wirklich wohlgesonnen Schulleitung wünschen, dass sie sich mit anderen Schulleitungen zusammentut. Es gibt doch regelmäßig Sitzungen, wo man zusammenkommt und sich organisieren könnte.
Ich habe meine Schulleitung mal gefragt, wer denn eigentlich dem Ministry meldet, dass z.B. Inklusion so, wie sie gemacht werden muss, nicht funktioniert. Die Antwort war erstaunlich: Das wisse man nicht. Es gibt so einige Punkte, die mich da sehr wundern.
Mir kommt es leider so vor, als würden Schulleitungen immer zu sehr auf den Ruf ihrer Schulen bedacht sein und deshalb lieber die Füße stillhalten.
Vor einigen Monaten saßen alle Grund- und Förderschulschulleiter mit den Schulaufsichten zusammen und haben zusammengetragen, was alles nicht funktioniert. Die völlige Überlastung aller Systeme wurde da deutlich.
Und die Lösung ist….tataaa…..es werden AoSF-Verfahren verschleppt…..wo kein Förderbedarf festgestellt wird, muss auch nicht gehandelt werden….
Wir haben gemeinschaftlich abgekotzt! Aber wir an der untersten Front sind da tatsächlich ziemlich machtbefreit….eine kleine Remonstration wird da nichts helfen….
Aber ändern wird sich erst etwas, wenn wirklich gar nichts mehr geht….und darauf steuern wir zu!
Das passt original ins System! DANKE!!
In den 60er/70er Jahren, als ich als S hüler im GYM “fronte”, war ganz klar:
Als Lk am GYM 1980-2015:
Elterngespräche im 10-Minuten-Takt -wie sich die Zeiten ändern!
Heute am Gym:
Lehrerkonferenzen/Dienstberatungen monatlich (meine SL steht auf Dienstberatungen, und rechtlich kommt man nicht dagegen an) ab 15.45 Uhr nach Unterrichtsschluss, ebenso Notenkonferenzen, Dauer jeweils mindestens 1,5h.
Elternsprechtage nach Ende des eigenen Unterrichts, Open End.
Bei uns gibts Konferenzen alle 2 Wochen, jeweils 2 Stunden…
Symptome oder Ursachen bekämpfen. Überlegen Sie selbst.
Spoiler/Nach Überlegung mein Tipp:
Es ist oft das “und” statt das “oder”:
– Symptome kurzfristig
– Ursachen langfristig
So wirkt es auch: Fobi bringt kurz etwas und nur in dem Bereich. [Wie Medikamente]
Ursachen (weniger Bürokratie/Arbeitsbelastung usw.) wirkt präventiv und effektiver [wie Therapie]. Dazu langfristiger.
In der Medizin/Psychologie greift man auf beides zurück. Erfolgreicher ist jedoch langfristig (immer) die Therapie.
Sehe ich deutlich anders….
Coachings und Fortbildungen – auch und gerade Eintäger – bringen eine ganze Menge und können, wenn sie konzeptionell eingebettet sind, sehr nachhaltig etwas bewirken.
Nennt sich Schulentwicklung oder anders ausgedrückt, kann man sagen, dass es die Arbeit an Baustellen ist.
Ich gebe Ihnen nur dann eingeschränkt recht, wenn Fortbildungen und coachings nicht eingebettet sind, sondern nur irgendwie stattfinden, alleine stehend, ohne Sinn, ohne Anknüpfung, einfach weil es sich gut anhört, weil das interessant und nett ist.
Bei uns würde sich die oben genannte Fortbildung in die Weiterentwicklung des Classroommangements einfügen, passend auch zu Gesunde Schule, aber auch zu Regeln und Konsequenzen….an allem arbeiten wir seit vielen Jahren…..
Gesunde Schule… was tun Sie denn als SL ganz konkret, um Ihre Kollegen zu entlasten? Ich meine tatsächliche Entlastung, nicht Fortbildung im Bereich Achtsamkeit und Yoga mit dem Ziel, Symptome der Überforderung wegzuignorieren. Gesund sein bedeutet neben körperlicher Gesundheit (haben alle Ihre Lehrkräfte Arbeitsplätze, die den Vorgaben des Arbeitsschutzes entsprechen, z.B. in Bezug auf Ergonomie und Lautstärke? Halten Sie die Arbeitszeitgesetze auf Fahrten ein, indem Sie genügend Lehrkräfte zur Begleitung einsetzen, dass der 8-Stunden-Tag pro Lehrkraft nicht überschritten wird? Müssen Ihre Lehrer weniger Stunden unterrichten, da die diversen Arbeitszeitstudien für Lehrer erwiesen habe, dass Lehrer z.T sehr deutlich mehr arbeiten müssen als ihre arbeitsvertragliche Verpflichtung vorsieht, was logischerweise zur Überlastung führt?) auch psychische Gesundheit, und Lehrer sind durch den ständigen hochaufmerksamkeitsfordernden Kontakt mit Menschen extrem gefordert. Inwiefern bieten Sie Ihren Kollegen Supervision innerhalb der Arbeitszeit an, um im Rahmen der Psychohygiene mit belastenden Situationen umgehen zu können? Inwiefern achten Sie darauf, dass Kollegen genug Freiraum zur Erholung haben?
Mir ist bewusst, dass SL nur wenig Spielräume hat. Was Sie hier aber propagieren, dass Überlastungssymptome mit der richtigen Fortbildung behebbar sind und damit die Verantwortung der Überlastung dem Überlasteten selbst zuschieben, ist leider oft gesehenes Verhalten von Schulleitung.
„Gesunde Schule… was tun Sie denn als SL ganz konkret, um Ihre Kollegen zu entlasten?“
Wir organisieren den Schulalltag so, dass möglichst niemand überlastet wird, das schließt die Schulleitung ausdrücklich mit ein.
Sie tun so, als wenn man als Schulleitung in seinem Kämmerchen sitzt und sich tolle Sachen ausdenkt, wie man die Kollegen noch weiter quälen kann.
„Inwiefern bieten Sie Ihren Kollegen Supervision innerhalb der Arbeitszeit an, um im Rahmen der Psychohygiene mit belastenden Situationen umgehen zu können?“
Tatsächlich bieten wir das an….tatsächlich auch während der Unterrichtszeit . Wenn nötig verabreden wir mit unserer Schulpsychologin oder einem Coach von außen auch Termine während der Unterrichtszeit…..immer auch mit Blick darauf, dass nicht die anderen Kollegen plötzlich über Gebühr belastet werden….die Devise heißt dann: auflösen von Doppelbesetzungen….
Kollegiale Fallbesprechungen finden in der Regel während der Unterrichtszeit statt, aber auch hier muss genau auf den Stundenplan geguckt werden….siehe oben….
Inwiefern achten Sie darauf, dass Kollegen genug Freiraum zur Erholung haben?
– Keine Kommunikation am Wochenende, keine Kommunikation nach 16 Uhr unter der Woche. Ausnahmen bestätigen die Regel bei sehr dringlichen Angelegenheiten.
– Online Konferenzen
– Online Schulpflegschaftssitzungen und Schulkonferenzen
– keine Übernachtungen im Schulgebäude (für solche Lesenächte oder so)
– Jahresgespräche zur Planung des nächsten Schuljahres (was mich stundenmäßig echt viieeellll Zeit kostet) und für ein persönliches berufliches Gespräch.
– Ablehnung von irgendwelchen Treffen mit außerschulischen Partnern außerhalb der allgemeinen Arbeitszeit (z.B. Treffen mit der Kita nach 16 Uhr, oder stadtteilkonferenz ab 18 Uhr…)
– Freizeitausgleich nach besonders aufwändigen Aktivitäten (z.B. Teilzeitkräfte bekommen nach dem Zirkusprojekt je nach Überstundenzahl 1 bis 2 Tage als Ausgleich….
…..
Sie scheinen die rühmliche Ausnahme zu sein, die sich um das Wohlergehen ihrer Anvertrauten bemüht. Ich finde es weiterhin befremdlich, auf Anzeichen systemischer bedingter Überforderung mit „Fortbildung zur Resilienzstärkung“ zu reagieren.
Nein, wir sind nicht die Ausnahme! Wir (meinen Ko und ich und die Kolleginnen) tun das, weil wir unseren Job wirklich mit Herzblut machen….ich liebe meinen Job, ich bin gerne da, ich will was bewegen, ich arbeite super gerne mit meinen Kolleginnen zusammen, ich mag das einfach…..und ich mache mir Sorgen, wenn ich sehe, dass Kolleginnen immer weniger werden und nicht mehr können.
Und ja, man muss in unserem Job wirklich resilient sein, aber das stellt man ja erst im Laufe seines Berufslebens fest, wie es um sich selber bestellt ist.
Es schadet also nicht, wenn man Resilienz stärkt und dann entsprechende coachings bucht….
Und ein letztes….unsere Systeme unterscheiden sich da schon. Sie arbeiten im einem großen System mit schätzungsweise rund 100 Kollegen….ich mit knapp 20 und noch mal die Anzahl von OGS Kräften plus Hausmeister, Küchenkräften und Putzdamen. Alle kennen sich und wissen etwas übereinander. Ich kenne z.B. wirklich alle und weiß viel über den backround….von allen…..ich kann also ganz anders agieren, als ein SL eines großen Systems…..
Dann wäre das allerdings keine ganztägige SchiLF, sondern eine jährliche ganztägige SchiLF mit Konzeption der Weiterentwicklung in dem Bereich. Das kann durchaus sinnvoll sein.
Ergänzend zur Ursachenbekämpfung.
Das ist dann wie die medizinische jährliche “Impfung” für xy (Schnupfen/Covid usw.).
– Einmalige Fobi -> Oft eher kurzfristige Hilfe, wenn sinnvolle Fobi (ansonsten nichtmal das, außer Zeitverschwendung)
– Jährliche SchiLF -> Weiterentwicklung und/durch Konzept, allerdings auf Deputat achten und sinnvoll gestalten – ansonsten ggf. Demotivation (Zeitverschwendung)
– Ursachenbekämpfung -> Bessere Rahmenbedingungen, eigentlich (nahezu) immer sinnvoll. Oft scheitert es an Mittel und/oder Bürokratie.
Wenn solche SchiLF die Ursachen auch angeht … Dann ist das gut und sinnvoll. Dann geht man somit mehrere Bereiche an.
Weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das anders sehen kann… Anders verstehen, okay. Dann liegt es vielleicht an meiner Formulierung. Aber anders sehen, wenn man versteht, was ich meine? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wenn Sie eine gute Schulleitung sind. Wovon ich von Ihren Beiträgen und Empfinden mal ausgehe.
Das müssten Sie dann schon mehr begründen, damit ich das verstehe.
Es ist nicht ganz einfach, sich verständlich auszudrücken….vermutlich reden/schreiben wir aneinander vorbei….
Also nochmal:
Punktuelle, einmalige und nicht in die Schulentwicklung eingebettete SchiLfs bringen natürlich nichts. Sie sind nicht nachhaltig sondern tatsächlich Zeitverschwendung.
Wenn aber das Thema der SchiLf inhaltlich eingebettet ist und einen weiteren Aspekt zum Größeren Ganzen hinzufügt, dann kann das durchaus sehr nachhaltig sein.
Beispiel: Ein immerwährendes Thema, das die Kolleginnen umtreibt, ist der Umgang mit schwierigen Schüler. Das Thema war vor einigen Jahren so groß, dass wir beschlossen haben, dieses Problem sehr strategisch anzugehen. Es rückte also auf Platz 1 unserer Schulentwicklungsplanung. Die Analyse des Ist-Zustandes ergab dann, dass es an Strukturen mangelt, an fehlenden Absprachen, an gemeinsamen verbindlichen Regeln, an zu unterschiedlichen Herangehensweisen, an zu unterschiedlichen Konsequenzen,…..
Die Steuergruppe wurde beauftragt, sinnvolle Maßnahmen zu finden und zu koordinieren, um mit dem Kollegium daran zu arbeiten.
Es wurde also beschlossen eine Fortbildungsreihe zu den Themen Classroommanagement und Regeln und Konsequenzen zu planen, um konzeptionell dann daran zu arbeiten. Über einen Zeitraum von 2 Jahren wurden also die SchiLfs genutzt, um sinnvolle und tragfähige Konzepte zum Classroommangement, zu gemeinsamen Schultegeln, zu gemeinsam verabredeten Maßnahmen und Konsequenzen zu entwickeln.
Den vorläufigen Schlusspunkt setzte dann eine eintägige Fobi (jetzt komme ich so langsam auf den Punkt) zum Thema „Lehrerhaltung“. Das hatte vordergründig nichts mit den obigen Themenkomplex zu tun, aber eigentlich auch alles. Das eigene reflektieren seines Auftretens und was das alleine bei Schülern bewirken kann, die Selbstwirksamkeit zu erleben, die Gewissheit, dass ich als Lehrer entscheide, wann ein Regelverstoß vorliegt und wie ich dann damit umgehe, war so nachhaltig, dass es uns bis heute wirklich trägt.
Das im Artikel genannte Coaching wäre also – eingebettet in unsere bisherige konzeptionelle Arbeit – ein weiterer kleiner Baustein, der auch wenn er nur eintägig ist, sehr nachhaltig wirken könnte.
Ich hoffe, dass ich jetzt verständlich war und nicht am Thema vorbei geschrieben habe……
Der Elefant heißt Covid-19, SARS-Cov2 und ist neurotrop (ja, der andere Scheiß kommt natürlich auch noch dazu). Es gibt so viel Forschung dazu, dass ich mir mittlerweile bequem einen Sessel daraus basteln könnte. Also bitte einfach mal den aktuellen wissenschaftlichen Stand berücksichtigen.
Nach der 3. Infektion hatten 38% der Kanadier Long Covid, Tendenz: steigend.
Saubere Innenraumluft hilft gegen viele Dinge, zum Beispiel gegen Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten, aber auch in erheblichem Umfang gegen Viren (je nach Untersuchung zwischen 20 und 80 % effektiv). Das muss jetzt kommen.
“Vielen Bildungseinrichtungen fehlen bislang noch das nötige Wissen und die Kompetenz, sichere Bildungsmilieus zu kreieren und damit versäumen sie, die Voraussetzungen für alle Bildungsbeteiligten zu schaffen, langfristig (psychisch) gesund zu bleiben.”
Es geht nicht um das nötige Wissen. Das würden wir schon hinkriegen. Es geht darum, dass die Bedingungen von höherer Stelle so gemacht werden, dass man das Verlangte gar nicht anders leisten kann. Zu dem Thema hatten wir schon massig Fortbildungen, bringt aber nix im Irrenhaus. Momentan guckt jeder lieber, dass er selber langfristig gesund bleibt.
Ich würde hier gerne mehrmals Daumen hoch vergeben. Habe meine Klasse mit Lernbüros eingerichtet, weil einige Kinder sich durch das Gewusel von 29 Kindern überfordert fühlen, wenn sie an Einzelaufgaben arbeiten sollen. Sobald 5- 6 Kinder krank sind, ist es im Klassenzimmer erheblich ruhiger und ich kann mich empathisch und einfühlsam und und und den SuS im Unterricht zuwenden, ich bin merklich fokussierter, entspannter und habe deutlich mehr Freude an meiner Arbeit, was sich auf die SuS natürlich überträgt, bis… ja bis ich mal wieder die wöchentliche Elternmail mit Vorwürfen, Verleumdungen und Forderungen bekomme. Einfach abschalten und mich weiterhin soverän den respektlosen SuS zuwenden, der oder die bei erzieherischen Gesprächen ein Traumata erleidet? Ich wüsste schon wie ich ein sicheres Bildungsmilieu kreiere für alle Beteiligten, die daran interessiert sind. Alles klar!?
So ist es! Wir sind definitiv im Überlebensmodus. Es geht nicht um tollen Unterricht und leuchtende Kinderaugen. Es geht um halbwegs Klarkommen. Hoffentlich erkennt das jeder Lehrer und betreibt fleißig Selbstfürsorge.
hört sich schlimm an
Na ja, ist schon so.
Für Montag 3 Stunden (a 67 Minuten, bevor wieder irgendwelche Kommentare kommen) vorbereitet.
Eine Vertretungsstunde war schon vorher für die erste eingetragen (Informatik 6 halbe Klasse). Dritte Stunde Springer. Zwei Stunden im Kurs (auch Informatik).
Kollegen krank! Erste Stunde spontan in eine 5. Klasse (die ich natürlich nicht kenne). Die 6er wurden dafür zusammengelegt, also kein normaler Unterricht möglich. Zweite Stunde: Kurse wurden aufgelöst, da dann mehr Kollegen zur Verfügung sind. Also eine fremde 8te Klasse komplett vertreten. Springer natürlich weg, da wieder woanders Vertretung (ebenfalls fremde Klasse). In der vierten dann Zusammenlegung von zwei Kursen, also auch die Hälfte unbekannt und nicht im Stoff. Dazwsichen Aufsicht und Kopieren für die Vertreungsstunden. Super Tag! Und leider nicht der einzige. Vorbreitung am Sonntag für die Tonne.
Und da kommen Schleicher und Achtsamkeitstrainer und wollen mir einen erzählen? Die können …
Also genau so, wie wir es kennen!
Ich habe einige Kolleg*innen, die sich eine Reduzierung des Stundenkontingents (in der Regel Abordnungen an die Uni oder in der LK-Ausbildung, aber es gibt auch noch andere Modelle) gesucht haben, weil es ihnen zu viel ist, ihr Nervensystem ständig am Limit zu erleben. Alles total nachvollziehbar.
Ich verstehe auch das Ansinnen der Autorin. Allerdings sollte sie doch selbst wissen, dass es eben gerade nicht die Bildungseinrichtungen selbst sind, die hier verantwortlich sind.
Ich finde es bedenklich, dass es immer mehr Lehrkräfte gibt, die das tun, was die Dame tut. Das heißt, es wird viel Geld für lauter Coachings etc. ausgegeben, das man viel besser dazu nutzen könnte, die Bedingungen in Deutschlands Schulen insgesamt zu verbessern.
Ersetze “bedenklich” durch “dämlich”.
Sorry, das ist ein Totschlagargument. Selbstverständlich sind die Bedingungen, unter denen Lehrkräfte arbeiten müssen, schlecht. Wir berichten ja tagtäglich darüber. Das heißt aber nicht, dass deshalb keine Schulentwicklung mehr möglich wäre. Das belegen viele Kollegien, die sich um Verbesserungen ihres Schulklimas bemühen – beispielsweise die teilnehmenden beim Schulentwicklungspreis “Gute gesunde Schule”. Gerne hier nachlesen: https://m.unfallkasse-nrw.de/fileadmin/server/download/Pressemitteilungen_2022/PM_4_22_SEP.pdf
Guter Link. Nur kritisch zu sehen. Warum?
Es geht um die Rahmenbedingungen. 105 Schulen haben sich beworben … Man geht jetzt nicht davon aus, dass das alles Brennpunktschulen und/oder Schulen ohne Ressourcen sind. Davon bekamen nur 41 die Auszeichnung. Also von den vermeintlichen Vorzeigeschulen weniger als 50%. Was sollte das uns sagen? Die Rahmenbedingungen sind unter aller Sau. Sogar bei Schulen, welche freiwillig mitmachen und Ressourcen (Zeit/Geld) hineinstecken für solche … Veranstaltungen “Wettbewerbe”.
Dazu das höchst dotierte Preisgeld in dem Bereich?
Ja … Genau diese Schulen werden dies brauchen. Die sowieso schon laut Auszeichnung am besten Ausgestatteten.
Das bringt die Chancengleichheit und Ressourcenverteilung natürlich sinnvoll weiter. *Facepalm*
Merken die “Wettbewerbsanbieter” wohl nicht? Schade. Genau das, was das “Totschlagargument” eben aufzeigt.
(Vielleicht sollte das Preisgeld an die “Verlierer” gehen, damit diese nachziehen … Nur mal so ein Gedanke …)
Und ja, natürlich sollte man auch “von sich aus/als Schule” arbeiten. Soweit möglich und sinnvoll. Das wurde jedoch auch nicht angezweifelt? Eben das “Alleinige” wurde angeprangert. Und das definitiv zurecht.
Danke!!!
Das ist an meiner Argumentation vorbei. Das viele Geld, das in solche Coachings etc. fließt, sollten die Länder besser in die Verbesserung der Rahmenbedingungen stecken. DAS ist mein Argument.
Alle Schulen hätten dann etwas davon und nicht nur diejenigen, die sowieso schon besser aufgestellt sind und bei solchen Wettbewerben gerade wegen dieses Vorteils auch noch gewinnen. Danke, Bla: Sehr guter Punkt!
Auch das ist ein Totschlag-Argument, mit dem sich alles abbügeln lässt. Die sehr überschaubaren Kosten für Fortbildungen oder für ein Coaching werden die Bildung nicht retten. Ein Coaching kann aber durchaus einen wichtigen Impuls für eine Schule setzen.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Ich verstehe nicht, warum Sie nicht verstehen, was ich sage und es so verdrehen.
Dann hier nochmal für die Redaktion:
Na ja, ist schon so.
Für Montag 3 Stunden (a 67 Minuten, bevor wieder irgendwelche Kommentare kommen) vorbereitet.
Eine Vertretungsstunde war schon vorher für die erste eingetragen (Informatik 6 halbe Klasse). Dritte Stunde Springer. Zwei Stunden im Kurs (auch Informatik).
Kollegen krank! Erste Stunde spontan in eine 5. Klasse (die ich natürlich nicht kenne). Die 6er wurden dafür zusammengelegt, also kein normaler Unterricht möglich. Zweite Stunde: Kurse wurden aufgelöst, da dann mehr Kollegen zur Verfügung sind. Also eine fremde 8te Klasse komplett vertreten. Springer natürlich weg, da wieder woanders Vertretung (ebenfalls fremde Klasse). In der vierten dann Zusammenlegung von zwei Kursen, also auch die Hälfte unbekannt und nicht im Stoff. Dazwsichen Aufsicht und Kopieren für die Vertreungsstunden. Super Tag! Und leider nicht der einzige. Vorbreitung am Sonntag für die Tonne.
Und da kommen Schleicher und Achtsamkeitstrainer und wollen mir einen erzählen?
Da die Stimme noch angegriffen war, ich aber nicht noch mehr Tage ausfallen wollten, weil Berufsethos und so, habe ich den Tag sehr achtsam und gut gelaunt verbracht. Und nein, das ist kein Einzelfall.
Die Rahmenbedingungen müssen sich ändern! Dann können wir uns über Achtsamtkeit unterhalten. Wir hatten schon mindestens fünf Fortbildungen zur Lehrergesundheit / Achtsamkeit mit (für andere Rahmenbedingungen) guten Dozenten. Bringt aber alles nix.
Frau Emersleben liegt völlig richtig, doch an den schlechten Rahmenbedingungen kann sie auch nichts ändern.
Oft ist es doch so: Am Ende solcher Fortbildungen dürfen dann alle nochmal sagen, dass sie ganz viel „mitgenommen“ haben und ein feines Feedback hinterlassen. Am nächsten Morgen können sie dann ganz entspannt den Arbeitsrückstau auflösen und nach ein paar Tagen Alltagsstress sind die guten Vorsätze vergessen.
Die Umsetzung versandet regelmäßig. Meist werfen sich Mitarbeiter und Leitung gegenseitig ein paar Tage lang vor „nicht dahinterzustehen“, bis dann schließlich alle die beschlossenen (?) Maßnahmen in stillem Einverständnis begraben.
Ein Coaching funktioniert aber nicht, wenn es punktuell an einer Schule stattfindet (häufig auch noch über den Gedanken der Multiplikation – heißt: eine(r) geht hin u d vermittelt dannalle anderen den Inhalt der Veranstaltung – bei der ersten tieferen Nachfrage scheitert die Lehrkraft an der kompetenten Antwort) …
Ganz ehrlich, Leute! … wir alle wissen, dass eine effektive, grundlegende und tukunftsgeeandte Veränderung nicht mit Flickschusterei herbeizuführen ist, sondern nur dann funktioniert, wenn die Großkopferten endlich verstehen, dass die Bildungsforschunfg und die Bildungspolitil den Karren “Schule” seit mindestens 20 Jahre konsequent in die Scheiße gefahren haben (und da beziehe ich solche Luftpumpen, wie Zierer, Schleicher und Co ausdrücklich mit ein)…
Und dieser Misthaufen lässt sich nicht mit punktuellen Schilfs aus dem Weg räumen.
Meine Utopie sieht folgendermaßen aus:
Wir machen “den Laden” für mindestens 1 Jahr dicht … restrukturieren das gesamte System, verabschieden uns vom “vielgelobten” Bildungsföderalismus (und setzen damit enorme Kapazitäten frei) und fahren das System dann wieder hoch.
Die Kids, die in diesem Jahr nicht in die Schule gehen können, machen was Sinnvolles (da findet sich was) und dann fangen wir noch mal neu an.
Alles andere ist doch Mist.
Wer z.B. bei der DB würde denn versuchen, die Radreifen an den Triebwagen oder die Anhänger im laufenden Betrieb in Stand zu setzen oder einen dringend notwendigen Reparaturauftrag am Auto bei laufendem Betrieb zu erledigen?
Den Mut muss man mittlerweile (m.M.n.) im deutschen Bildungssystem aufbringen – alles andere ist halbherziges Pfuschertum.
Nachtrag:
Sind Sie denn dafür, dass man nur Geld für die Symptombekämpfung ausgibt, anstatt endlich mal die Ursachen zu beheben?
Ich habe nichts dagegen, Coachings an Schulen durchzuführen. Offensichtlich ist das ja der einzige Weg, damit es nicht überall gegen die Wand fährt.
Allerdings ist das keine nachhaltige Strategie, um Deutschlands Bildungssystem umzugestalten und für alle Beteiligten zu verbessern.
Wenn Schulen alle Bemühungen um Schulentwicklung einstellen, bis gute Bedingungen herrschen – wird es an Schulen nie gute Bedingungen geben. Kinder verändern sich, Gesellschaft verändert sich. So sind die Folgen der Pandemie (zum Beispiel) im Schulklima vielerorts nach wie vor spürbar, wie uns immer wieder gespiegelt wird. Natürlich müssen Lehrkräfte von solchen Entwicklungen in der Schülerschaft wissen und sich darauf einstellen. Das beginnt mit Information und Erfahrungsaustausch. Neudeutsch: Coachings.
Sich weiterhin fortzubilden, widerspricht der Belastungssituation keineswegs.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Aber Fortbildungen, die immer am Wochenende oder ab 15 eher ab 17 Uhr beginnen sind für die Füße, wie man so schön sagt. Man ist nicht mehr so Aufnahmefähig oder man braucht das Wochenende für Korrekturen un dgerät echt in Zeitnot, wenn man sich noch eine Fortbildung anlacht. Für Pädagogische Tage ist das ja eine gute Sache und es gibt sicher neue Impulse. Und ich schließe mich an, oft wird einer geschickt und soll das dan an 70 KuK weitergeben. Wann??? Wird nicht gesagt, wird keine Zeit zur Verfügung gestellt. Das ist einfach das Problem, es geht ja nicht darum, das Fortbildungen keine Impulse geben können. Ich weiß wovon ich rede, ich war eine Weile im “Gesunde Schule” Team und habe erlebt, wie viel “Ungesundes” dabei raus kam und wie wenig tatsächlich Gesundheitsförderliches. Ich habe mich dann dort wieder verabschiedet, weil es am Ende Zeit gefressen und wenig bis nichts gebracht hat.
Davon mal abgesehen, was da teilweise in der Schule an Referenten and Land gezogen wird ist gruselig. Oder es gibt gar keine Referenten und die LuL sollen das mal selbst gestalten, am besten der, der vor 3 Monaten mal 3 Online-Tage zu dem Thema hatte und 2 Wochen vor dem Pädagogischen Tag mit diesem Anliegen überfallen wird. Da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Enwicklung und Fortbildung braucht Raum und Zeit, die es aber effektiv kaum oder sogar gar nicht gibt. Guckt man hier mal die Angebote durch hat das Ministerium so viel wie geht auf online geschaltet (ist für manche Themen aber einfach nicht sinnvoll) und oft erst später Nachmittag oder Abend, wenn man sowieso schon fertig ist nach teilweise 8h Schule. Hier wären wir dann wieder beim Thema Arbeitszeit angelangt und wieder beißt sich die Katze in den Schwanz.
Richtig. Für beides sollte und muss man investieren.
Aber lediglich durch Fortbildungen die Rettung anzupreisen ist der falsche Weg. Der Eindruck kann allerdings durchaus entstehen.
Ändert nichts an solchen Scheinwettbewerben (was anderes ist es oftmals nicht). Ändert nichts daran, dass oft Lehrkräfte sich dem eigentlichen Beruf abwenden und sich zu Coaching oder sonstigen Sachen (Politik, Bildungsforschung, Uni, Workshops, Berufsberatung/Lehramtsaussteigerberatung) zuwenden, da sie auch oft checken, dass an der Schule oft die Ressourcen fehlen und man anders auch gut anfragen bekommt.
Daher: Bedingungen an den Schulen verbessern, damit diese Instanzen als Zusatzhilfe dienlich sind und nicht, da die Ressourcen fehlen und man sich in den Bereichen selbst herauswindet, um bestenfalls anderen “an der Front” zu helfen.
Hoffe man versteht meine grundlegende Aussage. Ist schwer erklärbar durch einen Chat/Kommentar.
“Aber lediglich durch Fortbildungen die Rettung anzupreisen ist der falsche Weg.”
Macht auch niemand. Herzliche Grüße Die Redaktion
Erneut ein allumfassendes Lösungsmodell aus der Coaching-Ecke: So “kann eine nachhaltige Veränderung für alle” (!) erzielt werden. Warum dieser marktschreierische Duktus in einem Fachmagazin?
Generell: Unsere Tierhaltung ist nicht gut. Unsere Menschenhaltung ist es aber auch nicht. Täglich mit einem Haufen Leute, die man sich nicht ausgesucht hat, die einen aber auch nicht ausgesucht haben, in marode Klassenzimmer hineingestopft zu werden und Sachen zu machen, die man nicht mag, das ist wirklich stressig. Dazu noch die Lautstärke – an anderen Arbeitsplätzen hätte man laut Arbeitsschutzgesetz vermutlich Kopfhörer auf. Es ist so erstaunlich, wie anders Kinder sind, wenn man sie beispielsweise in einem persönlich eingerichteten DaZ Raum zum Einzelunterricht da hat
Nur fehlt mir in dem Artikel wieder das Konkrete: Wie? Was? wo genau? Ich würde mir Beispiele wünschen, am besten mit Bildern ( unter dem Stress ist mein Vorstellungsvermögen nicht das beste)
Zum Thema Lautstärke, die wird in Klassenzimmer (ideal 35 dB) regelmäßig locker überschritten (selten zwischen 35 und 55 dB), insbesondere dann, wenn die Raumgestaltung dem Brandschutz zum “Opfer” fällt. Beides ist megawichtig, interessieren tut es nur die glorreichen 16 nicht. ( Zur weiteren Info: https://dguv.de/ifa/fachinfos/laerm/rechtliche-vorgaben-zu-arbeitsplatzlaerm/index.jsp-)
Zu dem ist es ein zwingendes MUSS, dass die Fobi auf die Schule angepasst ist. Was bei Schule A passt, kann bei Schule B evtl. nur teilweise oder gar nicht angewendet werden, weil es einen Mangel an Platz, Ressourcen (Lehrpersonal und Räumlichkeiten) fehlt. Des Weiteren ist anzumerken, dass die Auflösung von Förderschulen, die dem einen oder andern betroffenen Kind, durchaus helfen würden, eine negativ-positve Idee war. Inklusion braucht überall die richtigen Ressourcen, und die bekommt man einfach nicht zum Nulltarif (die glorreichen 16 glauben dieses immer noch). Nicht jede Schule ist von ihrer Grundstruktur (Bauart) für bestimmte Inklusionsfälle geeignet, soll aber, laut Ansage von oben, alle Inklusionsfälle übernehmen. (Wer den Fehler findet, möge ihn behalten).
Fortbildungen nur noch in die unterrichtsfreie Zeit zu legen, ist für die Eltern (mindestens einer oft beide) im Kollegium eine Beleidigung erster Güte. Diese haben schon wenig Zeit für ihre Kids, wenn sie korrekturstarke Fächer haben oder eine intensiv zu betreuende Klasse, weil dort mehrere sehr extrovertierte Charaktäre, die zum Teil von den Eltern aufgegeben wurden, auf einandertreffen und sich in ihrer mal positiv oft aber massivst negativen Art bei jeder Gelegenheit eine Bühne verschaffen wollen.
Kleinere Klassen sind da oft die beste Lösung, weil man sich als Lehrkraft dann wirklich um die Klasse kümmern kann und nicht mit Dressieren beschäftigt ist. Der Wechselunterricht hat das während der Coronajahre sehr gut gezeigt und zu dieser Erkenntnis beigetragen. Leider ist diese Erkenntnis für die glorreichen 16 ein Albtraum, da sie doch die Forderung nach kleineren Klassen sehr gut unterstreichen kann. Probates Rezept dagegen: Ignorieren! Lehrer weiter belasten, dann bleiben sie ruhig und träumen höchstens noch, wenn sie denn Zeit dazu haben. Negativ für die SuS! Egal, weiter belasten, so wie immer! Und wenn doch was kommt, FoBi und gut. Die Fobi passt nicht zur Schule, egal! Machen!
Oft würde es schon helfen, wenn die Erziehungsgemeinschaft zwischen Schule und Elternhaus funktionieren würde. Lehrkräfte können nicht die Unfähigkeit oder den Unwillen von überforderten Eltern ausbügeln. Und die Jugendämter sind oft genug auch an der Belastungsgrenze, weil dort auch Personalmangel herrscht.
Oft fühle ich mich bei solchen “freundlichen” Aussagen, wie sie die Gastautorin tätigt, an das Lied von Tim Benzko erinnert: “Nur noch kurz die Welt retten”.
Die Umsetzung ist absolut unmöglich, wenn nicht alle Beteiligten an einem Strang ziehen und es eine gewisse Rückendeckung von den glorreichen 16 gibt.
Verflixt! Ich fange schon wieder an zu träumen….
Entscheidungsdreieck, unlösbares …
Will ich Eltern und Schülern gerecht werden, habe ich Probleme mit der SL und der Aufsicht.
Will ich Schülern und Vorgaben gerecht werden, habe ich Probleme mit der Elternschaft.
Will ich Eltern und Vorgaben gerecht werden, habe ich einen Konflikt mit den Schülern.
Da ich mit Schülern und der SL täglich Kontakt habe, haben die Eltern das Nachsehen. Einen muss es ja letztendlich treffen – also mich selbst, da Eltenbeschwerden bei der SL dafür aureichende Grundlage sind.
Genau so ist es!
Bürgergeld, die Rot-Grüne-Lösung
Ich glaub, Sie sind im falschen Forum. AfD für Armselige und Trolle finden Sie eher auf Telegram.
Auch wenn es mit dem eigentlichen Thema nix zu tun hat, die Höhe des Bürgergeldes kann nicht groß abgesenkt werden. Grundsätzlich muss ja jeder Bürgergeldempfänger bei Eintritt in die gesetzliche Altersrente die Grundsicherung im Alter erreichen. Der Mindestlohn und die tariflöhne müssten also angehoben werden, um das Lohnabstandsgebot einhalten zu können. Man muss von der eigenen arbeit auch leben können.
es ging um Ihr Entscheidungsdreieck, das die Probleme macht. Das hat also mit Geld nichts zu tun, es ist eher ein Wink mit dem Zaunpfahl den Job hinzuwerfen. Dann sind alle Probleme gelöst.
https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/bildung/article144832351/Lehrer-Beruf-ist-oft-nur-eine-undurchdachte-Notwahl.html
Der Artikel ist von 2015, wir haben 2024.
Was hat sich seitdem verändert?
Davon unabhängig schaue man sich den letzten Satz an:
Es reicht nicht aus und wir können und sollten uns mehr leisten, als nur einzelne attraktive Schulen gut mit Lehrkräften zu versorgen.
Das bedeutet, dass Schulen auf dem Land und im Brennpunkt auf Dauer unterversorgt sind und Unterricht ausfällt.
Vielmehr muss gerade dort die Attraktivität gesteigert und der Personalschlüssel erheblich verbessert werden, um der Benachteiligung etwas entgegensetzen zu können und die schwierigeren, umfassenderen Anforderungen auf mehr Schultern verteilen zu können.
DER NACHWUCHS (m/w/d) HAT SEIN ABI GEMACHT.
Bekannte: „Na, was macht denn das Kind danach, geht es schaffen oder studieren?“
Eltern: „Es weiß noch nicht“.
WOCHEN SPÄTER
Bekannte: „Hat es jetzt schon einen Plan?“
Eltern: „Ja, es will studieren“.
Bekannte: „Ist doch super. Was studiert es denn?“
Eltern: „Lehramt.“
Bekannte: „Das ist schlau, das ist sicheres Einkommen. Welches Fach studiert es denn?“
Eltern: „Sozialkunde und Sport.“
was haben die alle für Zeit um zu blubbern.
Stressdiagnose: Überforderung durch Unterforderung
Ja aber echt. Denen allen ist wohl so langweilig wie Ihnen.
Ihre Ironie, ist wieder göttlich.
Ich gratuliere.