BERLIN. Es steht schlecht um die MINT-Bildung in Deutschland, also um die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Ein neuer Bericht – das MINT Nachwuchsbarometer – benennt Probleme und zeigt Lösungen auf. Dabei rückt auch die Unterrichtsqualität insbesondere in Mathe in den Fokus.
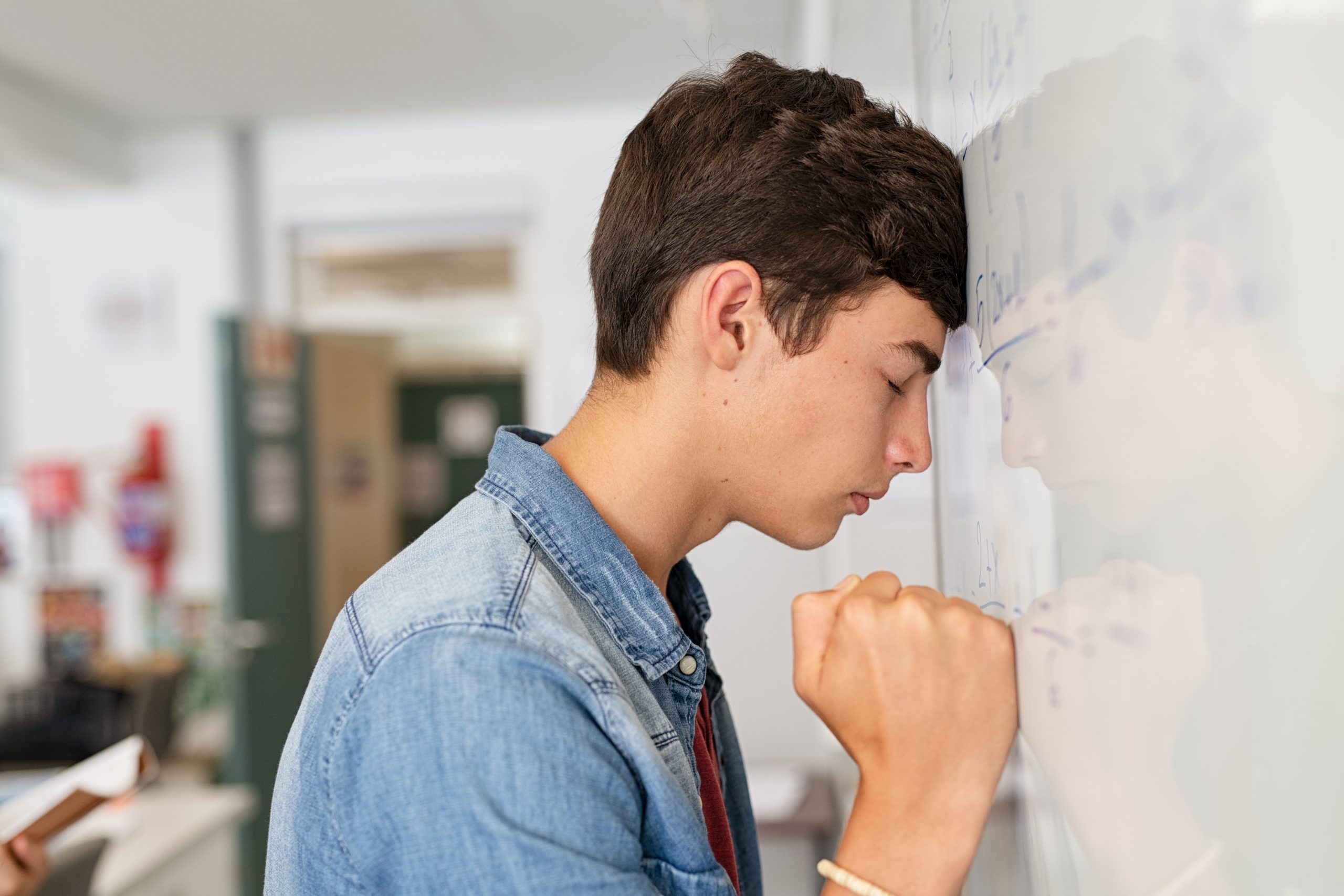
Mathematik ist das MINT-Fach, in dem sich die Schülerinnen und Schüler in Deutschland besonders schwertun – mit beunruhigender Tendenz: Laut PISA haben die mathematischen Leistungen bei der Gruppe der 15-Jährigen zwischen 2012 und 2022 um 39 Punkte abgenommen. Das entspricht einem Kompetenzrückstand von einem kompletten Schuljahr.
Das hat Gründe, wie das MINT Nachwuchsbarometer (herausgegeben von acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften und der Joachim Herz Stiftung) feststellt. Das Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler in Deutschland ist zum einen besonders schlecht durch die Corona-Pandemie gekommen. Zum anderen gibt es aber auch problematische Entwicklungen, die tiefer reichen:
- „Die mathematischen und naturwissenschaftlichen Leistungen der Neuntklässlerinnen und Neuntklässler an deutschen Gymnasien sind in den vergangenen zehn Jahren erheblich abgefallen, die Schülerinnen und Schüler verloren durchschnittlich eineinhalb Lernjahre.“
- „Während vor zehn Jahren die sogenannten Spitzen- und Risikogruppen in den PISA -Studien noch etwa gleich groß waren, hat sich seitdem die Spitzengruppe halbiert und die Risikogruppe verdoppelt. Besonders Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund zählen häufig zur Risikogruppe und werden nicht gut in das deutsche Schulsystem integriert.“
- „Der Mathematikunterricht an deutschen Schulen ist oftmals wenig kognitiv aktivierend und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern wenig Transfer des erlernten Wissens in ihren Lebensalltag.“
„Wir müssen uns mehr um die Mathematik kümmern“, fordert deshalb Prof. Olaf Köller, Direktor des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN), Vorsitzender der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der KMK – und Studienleiter des MINT Nachwuchsbarometers: „Eine Untersuchung von Prüfungsaufgaben aus dem Mathematikunterricht hat gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler bei 75 Prozent der Aufgaben keinen Bezug zu ihrem Alltag oder ihrem Umfeld herstellen konnten. Ein stärkerer Lebensweltbezug, eine bessere Verknüpfung der Lerninhalte über die Jahrgangsstufen hinweg oder eine größere Orientierung des Unterrichts an den Lernständen der jeweiligen Schülerinnen und Schüler sind Qualitätsmerkmale, die wir im Mathematikunterricht unbedingt konsequenter durchsetzen müssen.“
Insgesamt identifiziert die Studie fünf Qualitätsmerkmale für guten Mathematikunterricht:
- „Kognitive Aktivierung: Schülerinnen und Schüler zur vertieften Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten motivieren.
- Verstehensorientierung: Mathematisches Verständnis aufbauen.
- Durchgängigkeit: Nachhaltiges Lernen mathematischer Konzepte und Leitideen über die Klassenstufen hinweg mit stetiger Verknüpfung der Lerninhalte, so wie es die Lehrpläne und Bildungsstandards vorsehen.
- Adaptivität: Orientierung des Unterrichts an den jeweiligen Lernständen der Schülerinnen und Schüler.
- Kommunikationsförderung: Die Bedeutung der Mathematik in der Welt erkennen und sie bei der Beschreibung alltäglicher Phänomene benutzen.“
Eine Unterrichtsmethode, die im MINT Nachwuchsbarometer vorgestellt wird, setzt hier an: Beim kollaborativen problembasierten Lernen werden die Schülerinnen und Schüler mit realitätsnahen Problemen konfrontiert – zum Beispiel mit der Frage, wie sich Offshore-Windparkanlagen so bauen lassen, dass sie die Meeresflora und -fauna möglichst geringfügig stören. Die Aufgaben sind stets so komplex, dass sie nur unter Zuhilfenahme des Wissens und Könnens der Mitschülerinnen und Mitschüler sowie weiterer Quellen in der vorgegebenen Zeit bearbeitet werden können. Die Lehrkräfte übernehmen lediglich eine unterstützende Rolle. Die Begleitforschung zeige: „Mit der Methode des kollaborativen problembasierten Lernens können doppelt so große Lernfortschritte erzielt werden wie in einem Jahr Mathematikunterricht in der Sekundarstufe I.“
„Ohne gut qualifizierte MINT-Lehrkräfte werden die in dieser Studie ausgeführten Mängel in der MINT-Bildung nicht zu schließen sein. Hier droht ein Teufelskreis“
„Mit MINT-Kompetenzen können wir ein tieferes Verständnis unserer Welt erlangen – und dafür sorgen, dass sie uns – Stichwort ‚Klimawandel‘ – als lebenswerter Ort erhalten bleibt. Das müssen wir gerade jungen Menschen deutlicher vor Augen führen, beispielsweise indem wir im Bildungssystem mehr Anwendungsbezug und Anschaulichkeit herstellen. Hier sollten auch außerschulische Lernorte stärker in den Fokus rücken: Museen, Schülerforschungszentren und Schülerlabore bieten vielfältige Möglichkeiten im Bereich der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung und präsentieren aktuelle Befunde naturwissenschaftlicher Forschung“, so acatech-Präsident Jan Wörner.
Der Haken an der Sache: Ohne genügend Lehrkräfte kann ein besserer Unterricht kaum in der Fläche angeboten werden. Gerade in den MINT-Fächern macht sich aber zunehmend Lehrkräftemangel bemerkbar. „In den Lehramtsstudiengängen für allgemeinbildende Schulen zeigt sich auch im Jahr 2022, dass der demografische Effekt (vergleichsweise kleine Geburtskohorten) zu relativ stagnierenden bis sinkenden Zahlen bei den Studienanfängerinnen und -anfängern führt. Gegenüber dem Vorjahr ist in den MINT -Fächern (1. Schulfach, 1. Fachsemester) ein weiterer Rückgang um rund 1,5 Prozent zu verzeichnen, gegenüber 2020 sind es zwölf Prozent“, so heißt es in dem Bericht. „Ohne gut qualifizierte MINT-Lehrkräfte werden die in dieser Studie ausgeführten Mängel in der MINT-Bildung nicht zu schließen sein. Hier droht ein Teufelskreis.“
Mögliche Lösung hier: für Mangelfächer wie beispielsweise Physik oder Informatik an den Universitäten Ein-Fach-Lehramtsstudiengänge einzurichten. News4teachers
Hier lässt sich das vollständige MINT Nachwuchsbarometer herunterladen.
Leichter gesagt als getan, die Anzahl an außerschulischen Lernorten ist begrenzt. Ich kann froh sein, wenn ich für zwei Klassen pro Schuljahr in einem Schülerlabor einen Termin für einen Tag bekomme.
Wenn ich ins Museum fahre, kostet das pro Schüler inklusive Busfahrt und Eintritt etwa 15 Euro. Das mach ich gerne, können sich aber nicht alle Eltern unbegrenzt leisten.
Wie bieten zudem sehr viele Ausflüge und Fahrten an, mittlerweile jammern sogar die Schüler, dass es zu viel wäre, sie würden sich gerne aufs Lernen konzentrieren.
Solange es festgeschriebene Leistungsnachweise gibt und letztlich auch zentrale Abschlussprüfungen und vorgeschriebene Lehrpläne sind solche Forderungen ja nett, aber unter den aktuellen Bedingungen nur begrenzt umsetzbar beziehungsweise sehe ich nicht, wie wir noch mehr davon umsetzen sollen. Die Kapazitäten sind nicht nur personeller Art begrenzt.
„Der Mathematik-Unterricht ist oftmals wenig kognitiv aktivierend“Hä? Mit jahrzehntelanger binnendifferenzierter Kompetenzorientierung, Selbstorganisiertem Lernen ohne Basisgrundlagen und Sturzflug im Anforderungs-und Leistungsbereich sind uns keine kognitive Aktivierung und keine vor intrinsischer Motivation strotzenden Scharen von Schülern gelungen? Wer hätte das gedacht?
Deshalb brütet Sachsen jetzt zeitgeistkonform das “faule Ei” auch weiter.
Schule bis 2030: “Weniger Faktenwissen, mehr Kompetenzen, Hybridunterricht und selbstorganisiertes Lernen“Läuft doch! Nur uns Lehrern fehlt der unerschütterliche Glaube ans Gelingen, weil die Realität uns täglich eines Besseren belehrt.
Die Kompetenzenkompetenz der zielführenden Realitätsverweigerung ist bei MINT-Lehrern noch nicht ausreichend entwickelt.
Es müsste mal ein Glaubensseminar vom Elfenbeinturm hybrid angeboten werden. OMMMMMMMMMMMMMM bitte mit Klangschale und Gebetsmühle!
Danke für den sarkastisch lustigen Kommentar zum” faulen Ei ”
der sächsischen Schülerverblödung in Spe.
Wenn man wenigstens mal Mathematik betreiben könnte …
Vor lauter Kompetenzorientierung und Textaufgaben ist die Mathematik auf der Strecke geblieben. Darunter leiden die wirklich guten Mathematiker und diejenigen mit Schwierigkeiten im Textverständnis.
Darf ich fragen, wo ist das Problem mit Textaufgaben? Ich kann mir Mathematik ohne Textaufgaben nicht vorstellen.
Reine Mathematik kommt ohne außermathematischen Kontext aus. Die Übersetzung des Textes in eine Matheaufgabe und die Lösung wieder zurück entfallen somit. Ich gebe aber zu, dass solche Aufgaben abstrakter und damit schwieriger sind als Textaufgaben.
Eigentlich ist es gerade andersrum: rein mathematische Aufgaben können von den SuS deutlich einfacher bewältigt werden, da die Übersetzung: „was genau ist gesucht“ entfällt.
Beispiel für Klasse 9:
Mathematisch:
Gegeben ist eine Parabel mit der Funktionsgleichung f(x)=-2x*x + 3x +2. Berechne den Abstand der Nullstellen voneinander.
Schüler weiß: Nullstellen berechnen, Abstand ermitteln.
„Kompetenzorientiert“:
Der Bogen der Was-Weiß-Ich-Brücke in Mainz kann mit Hilfe der Formel f(x) = -2x*x + 3x+2 berechnet werden. Dafür wird ein Koordinatensystem so auf die Brücke gelegt, dass der linke Brückenpfeiler im Ursprung steht. Berechne, welche Flussbreite von der Brücke überspannt werden kann.
Jetzt beginnt das Rätselraten, was überhaupt gesucht ist….
Viel zu determiniertes Brückenbeispiel. Der Schüler soll erst mal selbst schauen, wie er das Koordinatensytem drüberlegt. So geht “kompetenzorientiert nicht”.
Nur haben sehr viele Schüler schon mit dem genannten Brückenbeispiel ihre Schwierigkeiten.
Solche Aufgaben meine ich nicht. Wenn nämlich Textaufgaben wegfallen, hat man wieder mehr Zeit für andere mathematische Probleme und ihre Lösung oder gar den Beweis. __Die__ sind dann zwangsläufig schwieriger als die nur einfachen Aufgaben von heute.
Abituraufgaben der letzten Jahre findet man im Netz. Gerne da nachlesen, wie es hier immer heißt.
Und da gibt es viel zu lesen. Auch gerne auf eine zufällige Fremdsprache inklusive Arabisch oder Türkisch übersetzen lassen. Oh, keine Sorge – also Nachteilsausgleich erhalten Sie 20% mehr Zeit und ein Wörterbuch… viel Spass – auch und gerade bei den folgenden Operatoren: Begründen, Interpretieren, Beschreiben, Erklären, Erläutern (bitte auf den genauen Unterschied zu Erklären achten), Bewerten und Zusammenfassen.
Wenn man auch nur ein klein wenig erweitertes Sprachwissen besitzt, ist die leider viel zu oft anzutreffende Uneindeutigkeit der Textaufgaben schwer auszuhalten vor allem in der Voranahme mancher Autoren, dass doch sonnenklar sei was gemeint sei. Von Eindeutigkeit und Eineindeutigkeit gar nicht erst zu reden.
Als “Spielchen” sichtbar in jedem popeligem Intelligenztest, mit den Ablenkungsfragen, ob man den Text zuerst gelesen hätte und dann dies und das unterstreichen, zusammenrechnen oder nur seinen Otto unten drunter setzen soll.
Für die armen Würstel, die es mit sinnentnehmenden Lesen oder allg. mit Lesen auch Fachsprache schwer haben, ist gar kein Senf mehr da.
Als Ergebnis einer früheren PISA-Studie kam heraus, dass gute Leistungen in Mathematik auch im Lesen vorhanden waren. Aus dieser Korrelation wurde dann eine Kausalität. Mit dem Ergebnis, dass die Textaufgaben aufgebläht wurden.
Die Schülerinnen und Schüler müssen sich dann erst einmal durch viel Text kämpfen bevor sie zu dem eigentlich Zweck, dem Lösen einer Mathematikaufgabe, kommen.
Die Mathematik hat als größtes Problem ein Schulfach gleichen Namens.
Das Problem an den Textaufgaben ist der an den Haaren herbeigezogene Text.
Aus einer Hauptschulprüfung und meinem Gedächtnis:
“Für ein Kilogramm Waffelteig benötigt man 2/3 Liter Milch. Wie viel Milch benötigt man für 7 Kilogramm Waffelteig.”
Schon mal einen Meßbecher mit eine 2/3-Teilung gesehen? Da war zuerst die Zahl und dann die Aufgabe da. Schwachsin^2. Oder vielleicht sogar EXP(Schwachsinn).
Die Zugabe von Wasser oder Milch richtet sich nach der Mehlmenge. Beim Brotteigt spricht man von Teigausbeute. Wieder Schmarrn.
Es ging noch heiter weiter.
“Eine Klasse erwirtschaftet eine Gewinn von 70 EUR, die zweite Klasse einen Gewinn von 140 EUR und die dritte Klasse einen Gewinn von 240 EUR. Die vierte Klasse erwirtschaftete einen Verlust von 60 EUR. Tragen Sie die Zahlen auf einem Zahlenstrahl ab.”
Fachlich gesehen sollten wohl die Maßzahlen auf einem Zahlenstrahl abgetragen werden. DZ. Dummes Zeugs. Textaufgaben sind der letzte Schrott, wenn es so endet.
Realitische Aufgaben? Zu schwer, nicht machbar.
Pseudo-Anwendungsaufgaben nehmen immer mehr zu.
“Unter Vernachlässigung der Schwerkraft fliegt ein Pfeil geradlinig auf eine Zielscheibe zu”. Natürlich kann das nur in einer Abituprüfung Mathematik geschehen. Der Stütz- und der Richtungsvektor der Pfeilflugbahn sind gegeben. Freilich. Ist es das, was Sie sich unter “ich kann mir Mathematik ohne Textaufgaben nicht vorstellen” vorstellen? Bei sowas könnte ich kotzen. Die Schwerkraft lässt den Pfeil auf keinen Fall entlang einer Geraden fliegen. Nein, auch nicht näherungsweise.
Pfui bäh. Die Schüler sollen so die Notwendigkeit der Mathematik für ihre Lebenswelt begreifen. Alles Murks und nicht zielführend. Da begreift der dümmste anzunehmende Schüler, dass im ein Schrott vorgesetzt wird, bei dem er eigentlich nur durch Unmengen Text eine Aufforderung erhält, Schema X abzuorgeln.
exp(Pi * i) + 1 = 0
Da ist alles drin, was Mathematik ausmacht.
Der Logarithmus naturalis in all’ seiner Schönheit ist zu einer Taste auf dem Taschenrechner verkommen.
Ja, ich denke, dass Textaufgaben wichtig sind, sogar wenn sie nichts mit Realität zu tun haben.
Meiner Meinung nach sie helfen abstraktes und logisches Denken zu entwickeln, ein mathematisches Modell zu bauen, und bringen Abwechslung.
Dazu gibt es viele Aufgaben in zb Geometrie, wo man Aufgaben nur als (langes) Text schreiben kann (obwohl nur sachlich) oder wo man etwas prüfen muss.
Aber natürlich gibt es viele unschöne oder nicht korrekte Textaufgaben. Die sollte man vermeiden.
Lesekompetenz.
Sie verstehen den Text nicht.
Wissen nicht, was sie berechnen sollen.
„Eine Untersuchung von Prüfungsaufgaben aus dem Mathematikunterricht hat gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler bei 75 Prozent der Aufgaben keinen Bezug zu ihrem Alltag oder ihrem Umfeld herstellen konnten. Ein stärkerer Lebensweltbezug, eine bessere Verknüpfung der Lerninhalte über die Jahrgangsstufen hinweg oder eine größere Orientierung des Unterrichts an den Lernständen der jeweiligen Schülerinnen und Schüler sind Qualitätsmerkmale, die wir im Mathematikunterricht unbedingt konsequenter durchsetzen müssen.“
Natürlich gibt es auch Aufgaben mit Lebensweltbezug in Mathematikschulaufgaben. Aber würde ich einzig und allein nur solche stellen, würden meine Schüler mich hassen. Denn gerade diese Aufgaben müssen erst mal richtig erfasst werden, was ihnen aufgrund mangelnder Lesekompetenz nicht immer gelingt. Außerdem kann ich nicht ewig mit den Kindern Brüche addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren üben und dann nicht auch solche ähnlichen Aufgaben dran bringen. Das gibt den Kindern Sicherheit in der Prüfung. Außerdem erfahren sie sich als kompetent, wenn sie die Aufgaben richtig lösen können und sind motiviert mit mir weiterzulernen. Ich kann sie auch mit einem Haufen kompetenzorientierter, teils überfordernder Aufgaben konfrontieren, dann werden sie die Motivation verlieren. Leider denkt hier die Forschung zu kurz, sie beziehen nie die Bedingungen vor Ort ein.
Hm.
Vielleicht mehr Tic Toc-Bezug herstellen.
Und die Gewinne von Influencern berechnen lassen?
Wieviele earnings braucht es auf Fortnite um….zu erreichen?
Ein Spieler ist ausgefallen, weil seine Mutter ihn nachts erwischte. Nun darf er drei Wochen nicht mehr zocken.
Wieviel bietest du einem Ersatz-IO an, ohne Pleite zu gehen?
Susi will auf ihrem Kanal Kosmetik-Tipps geben. Was braucht sie dafür? Kosten des Equipments, Zeitaufwand, Investitionen, Werbungseinnahmen, Dauer eines Clips und Stundenlohn….
Vergleich Ausbildungsplatz/TicToc/YouTube/Instagram/Bürgergeld … Miete, Strom…
Berufsplan gleich inbegriffen.
Und bitte – ganz einfache Hauptsätze.
Das ist die “Lebens”welt der SuS.
Und – alles schön an die Digitalität gebunden, Berufsorientierung und Zukunftsplanung inbegriffen.
Ich bin noch unentschlossen, ob ich das ernst oder ironisch meine.
“nur unter Zuhilfenahme des Wissens und Könnens der Mitschülerinnen und Mitschüler” “können doppelt so große Lernfortschritte erzielt werden”
… ding, dong! Hört ihr den Gong?
Wenn man Spicken beim Nachbarn nicht mehr untersagen würde und in Prüfungen dann immer Paare aus guten und weniger guten SuS bildet, könnte man die Notendurchschnitte vermutlich deutlich steigern.
Der Schnitt ist auch ohne schon hoch genug.
Meine damaligen reinen und doch sehr heterogenen SuS wären heute – bis Klasse 9 – vermutlich gute Gymnasiasten.
Die meisten konnten was und ihre Einsen und Zweien (aber auch die anderen Zahlen) waren verdient.
Die Aufgaben, die die in Klasse 6 (Deutschunterricht) machen mussten, kann heute kein Achtklässler mehr. Zu wenig Lesekompetenz.
Ich habe in den letzten Wochen mündlichen Abiturprüfungen abgenommen. Ohne Worte – Amtsverschwiegenheit! Es wäre unbedingt erforderlich diese den Schülern auch im Tandem zu ermöglichen. Weiterhin plädiere ich für das Zulassen eines Telefonjokers (z.B. aus Kampfhelikopter-Eltern-Expertenteam mit anwaltlicher Unterstützung) und eines KI-generierten Publikumsjokers. Mittels eines Fifty–fifty–Jokers könnte die Chance gewährt werden, die Prüfung auch ohne analoge Präsenz schon im Vorfeld mit Bestnote bestanden zu haben.
Wenn wir dann bei den Prüfungskommissionen noch die Fächergrenzen auflösen (Vgl. Schulleiter Winkler) und uns nicht so sehr auf das eigene Fach fokussieren, würde dem kreativen Funkenflug (z.B. Kunstlehrer als Vorsitzender der Prüfungskommission Chemie) der Schüler besser Rechnung getragen. Beim Thema Farbstoffe würden dann weniger die chemische Struktur und das Reaktionsverhalten interessieren, mit einer kreative Verteilung der Farbstoffe im Prüfungsraum oder eine Präsentation der eigenen Farbschemaempfindungskompetenz ließen sich die Notenschnitte sicherlich weiter pampern.
Das könnten in den Folgejahren ganz gemütliche und erheiternde Prüfungsrunden werden. Man gönnt sich ja sonst nichts.
🙂 Danke! Ich habe gerade Kopfkino!
Wie gut, dass uns keiner denken hören kann.
Sonst hätten wir entweder sofort Hausverbot in unserem Kopfkino oder eine Oscar-Nominierung. Kommt ganz auf den Betrachter an.
Das Zitat fasst die verquere Wohlstandsdegeneration des Bildungswesens punktgenau zusammen:
Die Mathematik muss gefälligst den Schüler ansprechen, motivieren, aktivieren.
Ja, genau, LOL.
Als ob Naturgesetze oder die Realität sich um Gefühle scheren…
Soll das eine Entschuldigung für Lehrkräfte werden, sich ebenfalls nicht um (Gefühle der) Schüler zu scheren?
Klingt zumindest verdächtig danach.
Das witzige ist:
1. Sie sind nicht mein Vorgesetzter
2. Wir sind hier im Internet – hätte ich das gemeint, hätte ich das einfach geschrieben.
Also: Nö.
Es ist genau das gemeint, was da steht:
Die (sicherlich zutreffende) Aussage zeigt die verdrehte, verquere Perspektive auf, die mittlerweile herrscht.
Steht da nicht. Und weder Naturgesetze noch Realität kümmern sich um Befindlichkeiten. Siehe Erdanziehung, Flut im Ahrtal oder die Jahreszeiten.
Finde dieses Zitat nicht…
Aber die SchülerInnen kongnitiv zu aktivieren lehnen Sie nicht unbedingt ab, oder?
Motivation kann einiges bewegen
Absolut richtig.
Die Motivation wäre das Mittel, die Bildung (hier: Mathematik) sollte der Zweck sein.
Konjunktiv bewusst gewählt.
Die Bildung sollte das Mittel sein. Die Motivation ist das Ziel: Ein Mensch zu werden, wirksam und zufrieden mit sich.
Dann muss ich ja nie wieder korrigieren – bissl Töpferkurse zur Selbstwirksamkeit, Schulkiffen zur Zufriedenheit und in der OS bissl Meditationskurse für den Lebenssinn…die von Ihnen genannten Gefühlsziele kann man ja gerne wieder zum Hauptthema machen, wenn alles wieder halbwegs läuft.
Muss man sich nämlich ***leisten*** können.
.”..werden die Schüler mit realitätsnahen Problemen konfrontiert – zum Beispiel mit der Frage, wie sich Offshore-Windparkanlagen so bauen lassen, dass sie die Meeresflora und -fauna möglichst geringfügig stören.”
Wow, der hat ja ordentlich Ahnung von der Lebenswirklichkeit der Schüler. Ich probiere das mal spasseshalber aus … wird bestimmt der Knaller und aktiviert meine Schüler total.
Haben Sie eine Idee, wie man so eine Aufgabe mit den stark beschränkten Möglichkeiten der Schulmathematik lösen könnte? Ich habe Mathematik studiert, aber auch keine Ahnung von Modellierung, partielle Differenzialgleichungen, Numerik usw.
Bevor wir bei der Mathematik sind sollten die erst mal wissen, was eine Offshore Anlage überhaupt ist. Ein paar physikalische Grundlagen sollte man kennen. Dann wäre es hilfreich, wenn die wüssten, was da so alles im Meer lebt. Also Wirkungsnetze von Tieren und Pflanzen. Sonst weiß man ja gar nicht, was da alles gestört werden kann. Und dann … oh, Schuljahr um.
Aber da der gute Mann ja von der Sek 1 redet, können Sie die genannten Lösungsansätze eh vergessen. Da gehen ja nicht mal funktionale Zusammenhänge.
Zu behandelnde Funktionstypen in der SEK I: linear, quadratisch, Potenzfkt höheren Grades einschließlich gebrochener und negativer Exponenten, Exponentialfunktionen.
Da geht so einiges zu beschreiben.
Steht so im Lehrplan. Realität: Wir bereiten die Schüler so vor, dass sie durch die ZAP kommen und geben Tipps, was sie dafür weglassen können (nein: müssen! Sonst geht gar nichts mehr).
In einer der letzten ZAP’s konnten die Kollegen bei einer Aufgabe zwischen Gleichungssystem und Linearen Funktionen wählen. Wir haben uns für das Gleichungssystem entschieden. Ich kenne viele Schulen, die das nicht gemacht haben, der Großteil der Schüler hatte die Aufgabe falsch. Der Schnitt im Keller, Begründung schreiben für die Bezirksregierung (der Unterricht war wohl nicht kognitiv aktivieren genug). Es ist ein Trauerspiel!
Das allerdings ist teilweise Stoff der Sekundarstufe 2.
Nicht nur Sek II, eher Hochschule oder aktuelle Forschung. Ich wollte damit auch nur eher sagen, dass solch komplexe Aufgaben mit den schulischen Methoden absolut unlösbar sind oder keinerlei Aussagekraft haben.
Kann man nicht, es wird trotzdem gemacht…”Eine Firma modelliert ihren Gewinn mit einer ganzrationalen Funktion dritten Grades…” – Realität: der Mathematiker, der eine Gewinnerwartung mit einer ganzrationalen Funktion dritten Grades modelliert, wird direkt gefeuert…”Ein Küstenufer verläuft entlang der ganrqtionalen Funktion….” Ne, ist klar.
“Ein Flugtaxi fliegt auf einer exakt gerade Flugbahn vom Dach eines Hochhauses zum anderen….”
Und so weiter….die Kinder rufen…
Oooch, wir hatten im Matheabi auch schon Vögel, die sich auf geradlinigen Flugbahnen mit exakt gleichbleibender Geschwindigkeit bewegt haben – im Morgengrauen. Sehr poetischer Text, und dann sollte so voll lebensrealistisch geprüft werden, ob der Raubvogel den anderen Vogel trifft…
Ich sage ja, es wird trotzdem gemacht…
Die Lebenswirklichkeit der Offshore-Windparkanlagen in Bayern …
Auf Aufgaben wie den Offshore-Park wäre ich früher schon drauf abgefahren. Ich war zu meiner Schulzeit auf einem math./nat. Gymnasium. Da gab es neben dem üblichen langweiligen und trockenen Matheunterricht nach Buch auch einen Lehrer, der mit uns tatsächlich auch praxisorientierte Situationsaufgaben gemacht hat. Er hat uns z.B. eine Skiflugschanze planen lassen, auf der ein Skispringer bei optimaler Flugbahn einen Sprung von 200m hätte stehen könnte (wäre damals Weltrekord gewesen). War natürlich völlig sexistisch, da Skifliegen damals noch eine Männerdomäne war. Auch als wir unsere Luftdruckgewehre mit ins Physiklabor brachten um die Austrittsgeschwindigkeit der Geschosse zu bestimmen, hatten da nur Jungs ein Anschauungsobjekt dabei. Die Aufgabe eine Steilkurve für einen Hochgeschwindigkeitszug so zu planen, dass es weder die Fahrgäste aus den Sitzen schmeißt noch der Zug entgleist, hat die Jungs auch deutlich stärker interessiert als die wenigen Mädchen in der Klasse. Die strukturelle Benachteiligung der Mädchen habe ich damals aber nicht so stark wahrgenommen; ich fand den Unterricht einfach nur spannend und motivierend.
” zum Beispiel mit der Frage, wie sich Offshore-Windparkanlagen so bauen lassen, dass sie die Meeresflora und -fauna möglichst geringfügig stören. ”
Fächerübergreifend stellte ich in einer Abschlussklasse sehr wohl Interesse fest. Meine Mitarbeiter hatten die Möglichkeit sich bei einer beliebten grundsoliden Firma und einem Forschungsinstitut ( tätig nicht nur im Bereich Windkraft ) zu bewerben.
Immerhin ein Drittel wählten die Variante Forschungsmitarbeit.
Gefragt nach dem Warum, kam
( Beispiele):
interessante zukunftsweisende Arbeit, buntes Team, vlt kein Studium mehr möglich oder vlt dual, Bezahlung des öffentlichen Dienstes, Windenergie als Teil eines neuen Konzepts schonenden Einbezugs der Natur ins Energiekonzept – besser als für den Bau von Eautos ganze Landstreifen zu entwässern…..
Zugegeben, ich schrieb ja bereits Mitarbeiter, geschehen in einer richtig guten Klasse, allerdings mit bunter Vorbildung ( macht so richtig Spaß 🙂
Der gute Mann redet von der Sekundarstufe 1. Wer so was faselt, der hat keine Ahnung von den Zuständen da. Wenn so was möglich wäre, dann hätte ich da richtig Lust das umzusetzen.
So lange kümmere ich mich um die Berechnung von Handyverträgen, Abokosten für Computerspiele oder die Abzocke bei Preisnachlässen. Und selbst da hat keine Bock drauf.
Läuft bei mir teils auch, bspw. alle Jahre wieder in 10 > vom Bruttolohn zum Nettolohn.
Da ich die BSklassen 10 bis 13, FOS/BOSabschlussK und , wenn nötig, die Techniker bedienen darf, ist die Zuordnung zu SekI/II nicht möglich – die meisten sind damit mehr oder weniger lange fertig.
Windkraft kommt bei uns von der Fachrichtung her gut an – in SekI bliebe es wohl nur beim Reinschnuppern ( und dazu ist wohl keine Zeit ).
Oh, sorry
* vlt kein Studium mehr ! nötig
sollte es heißen
„ Die Aufgaben sind stets so komplex, dass sie nur unter Zuhilfenahme des Wissens und Könnens der Mitschülerinnen und Mitschüler sowie weiterer Quellen in der vorgegebenen Zeit bearbeitet werden können.“
Theorie: Die SuS arbeiten kollaborativ am Problem, um es in der vorgegebenen Zeit zu lösen.
Praxis: Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit liegen die Aufgaben genauso da wie vorher, dafür hat man die Englisch-HA abgeschrieben und sich ansonsten über die neuesten Tiktok-Challenges ausgetauscht. Am Abend wütende Emails der Eltern, wie die arme Elaine/der arme Torben / … bei so einem Blödsinn was lernen soll. Wenn ich den Kindern nicht erkläre, wie man das Problem löst, können sie das ja nicht lernen. Und wehe, ich prüfe da irgendwas ab, dann gehe man vor Gericht: schließlich hätte ich den Kindern ja nicht gezeigt, wie man das macht!
Alles schon gemacht, alles schon erlebt – am Gymnasium.
Willkommen in der Realität!
Das sind doch tolle Aufgaben! Mit Lebensweltbezug!
Im Matheunterricht wird folgende Aufgabe gestellt: (beliebig ausdenken – wichtig nur GA und eigenverantwortliches Tun).
Dann (und das ist die eigentliche Aufgabe!): Schätzen lassen, wieviele Eltern wutentbrannt anrufen, wieviele eine Mail schicken und mit dem RA drohen.
Anwaltskosten berechnen lassen.
Fertig.
Ich sehe seit Jaaaahren zunehmende Unselbstständigkeit der SuS.
Seltenst sind die SuS in der Kage oder Willens, Vorgemachtes (praktischer Bereich VB) nachzumachen. Nichts mit vormachen und nachmachen! Klappt seit Jahren nicht mehr.
Bin auf einer GemS, hier gibt es noch Praxis. Ist zum Haare raufen, was Selbstständigkeit betrifft.
„ Adaptivität: Orientierung des Unterrichts an den jeweiligen Lernständen der Schülerinnen und Schüler.“
Da hab ich ein Problem: Ich habe in der 11. Klasse des Gymnasiums SuS, welche nicht ohne Taschenrechner im Bereich der Ganzen Zahlen rechnen können (also Aufgaben der Art (-4)*(+11)=???) und ich habe aktuell eine, die sich selbstständig mit Zahlentheorie (Primzahlen und Eulerprodukt) beschäftigt. Dazwischen gibt es alle Schattierungen. Welchen Lernstand soll ich nehmen? Wenn’s nach dem mittleren Lernstand geht, sollt ich in Klasse 11 ungefähr den Stand von Klasse 9 annehmen. Aber nur mit Taschenrechner…
Da sind sie nicht alleine.
-ln(5) * x = ln(7)
wird aufgelöst mit + ln(5) zu
x = ln(7)+ ln(5) = ln(12).
Was soll man da noch an den Rand schreiben? Doppelt falsch. Falsch^2.
Vermutlich liegt es daran, dass mein Unterricht nicht kognitiv aktivierend ist.
Rechnen im Zahlenraum bis 50 ohne Taschenrechner ist in der 11 ein Riesenproblem. Bruchrechnen geht gar nicht.
Grundschulwissen aufwärts fehlt. Mathematik als Spiralcurriculum. Gott sei Dank nicht auch noch logarithmisch, eher archimedisch. Aber dennoch voller Löcher.
Ich habe keinen Einblick, wie Mathematikunterricht in Singapur, China usw aussieht. Aber könnten wir nicht “einfach” deren erfolgreiche Konzepte übernehmen?
Warum muss ich mir immer Geschwurbel wie folgendes anhören:
“Mit der Methode des kollaborativen problembasierten Lernens können doppelt so große Lernfortschritte erzielt werden wie in einem Jahr Mathematikunterricht in der Sekundarstufe I.“
Können aber auch nicht.
Ich wäre vorsichtig damit einfach Konzepte von Ländern pauschal übernehmen zu wollen, nur weil die eine höhere Durchschnittspunktzahl bei PISA aufweisen als Gesamt-DE. Da müsste m.M. vorher schon untersucht werden, ob ein kausaler Zusammenhang zwischen Methodik und Erfolg besteht und wie wahrscheinlich es wäre, dass das an Schulen in DE ebenso wirksam sein könnte wie im Ursprungsland. Ist ja noch nicht lange her, da galt z.B. Finnland als der PISA-Leuchturm, dem DE so gut wie möglich nacheifern sollte. Im Hinblick auf die Entwicklung der Leistungsniveaus haben Sachsen und Bayern vermutlich gut daran getan, das nicht tun.
Finnland hat damals vom gerade erst abgeschafften Frontalunterricht profitiert…
Die Frage ist nur, ob Konzepte aus fer Retorte, für die es keine Langzeiterfahrungen mit normalen SchülerInnen gibt, mit denen aber doppelt so große Lernfortschritte gemacht werden KÖNNTEN besser helfen.
Da nehme ich lieber in anderen Ländern erprobtes.
Fragen Sie mal einen Asiaten: “Was tun denn da die Legrer, um die Kinder zu motivieren, Schule ernst zu nehmen?”
Wenn er/sie mit lächeln aufhört, wird er/sie eventuell lachen (kommt öfters vor), weil er die Frage für Ironie/Satire hält – da ja das Auf-den-Kopf-stellen der Realität ein klassisches Merkmal selbiger ist.
Tuut-tuuuuuuut….hier kommt der Bildungszug…uuuuund da ist er auch schon vorbeigerauscht Richtung Indien, China, Korea, Vietnam…
Wäre mal interessant zu erfahren, wie hoch die durchschnittlichen Punktzahlen bei PISA 2022 in Mathe für die Teilgruppe der Probanden aus Sachsen mit entsprechendem Migrationshintergrund wohl wären. .
Pisa oder fiesa, Fuesta oder Siesta…interessant wäre ja, was GEKONNT wird. So, in Echt und so.
Ach so, währenddessen in China:
https://m.youtube.com/watch?v=ZoRVpz0bUEk
…und nein, es geht NICHT um Details und JA, die Quelle ist ein Staatsmedium…es geht darum, welche Einstellung, welcher ***Bildungszugang*** daraus spricht.
Aber ist cool, verschmelzt mal noch ein paar Fächer, bis alle nur noch affektive Inhalte und erwünschte “Haltungen” singen (notenfrei, versteht sich) – Länder wie China pumpen halt einfach weiter Ingineure raus.
Ich habe in meiner Schulzeit vermutlich bei fast 99% der Aufgaben in Mathematik und Physik keinen Bezug zu meinem Alltag feststellen können. Für ein Studium der Mathematik mit Nebenfach Physik und Astronomie hat’s allemal gereicht. Köller dagegen hat Psychologie studiert und will mir jetzt Mathematik und Unterricht erklären. Mein Wortschatz würde schon ausreichen, das angemessen zu kommentieren, aber . . . .
Das Problem am Matheunterricht ist doch, dass er zu schlampig unterrichtet wird. Die Theorie wird nicht verständlich erklärt, und bei Lösungen fehlen zu viele Lösungsschritte und der mathematische Ansatz fehlt oft. Das hat mir zwar als Studentin als Nachhilfelehrerin etwas Geld eingebracht, aber objektiv sinnvoll ist das nicht.
Sprachlicher Murks: Mathematikunterricht wird nicht unterrichtet, es ist Mathematik.
Wer so die Klappe aufreißt und pauschal urteilt, sollte der Sprache, die er benutzt, mächtig sein und nicht noch Nachhilfe geben.
Mach ich aber, da sich die Schüler um ein bis zwei Noten bei mir verbessern.
Natürlich, verbessern sich Ihre Nachhilfeschüler… und zwar aus dem Grund, dass sich eine mathematisch-kompetente Person in KLEINgruppen (wenn nicht sogar einzeln) eine ganze Stunde Zeit für sie nimmt und alles erklärt und einüben lässt. Bevor Sie aber pauschal alle Mathelehrer abstrafen, sollten Sie sich fragen, wo der Unterschied zwischen Nachhilfe und Schule liegt…
Und im Allgemeinen löhnen die Eltern für die Nachhilfe. Wenn dann das Feedback kommt, dass der Sprössling eher desinteressiert aus dem Fenster schaut und die Mitarbeit verweigert, wird i.d.R. elterlicherseits auf das Verhalten des Kindes eingewirkt. Ganz anders bei gleichem Verhalten in der Schule…
Im Wesentlichen liegt der Unterschied darin, dass ich die Sachen ausführlich erkläre. Ich sehe ja anhand der Hefteintrage meiner Kinder und meiner Nachhilfeschüler, wie lückenhaft der Stoff erklärt wird.
Aus den Hefteinträgen können Sie nicht auf die Erklärweise schließen.
Der größte Unterschied zwischen Nachhilfe und Unterricht ist die um mindestens 25 Schülerinnen und Schüler kleinere Gruppengröße.
Doch, genau auf die Hefteinträge kommt es an, da man ja sich nicht alles merkt, was so im Unterricht erzählt wird. Die lückenhaften Lösungen störten mich schon als Schülerin, und auch jetzt merke ich, wie wichtig es ist, Lösungen ausreichend ausführlich darzulegen.
Sie können noch so lückenlos erklären und lückenlos an die Tafel schreiben: wenn‘s der Schüler nicht abschreibt oder falsch abschreibt, ist die Lücke/der Fehler im Heft. Und hier zeigt sich der Unterschied zum Einzelunterricht/Nachhilfe: da sieht der Lehrer, ob alles abgeschrieben wurde oder nicht.
Naja, die Frage ist, wird es so schlampig unterrichtet, oder landet so wenig in den Heften der Nachhilfekandidaten. Ich liebe die Möglichkeiten, die wir jetzt mit Moodle und den Ipafs haben…vollständige Tafelbilder stehen alle online…interessant ist, was in den Heften der schwachen Schüler und was im Regelheft steht bzw. ob das überhaupt geführt wird….
“Meine 7”: die komplette Berichtigung der Arbeit haben wir gemeinsam besprochen, ausführlich mit jedem noch so kleinen Lösungsschritt. Das Tafelbild mit der kompletten Lösung steht online, die Schüler sollen als Hausaufgabe noch einmal in Ruhe ihre Fehler berichtigen, wenn sie hängen, stehen die Lösungen ja online. Preisfrage: Wie viele Schüler (Gymnasium) von 31 haben eine komplette Berichtigung in der nächsten Stunde (es war eine Woche Zeit) dabei? Wie viele haben die Unterschrift ihrer Eltern dabei? O.k., meine beiden besten Schüler hatten in der Arbeit gar nichts falsch, die nehmen wir mal raus…Antwort: 4. 4 Kinder haben es geschafft, eine Lösung richtig abzuschreiben. Wenn man aber sieht, wie die z.T. arbeiten bzw Aufgaben und Lösungen aufschreiben (oder eben nicht), wundert mich nichts. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Positivbeispiele, die haben meistens dann auch kein Problmen im Mathe…die arbeiten aber auch super in Phasen der Freiarbeit oder in Gruppenarbeiten mit…
Tatsächlich sind die Anschriebe lückenhaft. Ich sehe das ja selbst bei den Tafelanschrieben der Kollegen, und die Töchter und deren Freundinnen haben alle dasselbe in ihren Heften stehen. Es kann aber natürlich sein, dass das ein Problem ist, welches gymnasiumsspezifisch ist.
„Mit der Methode des kollaborativen problembasierten Lernens können doppelt so große Lernfortschritte erzielt werden wie in einem Jahr Mathematikunterricht in der Sekundarstufe I.“
Wow, ich glaube, ich bin für den Beruf des Mathematiklehrers komplett ungeeignet. Wahrscheinlich habe ich in meiner Ausbildung zu wenig kollaborativ problembasiert gelernt.
Meine Schüler spielen auf ihren Tablets Pizzabäcker (leider egal ob Unterricht ist). Sie werden es lieben, in ihrer Welt abgeholt zu werden: Bruchrechnung, Kreisgeometrie, Einheiten umrechnen, schon ist Mathematik spannend und lebensnah. Expertengruppen zur Produktion der Zutaten, Transportwegen, meinetwegen auch Bruchrechnen und fertig ist die kollaborative, motivierende Form der Matheaufgabe, sogar sprachorientiert und mit Bewertungsanteil.Nur, was passiert wenn ein Expertenwissen einer Gruppe fehlt, weil Lena krank ist, Paul einen Termin bei der Berufsberatung hat, Maryam kaum Deutsch versteht, Leon prinzipiell nie Aufgaben bearbeitet und Adrian übrig bleibt, der nie mit Mitschülern redet? …Zuhilfenahme des Wissens der Mitschüler…, soso…
Wann haben die Studienersteller eigentlich das letzte Mal eine Klasse 15jähriger Gesamtschüler in freier Wildbahn gesehen? Nie?
Ich denke um als als Bildungsexperte zu gelten, muss man im Zweifel kein Lehramtsstudium und entsprechende Praxiserfahrung als Lehrkraft vorweisen können. Ebensowenig wie man als Bildungsminister*in überhaupt einen Studienabschluss brauchen würde.
Es wäre sogar hinderlich: Man würde den eugenen Kollegen javständig in den Rücken fallen müssen mit diesen Hassfakten aus der Realität.
Ich denke da mal genauso und ein kleines bisschen weiter – ein Lehramtsstudium oder gar Praxis-Erfahrungen im eigenverantwortlichen Unterricht – sind höchst kontraproduktief, extrem hinderlich und vermutlich gar nicht zugelassen (weil Realität hier sehr unerwünscht ist), um als Experte oder Bildungsminister:in gehört, gelesen und bezahlt zu werden.
😉
Ich weiß, ich wiederhole mich, aber:
“Verstehensorientierung: Mathematisches Verständnis aufbauen”
Das beginnt im Vorschulalter zu Hause und/oder in der KiTa! – zählen/rechnen mit den Fingern, klein-groß, leicht-schwer, mehr-weniger-gleich, lang-kurz, Dinge ordnen, aufteilen, (geometrische) Formen und Größen… Und das alles lernt man am besten mit realen Gegenständen, nicht digital! Mathematik muss man begreifen! Und genau diese Grundlagen fehlen bei immer mehr Erstklässlern und das lässt sich nur schwer (kaum) aufholen!
Bin voll bei Ihnen!
Da gibt es viele schöne Tricks um im Vorschulalter das schon zu prüfen. Ein Beispiel: ein Kind hat fünf Bonbons bei sich auf dem Platz liegen. Man lockt das Kind vom Platz weg und dann entfernt man zwei Bonbons. Beim Zurückkommen des Kindes muss dann Protest kommen wie “da fehlen zwei…” o.ä. Widerwillig gibt man eins zurück und dann muss auch noch das letzte eingefordert werden. Wenn das dann auch so abläuft, ist zumindestens ein mathematisches Verständnis vorhanden.
Genau so lief das früher im Kindergarten (DDR), da gab es für jede Altersstufe festgelegte Bildungsstandards (basteln, Geschichten/Märchen hören, Reime und kleine Gedichte und Lieder lernen, erzählen, zählen, malen, rätseln,…), die je nach Alter der Kinder in täglichen gemeinsamen Beschäftigungszeiten durchgeführt wurden. Das nennt man aber heute “Drill”, da alle Kinder daran teilnehmen mussten, nix mit freiwillig. Allerdings waren die Gruppen meist altershomogen und hatten feste Bezugserzieher.
“Schon die Mathematik lehrt uns, dass man die Nullen nicht übersehen darf.” (Gabriel Laub)
“Eine Untersuchung von Prüfungsaufgaben aus dem Mathematikunterricht hat gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler bei 75 Prozent der Aufgaben keinen Bezug zu ihrem Alltag oder ihrem Umfeld herstellen konnte”
Das wird in den Raum gestellt als Tatsache, die zu schlechteren Leistungen führt. Ist das denn wirklich so? Oder würden die Schüler Mathematik auch als eigene Welt mit eigenen Regeln akzeptieren? Ich stehe auch ” mädchenspezifischer” Mathematik mit Aufgaben aus der ” weiblichen Lebenswelt” kritisch gegenüber. Es will gar nicht jeder immer mit seiner Realität konfrontiert werden. Schüler machen in ihrer Freizeit auch anderes, verlieren sich teilweise in Fantasy Welten.
Die Windpark-Anlagen sind ein hehres Ziel, von der Lebenswirklichkeit der meisten Schüler jedoch ungefähr genauso weit weg wie den Bedarf an Mauersteinen für eine mittelalterliche Burg zu berechnen.
Am besten kann man etwas gut, – wenn man es gut kann. Also wenn das Handwerkszeug sitzt. Erst dann macht etwas Freude, sonst eiert man nur herum.
Als Tipp eines Professors für Mathematik aus der Lebenswelt der SchülerInnen durfte ich mal lesen, dass man mit ihnen ja mal Berechnen könnte, wieviele Farbeimer man kaufen muss, um das Zimmer zu streichen. Als ob je ein Kind in den Baumarkt fährt, um die Farbe für das Zimmer zu kaufen, geschweige denn vorher ausrechnen würde, wieviel Farbe man benötigt.
Naja, das könnte man doch gleich als Berufsorientierung verbuchen, Maler werden doch auch gesucht. 🙂
Das mit dem Zimmer ist einfach.
Beim Schwimmbecken wird’s schwierig. Die Hälfte der Schüler lässt es mit Farbe vollaufen anstatt über den Anstrich der Wände zur Isolierung nachzudenken. Von denjengen, welche die Oberfläche des Quaders erkennen, versemmelt ein Teil die Sache mit der Deckfläche.
Zum Thema Lebenswelt der Schüler und Mathematik habe ich heute ein schönes Youtube-Video gesehn.
Darin ging es darum, welches Mario-Cart-Auto man wählen sollte, um in dem Computerspiel zu gewinnen: Eher ein Auto mit hoher Beschleunigung und geringer Höchstgeschwindigkeit oder eins mit schlechterer Beschleunigung aber dafür höherer Spitzengeschwindigkeit.
In vielen Computerspielen werden Eigenschaften durch Zahlen ausgedrückt. Damit müsste man als Mathematiklehrkraft doch etwas anfangen können.
Das habe ich sogar versucht, Laminat für Zimmer mit halbrundem Erker, Antwort: Mit Rechnung kann man ganze Pakete zurückgeben. :))
Stimmt, man muss sich halt nur zu helfen wissen…
Vielleicht ist das tatsächlich so – 75% weit weg von der Lebenswelt.
Irgendwie fehlt mir hier aber das Einbeziehen der jetzigen Realität der SuS. Was machen sie, wenn sie nach Hause kommen?
Ihre “Lebens”welt hat sich durch die Medien vollkommen verändert.
Die Mathematik bleibt.
Flucht aus der Realität – oder auch schon Sucht?
Ob nun Burg oder Windpark-Anlagen…. Viele sind einfach raus aus der echten Lebenswelt (nicht das Zuhause).
Drei Probleme scheinen mir nicht ausreichend berücksichtigt:
a) Das Verständnis mathematischer Ideen wird schon zu Anfang zu wenig vermittelt!
Damit meine ich nicht einfach nur “Wozu brauchen wir das?” – was man gemeinhin “Alltagsbezug” oder “Lebensweltorientierung” nennt.
Beispiele: Weder für das auswendig (wenn überhaupt) gelernte Einmaleins noch für Multiplikation, Addition etc. haben die Kinder nach der Grundschule “ein Bild im Kopf”.
b) Das Sprachverständnis/die Lesefähigkeit/sinnentnehmendes Lesen, das Umsetzen von schriftlichen oder mündlichen Ideen in “Bilder im Kopf” funktioniert immer weniger.
Die Kinder haben wenig Sprachveständnis, können sich mathematishe Probleme daher schon rein sprachlich nicht entschlüsseln, geschweige denn in passende Vorstellungen umsetzen.
Beispiel: “Stelle zeichnerisch dar”, “beschreibe”… Kinder, die das sprachlich nicht erfassen, die nicht mit Worten beschreiben können, was sie gerade tun/rechnen/überlegen, weil ihnen der Wortschatz und das Verständnis von Zusammenhängen in Sätzen fehlt, profitieren auch nicht von auswendig gelernten “Operatoren” oder “Kompetenzen”… das Prinzip der Kompetenzvermittlung wie auch die Alltagsorientierung halte ich für “Mäntelchen”, die darüber hinwegtäuschen, wie wenig Kinder wirklich in die Auseinandersetzung mit der Welt eintauchen.
c) Kinder wachsen heute – mit Smartphone etc. – sehr zweidimensional, sehr wenig realitätsorientiert auf. Das führt m.E. dazu, dass Kinder nur sehr wenig Vorstellung von Raum, Menge, Zusammenhängen, Ursache und Wirkung haben, dass sie ihre Umwelt wenig bewusst wahrnehmen.
Beispiel: Fragte man vor 20 Jahren, wo geometrische Figuren wie ein Dreieck auftauchen, konnten Schüler spontan lauter Dreiecke in ihrer Umgebung, auf dem Schulweg, im Klassenraum nennen; heute kommt da nichts mehr; sie nehmen offenbar viel weniger wahr, haben viel mehr Probleme, sich Dinge im Kopf vorzustellen, Zusammenhänge und Muster zu
erkennen.
d) Problemlösefähigkeit ist eng verbunden mit der Fähigkeit, im Kopf mit den Gedanken zu “spielen”. Dazu muss etwas da sein, mit dem ich Ideen entwickeln kann und ich muss Zeit haben, sie hin und her zu drehen. Man könnte das auch “Langeweile” nennen – Kinder haben heute keine Zeit mehr (dank Ganztagsbespaßung), keine Muße für Eigenes, keine Anregungen, die zu neuen Ideen verknüpft werden können, weil man konkrete Probleme des Alltags lösen will (das fängt an beim Spielen im Sandkasten, geht weiter bei der Mithilfe zuhause – von vielen Kindern komplett ferngehalten).
Soo vielen Kindern fehlt die Phantasie. Sie lesen nicht mehr, um ihre Zeit zu füllen, bilden keine Bilder im Kopf, vielmehr konsumieren sie fremde Ideen (oft verhängnisvolle, und zwar ungefiltert, überfordernd, das Gehirn für andere Dinge blockierend).
Das alles wäre für MINT essentiell.
Ohne das wird es nichts werden.
Wenn ich meine Welt nicht mehr wahrnehme, sie nicht mehr sprachlich fassen kann, im Kopf nicht eigenständige Ideen bilden kann, kann ich die Welt auch nicht in mathematischen Dimensionen oder mathematische Dimensionen in der Welt erkennen.
Danke!
Sehr schön formuliert und auf den Punkt gebracht!
„ Die Begleitforschung zeige: „Mit der Methode des kollaborativen problembasierten Lernens können doppelt so große Lernfortschritte erzielt werden wie in einem Jahr Mathematikunterricht in der Sekundarstufe I.““
Meine Fragen dazu:
1. Was genau wird unter Lernfortschritt verstanden? Faktenwissen? Rechenfertigkeiten? Fähigkeiten zur Anwendung von Rechentechniken/Algorithmen auf rein mathematische Probleme? Anwendung von Rechentechniken/Algorithmen auf außermathematische Probleme? Entwicklung von Problemlösestrategien?
Der Begriff „Lernfortschritt“ ist extrem schwammig.
2. Wie wird die Zunahme des Lernfortschritts gemessen?
3. „doppelt so großer LernfortSchritt wie …“ bezieht sich auf welche Zeit des kollaborativen Problemlöseansatzes?
4. Wie waren die zu vergleichenden Gruppen (herkömmlicher Unterricht – kollaborativer Problemlöseansatz) zusammengesetzt?
Vielleicht liest ja einer der Berichtersteller mit und kann mir darauf antworten.
“Mögliche Lösung hier: für Mangelfächer wie beispielsweise Physik oder Informatik an den Universitäten Ein-Fach-Lehramtsstudiengänge einzurichten.”
Eine andere Lösung wäre auch, dass alle anfangen zu lernen, ihren Namen zu klatschen. Das ist genau so geistreich wie die kurzfristig gedachte Idee des “Ein-Fach”-Lehrers.
“Ein-Fach-Lehrer”, hm, das passt aber nicht zu dem anderen Artikel hier bei n4t “Wir müssen uns von den einzelnen Fächern verabschieden” – ja was denn nun?
Könnte die Vergrößerubg der Risikogruppe, insbesondere bei Zugewanderten, vielleicht mit Sprachbarrieren zu tun haben?
Es fällt ja schon Muttersprachlern inzwischen zum Teil schwer, die Textaufgaben zu dechiffrieren. Da braucht man sich dann auch nicht mehr wundern, wenn die Rechenarten nicht ausreichend geübt wurden, dass einiges in Vergessenheit gerät bei Untersuchungen/Testungen oder gar nicht erst erledigt werden kann, wenn Informationen nicht entnommen werden können.
Aber die Schüler wissen auch einfach immer weniger, dafür sind sie dann kompetenter. Wirklich? Sagen wir es mal so: die Kopetenz ‘Räumliches Denken’ hat jetzt nicht unbedingt zugenommen. Das kann ich aus Physik (wo es inzwischen am kleinen 1×1 scheitert bei den SuS) mehr als bestätigen. Die Schüler können noch weniger als vor 10 Jahren, wissen noch weniger als vor 10 Jahren. Hätte man in Hamburg beispielsweise eine echte Schulreform durchgezogen und nicht nur ein Sparmodell etabliert um die ungeliebten Hauptschulen abzuschaffen, gäbe es noch echte Trenung zwischen Haupt- und Realschule mit echten Aufstiegschacen, das System wäre für die Schüler gerechter.
Wie bestellt, so bekommen.
Bin auch Lehrer habe eine 11. Klasse im TG.
Die meisten Schüler scheitern bereits an simplen Aufgaben wie:
Logisch wäre es nun dort anzusetzen und das einzuüben.
Aber stattdessen sollen sie irgendwas realitätsnahes modellieren? Als naiver Lehrer fragt man sich zwei Dinge:
Insgesamt ergibt es wenig Sinn, dass man ständig weiter in diese Richtung geht obwohl die Ergebnisse immer schlechter werden.
Zu Punkt 1: Der Physikunterricht scheint sich wegzubewegen von Anwendungen der Mathematik auf physikalische Gesetze. Der Trend scheint eine Diskussion zu sein, welche Auswirkungen physikalische Dinge auf die Gesellschaft haben können. Extremes Beispiel: Atombombe. Ein Beispiel aus der Biologie: Klonen, künstliche genetische Veränderungen.
Zu Punkt 2: Das ist ein Problem, zumal Modellierungen immer schwieriger werden, je realistischer sie sind. Hier sprechen manche eben schon von “Pseudo-Modellierungen”.
Genau das ist ja auch die Agenda dahinter:
1. “Richtige” Gefühle und “Haltungen” haben – da kann dann auch jeder was quackeln.
2. Möglichst nix dabei, was kognitiv anstrengend ist.
Im übernächsten Schritt wird sich dann gewundert, wieso bei uns technologisch und wissenschaftlich nix geht.
Am Ende des TGs können die Schüler die Maßzahl der Fläche zwischen zwei Funktiosgraphen mittels Integral ausrechnen (hilfsweise mittels Kästchenzählen), aber zwei ungleichnamige Brüche nicht addieren.
Das Fundament, auf welches das Berufliche Gymnasium aufbaut ist marode und trägt nicht.
Der Übergang zum BG ist problematisch und das ist bekannt, aber geändert wir daran nichts. Es werden nur Schülergenerationen frustriert und Mathe-Lehrer verbrannt.
Es wäre schön, wenn die Erkenntnisse der Bildungsforschung uns Lehrkräften motivierend, lebensweltnah, möglichst kompetenzorientiert und faktenreduziert, selbstbestimmt in Umfang und Inhalt lernend, von stets ansprechbaren Coaches begleitet, binnendifferenziert und inklusiv, hybrid in angenehmer, gut ausgestatteter Lernumgebung mit Rückzugsorten und Lerninseln nahegebracht würden (wo sind die Hilfekärtchen?).
Mir fehlen noch inspirierend, hypersensibel, emotional ausgleichend, Erfolg partizipierend, wertneutral, angstfrei, Wohlfühl-Ambiente (Lernoase statt Lerninsel) und Klangschale.
Sonst bin ich emotional und kognitiv zu stark herausgefordert von all den Erkenntnissen (Ergüssen).
Finden Sie das motivierend, dass Sie mich hier verbessern? 😉
Sorry. Wollte Sie nicht verbessern oder ideologisch bevormunden nur kollegial kompetenzenkompetent, persönlichkeits- und zieldifferenziert, in höchstem Maße wertschätzend, zeitgeistkonform, floskelintensiv sowie zeitnah und mit höchstem Respekt für ihre individuell eingebrachte Meinungsäußerung, unter Beachtung Ihrer motivationalen Dispositionen, anwendungsbezogen ergänzen.
Danke, das reicht als Motivation für die Restwoche 🙂
Tja ums mal ganz einfach zu sagen, ohne die (abstrakten) Grundlagen brauch ich keine Lebensweltaufgaben (Transfer) zu stellen. Bis man aber die Grundlagen vermittelt und eingeübt hat, sind die 12 Std nach Lehrplan rum. Dann muss man weiter machen.
Zum Thema doppelter Lernfortschritt: Laborsetting vs Realität bedenken? 1. Semester wissenschaftliches Arbeiten?