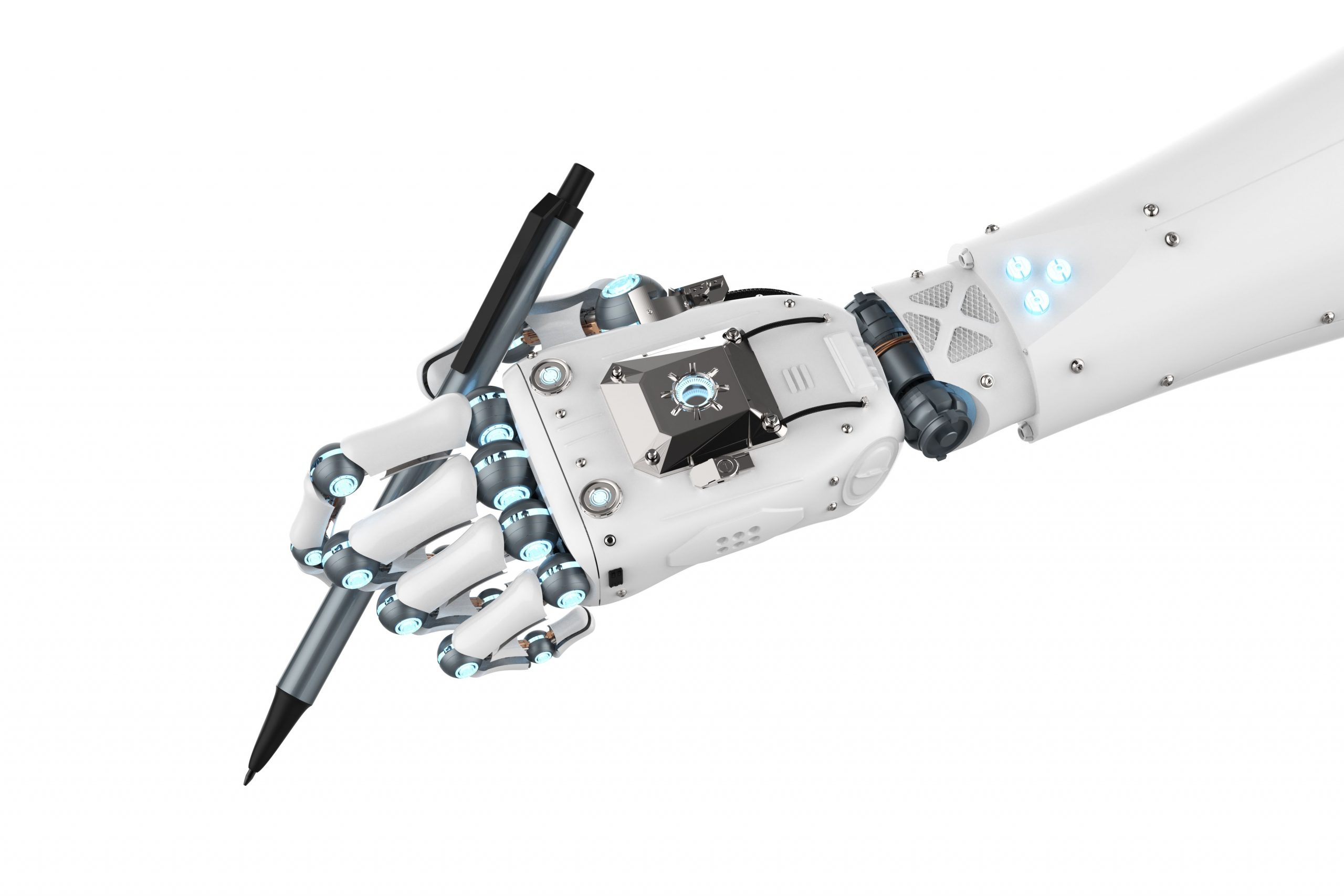
Für viele Studierende beginnt im Frühjahr die Klausuren- und Hausarbeitsphase. Es ist eine stressige Zeit, in der der Druck oft hoch ist. Ein neues Hilfsmittel sorgt vermeintlich für Erleichterung: der Text-Roboter ChatGPT. Diese künstliche Intelligenz (KI) kann in wenigen Sekunden Texte erstellen – von Gliederungen bis hin zu vollständigen Hausarbeiten. Wie gehen Hochschulen mit dem potenziellen Betrug um? Und was bedeutet das für die Lehre?
Keine einheitlichen Regeln für KI-Texte
An der Universität Kassel sind bislang keine Verstöße durch den unerlaubten Einsatz von KI offiziell bekannt. Die Hochschule setzt auf Vertrauen: Studierende müssen Eigenständigkeitserklärungen abgeben, in denen sie bestätigen, keine unzulässigen Hilfsmittel genutzt zu haben. Ein spezielles Tool zur Erkennung von KI-generierten Texten werde nicht eingesetzt.
«Beweise könne ein solches System ohnehin nicht liefern», heißt es von der Universität. Statt auf universelle Regeln zu setzen, werden Standards je nach Kontext und Prüfungsform definiert. Ein grundlegendes Positionspapier zum Umgang mit KI in der Lehre wurde bereits erarbeitet.
An der Goethe-Universität Frankfurt seien vereinzelt nachweislich Fälle von KI-Betrug bekannt, teilte die Pressestelle mit. Wichtiger als das Erkennen von Täuschungsversuchen sei die Vorbeugung dieser. Das gelinge durch Information, offenen Austausch und klare Regelungen. Tools zur Erkennung von Plagiaten würden sich gerade in der Testphase befinden. Bisher wären die Ergebnisse dieser jedoch sehr unzuverlässig gewesen und dürften auch rechtlich nicht verwendet werden, hieß es.
Die Universität räumte ein, dass «die Nutzung von KI mittlerweile zum wissenschaftlichen Alltag gehört.» Studierende sollen die KI als Hilfsmittel für das eigenständige Arbeiten einsetzen, nicht als Ersatz dafür.
Vertrauen statt Kontrolle
Christiane Jost, Vizepräsidentin für Studium und Lehre an der Hochschule Rhein-Main, berichtet von Einzelfällen, in denen der Verdacht auf KI-Betrug bestand. Zwar verfügt die Hochschule über eine Software zur KI-Erkennung, diese wird jedoch wegen ihrer geringen Zuverlässigkeit nicht genutzt. Stattdessen verfolgt die Hochschule eine offene Strategie:
«Wir raten dazu, KI zuzulassen», erklärt Jost. Studierende sollen dokumentieren, wie sie KI im Arbeitsprozess eingesetzt haben, ähnlich wie bei einem Laborbericht. Dabei werden Eingaben, sogenannte Prompts, Ideen und Ergebnisse nachvollziehbar beschrieben.
Die Aufgabenstellungen haben sich ebenfalls verändert: mehr Praxisberichte, weniger Buchwissenschaft. Zudem wird diskutiert, schriftliche Arbeiten künftig mit mündlichen Prüfungen zu kombinieren, um sicherzustellen, dass Studierende den Stoff verstanden haben. «KI wird in der Arbeitswelt eine große Rolle spielen. Wir müssen Studierende darauf vorbereiten und ihnen Kompetenzen im Umgang mit solchen Tools vermitteln», so Jost.
Kein Eingreifen auf Landesebene
Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst sieht aktuell keine Notwendigkeit für eine landesweite Regulierung. Hochschulen sollen eigenständig entscheiden, wie sie mit KI umgehen. Dabei sei entscheidend, dass die Fachkulturen und Fakultäten klären, in welcher Form KI in die Lehre und Prüfungen einbezogen wird. «Die Nutzung von generativer KI ist nicht zwangsläufig ein Betrugsversuch. Entscheidend ist das Maß der geistigen Eigenleistung», betont das Ministerium.
Tests hätten gezeigt, dass KI-generierte Texte in den meisten Fächern bei einer normalen Korrektur auffallen würden. Dennoch müssten Prüfungsformate an aktuelle Entwicklungen angepasst werden. Workshops und Fortbildungen unterstützen Hochschulen dabei, den Umgang mit KI in der Lehre weiterzuentwickeln.
Perspektive der Studierenden
Tjark Kandulski, Student an der Goethe-Universität Frankfurt und Mitglied des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA), sieht im KI-Betrug ein Symptom tieferliegender Probleme: «Dass Aufgaben mit KI beantwortet werden können, zeigt, dass unsere Prüfungsformen überarbeitet werden müssen», erklärt er. Der hohe Leistungsdruck und prekäre Bedingungen würden viele Studierende dazu zwingen, unkonventionelle Mittel zu nutzen, um erfolgreich zu sein.
Kandulski plädiert für einen Fokus auf intrinsische Motivation: «Wenn Bildung ernsthaft gefördert wird, würden Studierende die KI eher als Unterstützung denn als Ersatz nutzen.» Er verweist auf eine Hochschule in Tschechien, die schriftliche Bachelorprüfungen abgeschafft hat, um alternative Prüfungsformate zu erproben. Von Clara Stritzinger, dpa
Bob Blume: Hausaufgaben haben in Zeiten von KI ihren Sinn verloren
Ja, es neigt mancher Primat
gern auch mal zum Plagiat.
Ganz bewusst wird falsch zitiert,
hat manche(n) schon zu Ruhm geführt.
Früher wenigstens noch “recherchiert” auf Wiki
mit ChatGPT ist’s nur noch ein Quickie.
Studierende sind da keineswegs allein.
Es reih(t)en sich sehr viele “Koryphäen” ein.
Ob akademische oder politische Karriere steil bergauf
geht’s mit Doktorarbeit und geschöntem Lebenslauf.
Da ist vieles nur geklaut, nur kopiert und geraubt.
Mit Selbstverständlichkeit hat man sich das erlaubt.
Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt.
Wird das toll, wenn wir mit Spezialisten geflutet werden, die ihr Handwerk am Ende gar nicht mehr verstehen…
Werden wir doch schon seit Jahren …
An den Fakultäten, Instituten, Lehrstühlen etc. die ich kenne, wird seit Ewigkeiten obligatorisch mit allerlei Software zur Plafgatserkennung gearbeitet, was Seminar- und Abschlussarbeiten betrifft (und das hat zu Zeiten meiner Dissertation damals schon hervorragend funktioniert).
KI hat die Karten aber neu gemischt, weil ja tatsächlich komplett neue Texte kreirt werden, die die Reglements ordentlicher Zitation einhalten können (etc.); es brauchte dafür früher einen Ghostwriter, der nicht günstg war und auch das Überwinden einer etwas größeren Hemmschwelle voraussetzte.
Ergo: Das Gros der Absolventen wird aus eigener Kraft zum Abschluss gekommen sein.
Heuze ist die Gefahr erhebloch größer, dass dem nicht so ist.
Man wird Prüfungsformate ändern, bspw. die Disputation für Seminararbeiten verbindlich machen und bei Abschlussprüfungen auf das Rigorosum setzen müssen.
… was das an Ressourcen verschlingt, möchte ich mir gar nicht ausmalen………
Es ist mit dem derzeitigen Personalschlüssel einfach nicht leistbar. Das wird insbesondere für die “geisteswissenschaftlichen Fächer” ein großes Problem, da deren “wissenschaftliche Arbeit” zum großen Teil auf dem Anfertigen von schriftlichen Hausarbeiten besteht, da kann man nicht für jeden zu jedem Thema ein halbstündiges Kolloquium veranstalten, insbesondere da die Themen oft zu speziell sind: Wer soll sich da auskennen? Und um das einigermaßen rechtssicher zu machen, braucht man mindestens zwei Personen als Prüfer.
Aber andererseits kann man das Ganze auch als “Demokratisierung” der Wissenschaft verstehen: Wer genug Geld hatte, konnte sich die entsprechenden wissenschaftlichen Arbeiten schon immer bei Ghostwritern einkaufen…
Erster Absatz:
Mein Reden… würde aber das zweite Paar Anführungszeichen weglassen und eher auf eine Prüfungskommission aus drei Leuten setzen.
*Plagiatserkennung
*Heute
*erheblich
Ernsthaft? Man “hofft auf Ehrlichkeit”? Kein Wunder, dass Deutschland langsam abgehängt wird. Und man “diskutiert” immer noch neue Prüfungsformate wie Kolloquien um sicherzustellen, ob der Stoff verstanden wurde??
“Wer in der Schule nicht lernt, Leistung zu erbringen, kann das im Studium nur selten kompensieren. Schlussfolgerungen für die Sinnhaftigkeit derzeit immer weniger erwünschter Leistungsanforderungen in der Schule bleiben dem geneigten Leser überlassen.”
Haben Sie diesen Spruch von einer blauen oder gelben Partei abgekupfert? Wie soll Schule kompensieren, was sich gesamtgesellschaftlich schon lange etabliert hat:
Diese Entwicklung ging “von oben nach unten” in genau dieser Reihenfolge und fing in den 90er-Jahren an, und jetzt machen Sie den ausgerechnet den Schulen den Vorwurf “fehlenden Leistungswillens”?