MÜNCHEN. Handschrift und Rechtschreibung gehören zusammen – und sie sind mehr als nostalgische Kulturtechniken. Eine aktuelle Studie aus Norwegen zeigt, dass Schreiben mit der Hand das Gehirn stärker aktiviert als Tippen. Lehrkräfte in Deutschland bestätigen das: Wer die Buchstaben nicht formt, verliert auch beim Rechtschreiben an Sicherheit. Der Philologenverband fordert deshalb ein entschiedenes Gegensteuern – und warnt: Ohne die Handschrift drohen Lücken im Fundament sprachlicher Bildung. Ein Beitrag zum Tag der deutschen Sprache am (heutigen) 13. September.
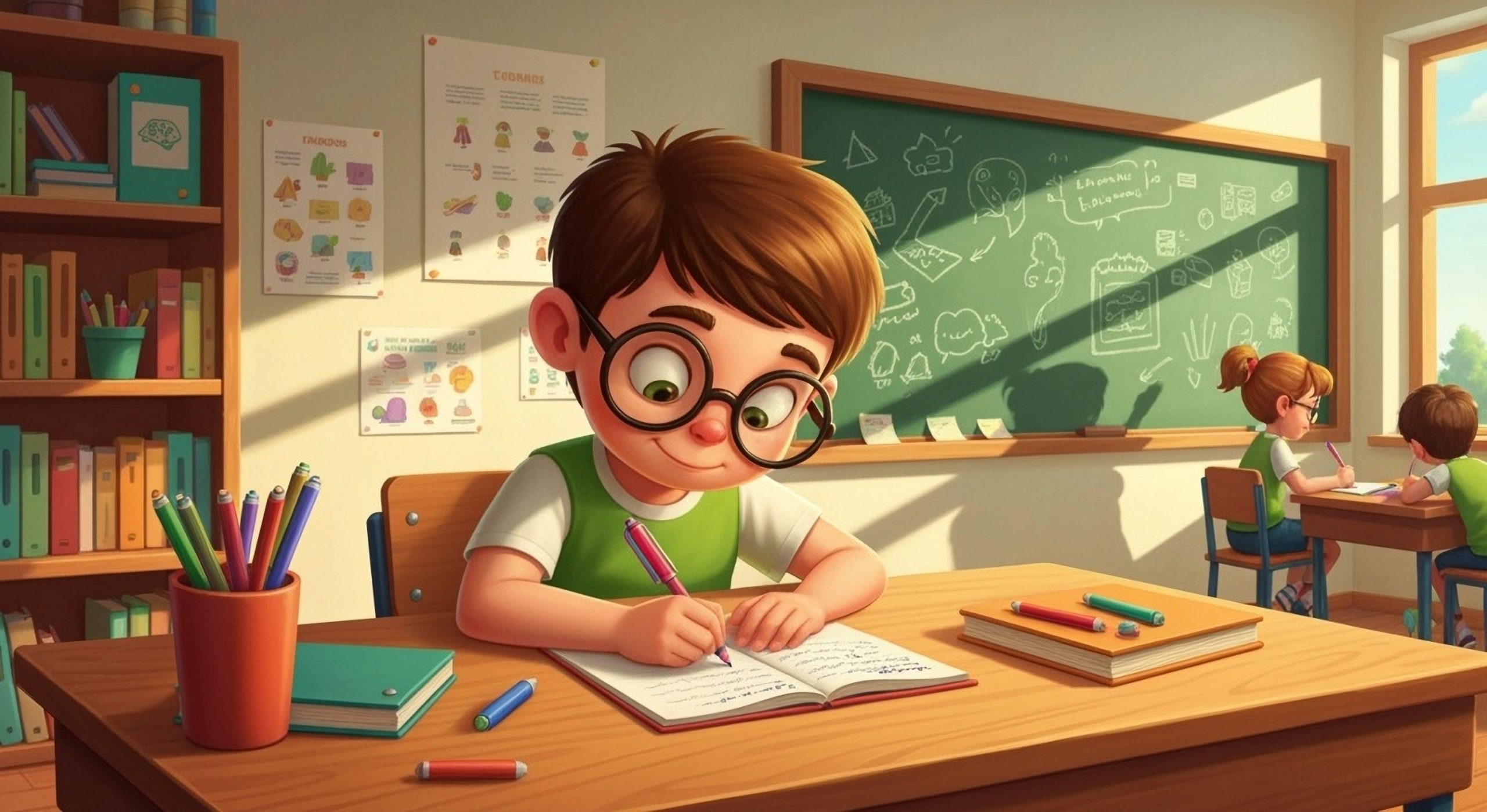
Die Szene wirkt zunächst unspektakulär: 36 Studierende sitzen in einem Labor in Trondheim, jeder mit einer Art Netz über dem Kopf – gespickt mit 256 kleinen Sensoren. Per EEG messen die Forschenden, was im Gehirn geschieht, während die Probandinnen und Probanden Wörter auf einen Bildschirm schreiben oder dieselben Wörter per Tastatur tippen. Der Versuchsaufbau ist simpel: Mal gleitet der digitale Stift in Schreibschrift über die Touch-Oberfläche, mal tippt ein einzelner Finger wiederholt dieselben Tasten. Doch die Ergebnisse sind deutlich: Schreiben mit der Hand führt zu einer intensiveren Vernetzung im Gehirn als Tippen.
Rechtschreibförderung – aber wie? Diese Frage stellt sich insbesondere an der weiterführenden Schule in den 5. und 6. Klassen immer wieder neu. Das Lernserver-Institut von Prof. Friedrich Schönweiss und seinem Team unterstützt Lehrkräfte mit einem wissenschaftlich fundierten, in der Praxis leicht einsetzbaren Konzept für die Sicherung von Rechtschreibkompetenzen.
Das Prinzip: Auf eine einfach durchzuführende Testung (Münsteraner Rechtschreibanalyse) folgen eine ausführliche Fehleranalyse und die Ermittlung des Förderbedarfs. Daraus erstellt das Tool, begleitet und überwacht von Sprachwissenschaftlern und Lerntherapeuten, individuelle Förderpläne mit konkreten Materialien und didaktischen Hilfestellungen; diese können dann von Lehr- und Förderkräften an der Schule, aber auch in der Nachhilfe oder zuhause gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen umgesetzt werden.
Mit den Lernserver-Materialien arbeiten Kinder ab der 1. Klasse bis hin zu Jugendlichen im Ausbildungsalter. Das Besondere: Die Materialien setzen genau dort an, wo der Schüler oder die Schülerin zuerst Unterstützung braucht – falls nötig noch vor dem orthographischen Bereich. Dadurch wird das notwendige Grundlagenwissen (auch für Kinder mit geringen Deutschkenntnissen oder Deutsch als Zweitsprache) sichergestellt. Mit einem B-Test lässt sich der Kompetenzzuwachs überprüfen und veranschaulichen.
Interessiert? Hier gibt es alle Informationen – schauen Sie vorbei: www.lernserver.de/deutsch.html
Der Lernserver veranstaltet außerdem regelmäßig Webinare rund um den Schriftspracherwerb: www.lernserver.de/der-lernserver/fortbildungen/webinare.html
„Wir zeigen, dass beim Schreiben von Hand die Muster der Gehirnkonnektivität weitaus komplexer sind als beim Tippen auf einer Tastatur“, sagt die Neurowissenschaftlerin Prof. Audrey van der Meer von der Norwegian University of Science and Technology. „Eine so weit verbreitete Konnektivität im Gehirn ist entscheidend für die Gedächtnisbildung und das Enkodieren neuer Informationen – und daher für das Lernen von Vorteil.“
Die Forschenden verweisen darauf, dass es nicht die Technik – digitaler Stift oder Papier – sei, die den Unterschied macht, sondern die motorische Tätigkeit selbst. Beim Schreiben werden feinmotorische Bewegungen ausgeführt, Buchstaben geformt und visuelle Reize stärker verarbeitet. „Unsere Ergebnisse legen nahe, dass die visuellen und motorischen Informationen, die durch die präzise kontrollierten Handbewegungen beim Schreiben mit einem Stift gewonnen werden, wesentlich zu den Konnektivitätsmustern des Gehirns beitragen, die das Lernen fördern“, erklärt van der Meer.
Anders beim Tippen: Der immer gleiche Tastendruck mit einem Finger löst weniger komplexe Aktivitäten im Gehirn aus. Van der Meer illustriert die Folgen am Beispiel des Schriftspracherwerbs: „Das erklärt auch, warum Kinder, die gelernt haben, auf einem Tablet zu schreiben und zu lesen, Schwierigkeiten haben können, zwischen Buchstaben zu unterscheiden, die Spiegelbilder voneinander sind – etwa ‚b‘ und ‚d‘. Sie haben buchstäblich nicht mit ihrem Körper gespürt, wie es sich anfühlt, diese Buchstaben zu schreiben.“
Handschreiben fürs Gedächtnis
Das Experiment bestätigt, was viele Pädagoginnen und Pädagogen aus Erfahrung wissen: Wer von Hand schreibt, erinnert sich besser. Die Studie verweist auf zahlreiche Befunde, dass Handschrift nicht nur die Rechtschreibung fördert, sondern auch beim Abspeichern von Wissen hilft. „Es gibt einige Hinweise darauf, dass Studierende mehr lernen und sich besser erinnern, wenn sie handschriftliche Vorlesungsnotizen machen, während die Nutzung eines Computers mit Tastatur praktischer sein kann, wenn es darum geht, einen langen Text oder Aufsatz zu schreiben“, resümiert van der Meer.
Klagen aus der Schulpraxis
Dass die Handschrift zunehmend verdrängt wird – diese Entwicklung treibt auch Lehrkräfte in Deutschland um. „Im Digitalen ist das Tippen von Texten auf dem Vormarsch. Doch wie an so vielen Stellen haben analoge Methoden ganz besonders bei Lernprozessen ihre absolute Berechtigung!“, mahnt Dagmar Bär, stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Philologenverbands (bpv). „Erst wenn ich die deutsche Sprache sicher in Wort und Schrift beherrsche, kann ich in der digitalen Welt methodisch, sachlich und souverän darauf aufbauen.“
Dabei geht es längst nicht nur um das Tempo und die Lesbarkeit. Auch die Rechtschreibkompetenz der Schülerinnen und Schüler bereitet Sorgen. „Wir beobachten, dass viele Kinder und Jugendliche beim Schreiben fast selbstverständlich auf die automatische Korrekturfunktion am Computer vertrauen. Wenn diese fehlt, treten eklatante Lücken zutage – von der Groß- und Kleinschreibung bis zur Zeichensetzung“, warnt Bär. „Rechtschreibung wird zu oft als Nebensache gesehen, dabei ist sie Grundlage für die klare schriftliche Kommunikation.“
Lehrkräfte berichten, dass das langsame Schreiben und ein unsicheres Schriftbild häufig mit Problemen in der Rechtschreibung einhergehen. Wer Buchstaben nicht bewusst formt, habe auch größere Schwierigkeiten, Laut-Buchstaben-Zuordnungen zu verinnerlichen. „Das zeigt sich dann sehr deutlich in Diktaten oder Aufsätzen, wo selbst grundlegende Regeln nicht mehr beherrscht werden“, so Bär.
Einige Schulen reagieren, indem sie Rechtschreibung wieder verstärkt trainieren und dabei auch klassische Methoden nutzen. „Es gibt sogar Lehrkräfte, die in der Unterstufe am Gymnasium erneut liniertes Grundschulmaterial einsetzen – nicht nur, um die Schrift zu verbessern, sondern auch, um Rechtschreibregeln sichtbar und greifbar zu machen“, berichtet Bär.
Politik und Verband auf einer Linie
Auch die Politik hat das Problem inzwischen erkannt. Der Bayerische Landtag verabschiedete im Sommer einen Beschluss, der die Bedeutung der Handschrift betont und fordert, den Schriftspracherwerb in der Grundschule didaktisch und fachlich neu zu stärken. Für den Philologenverband ist das auch ein Signal, die Rechtschreibung wieder stärker in den Fokus zu rücken. „Wir begrüßen diesen Beschluss ausdrücklich“, erklärt Bär. „Denn Handschrift und Rechtschreibung sind zwei Seiten derselben Medaille: Sie gehören untrennbar zusammen, wenn wir Schülerinnen und Schüler sprachlich fit machen wollen.“
Die Schlussfolgerungen der Neurowissenschaftlerin van der Meer gehen in dieselbe Richtung: Schulen sollten Schülerinnen und Schülern gezielt Gelegenheiten geben, mit der Hand zu schreiben. „Richtlinien, die sicherstellen, dass Schülerinnen und Schüler mindestens eine gewisse Menge an Schreibunterricht erhalten, könnten ein geeigneter Schritt sein“, sagt die Forscherin.
Hintergrund: Der Tag der deutschen Sprache wurde im Jahr 2001 vom Verein Deutsche Sprache (VDS) ins Leben gerufen. Ziel des Aktionstags ist es, die Bedeutung der deutschen Sprache ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Dabei geht es zum einen darum, die Ausdruckskraft und den bewussten Gebrauch des Deutschen zu fördern und unkritischen Anglizismen oder unnötigen Fremdwörtern entgegenzuwirken. Zum anderen soll der Tag verdeutlichen, wie wichtig solide Sprachkenntnisse für Bildung, Beruf und gesellschaftliches Miteinander sind. Der VDS möchte mit dem Tag auch ein Zeichen dafür setzen, dass Menschen ihre eigene Sprache wertschätzen – nicht zuletzt, um international ernst genommen zu werden. Darüber hinaus erinnert der Aktionstag an die Gleichwertigkeit aller Sprachen und lädt einmal im Jahr dazu ein, über Zustand, Entwicklung und Gebrauch des Deutschen öffentlich nachzudenken und zu diskutieren. News4teachers
Oh bitte…..Kopf, Herz, Hand…..zu finden in jedem Lehrplan ab 1985…..
Jeder, der Gudjons gelesen hat, weiß, dass handlungsorientierter Unterricht von der zielgerichteten Handlung in den Kopf führt…..
Niemand ist verwundert – schon gar kein Lehrer – das Schreiben können vom Schreiben kommt und Lesen können vom Lesen….
Aber, das braucht Zeit. Wenn wir möchten, dass Orthografie wieder in den Fokus gerät, brauchen wir in der GS auch genau die Zeit, diese zu vermitteln. Es reicht nicht, Regeln zu vermitteln (Relf, Fresh), sondern es müssen auch darüber hinaus viele, ganz viele Stunden zur Verfügung stehen, viel zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben…..und damit meine ich nicht Lückentexte ausfüllen…
Frau Gebauer hat in NRW damals den Grundwortschatz in den Blick genommen und verbindlich verankert. Am Ende der Grundschulzeit sollte jedes Kind die rund 1200 Wörter richtig schreiben können. Aber über das Wie hat sie sich ausgeschwiegen…..und nach wie vor sind Lernwörter und kleine Diktate verpönt….aber gerade das Üben von Lernwörtern macht am Ende die Rechtschreibung aus….völlig oldschool eben….
“Kopf, Herz,Hand” – das stand schon viele,viele Jahrzehnte früher im Mittelpunkt der Bildung und Erziehung. Und nicht erst in der Schule, sondern auch in der vorschulischen Bildung und Erziehung (Fröbel, Montessori, Pestalozzi…)
Ja natürlich, aber es stand auch explizit im Vorwort der Lehrpläne in NRW…..
In den aktuellen Lehrplänen ist davon nichts mehr zu finden….ist doch bezeichnend, oder?
“In den aktuellen Lehrplänen ist davon nichts mehr zu finden….ist doch bezeichnend, oder?”
Ja, ist es! Obwohl der Zusammenhang zwischen (Fein)Motorik und kognitiver Entwicklung und Leistungsfähigkeit bekannt ist.
https://www.erziehungskunst.de/artikel/feinmotorik-und-feinsinnige-gedanken-befunde-aus-dem-kindergarten-und-der-grundschule/
https://mbjs.brandenburg.de/sixcms/media.php/140/zusammenhang_von_bewegung_und_kognition.pdf
Vollkommen meine Meinung und meine Erfahrung in bald 30 ! jähriger Grundschularbeit.
Zeit für Übung – die vermisse ich seit gefühlt – ewig.
Volle Zustimmung.
Sie sprechen mir aus der Seele.
Dieser Studie glaube ich endlich mal. In etlichen Studien vorher wurde allerdings “bewiesen”, dass eine verbundene Handschrift nur überflüssige und altmodische Mühsal sei, die keiner mehr brauche. Wer wie ich diese Behauptung anzweifelte und der Handschrift nach wie vor erhebliche Bedeutung beimaß, galt als wissenschafts- und fortschrittsfeindlich.
In welchen Studien soll das “bewiesen” worden sein? Bitte Quellen für Ihre Behauptung nennen. Wir kennen keine entsprechende Studie.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Studien wohl eher nicht
aber gesellschaftliche Diskussionen allemal
Schreibunterricht an Schulen – Handschrift vom Aussterben bedroht
ansonsten gebe ich mal wieder Fräulein Rottenmeier recht:
alles was noch zu DDR-Zeiten Lehramt studiert hat, betont seit Jahren genau das.
Ich für meinen Teil frage mich, wieso alle Jahre wieder Studien feststellen, was schon lange lange bekannt ist und auch mal Usus war
Auch in Ihrem Link kommt nicht einer/eine zu Wort, die sich gegen das Handschreiben ausspricht. Wir wüssten nicht, wer diese “gesellschaftliche Diskussion” tatsächlich führen würde. Das heißt ja nicht, dass es nicht sinnvoll wäre, die Bedeutung des Handschreibens auch wissenschaftlich zu erurieren – um womöglich das Handschreiben in der Schule besser als bisher zu fördern. Da sehen wir durchaus Defizite: https://www.news4teachers.de/2022/06/lehrkraefte-attestieren-schuelern-massive-probleme-beim-handschreiben-nach-corona-vbe-beklagt-foerderdefizite/
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Nun, die KMK legt keinen Wert auf eine verbundene Handschrift, und in etlichen Bundesländern wurde auf diese zugunsten der Druckschrift verzichtet. Und zumindest das Deutsche Schulportal spricht davon, dass die Schreibschrift aus Sicht der Wissenschaft wenig bringt (siehe Zitat unten).
„Dass Kinder in der Grundschule Schreiben lernen sollen, ist unumstritten. Doch um das „Wie“ ist seit Jahren eine kontroverse Diskussion im Gange. Ein Grund für die Debatte sind die unterschiedlichen Vorgaben dazu in den Bundesländern. Viele Schulen verzichten mittlerweile auf das Erlernen der verbundenen Ausgangsschrift (Schreibschrift) und setzen stattdessen auf die Grundschrift, die auf den Druckbuchstaben basiert. Ohnehin lernen die Kinder in der Schule zuerst die Druckbuchstaben. Der zweite Schritt – das Erlernen der Schreibschrift – ist mühsam, zeitaufwendig und bringt aus der Sicht der Wissenschaft wenig. Die Bildungsstandards der KMK geben vor, dass Schülerinnen und Schüler eine individuelle „gute lesbare Handschrift flüssig schreiben”.“
https://deutsches-schulportal.de/unterricht/sollten-kinder-eine-schreibschrift-lernen/
Wir berichten selbst ausführlich und aktuell darüber: https://www.news4teachers.de/2025/09/mit-welcher-schrift-lernen-erstklaessler-am-besten-handschreiben-modellversuch-solls-klaeren/
Aber selbstverständlich ist die Alternative zur gebundenen Schreibschrift, die sogenannte Druckschrift, ebenfalls eine Handschrift. Niemand fordert, dass Kinder nur noch tippen sollen.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Nach Studien habe ich nicht Ausschau gehalten, aber nach passenden Artikeln.
https://rp-online.de/nrw/abschied-von-der-schreibschrift_aid-13534407
https://www.news4teachers.de/2025/05/schuelerrat-fordert-schreibschrift-pflicht-abschaffen-schulen-brauchen-zeitgemaesse-freiraeume-fuer-funktionales-schreiben-digital-und-analog/
https://www.br.de/nachrichten/bayern/modellprojekt-an-bayerns-grundschulen-schreibschrift-ade,UweroJV
Hier geht offenbar alles durcheinander: Handschreiben, Schreibschrift (dabei geht es um etwas anderes, nämlich eine Schriftendiskussion), Studien, Äußerungen von irgendwem… wie wäre es einfach mal mit Fakten? Fakt ist: Es gibt keine Studien, die – wie behauptet – den Wert des Handschreibens infrage stellen würden.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Es geht nicht nur um Handschrift. Es geht um den Zusammenhang Feinmotorik und kognitive Entwicklung!
… worum es hier geht.
Das stellt doch überhaupt niemand infrage.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Bei dem Modellversuch in Bayern sollen die Kinder aber direkt aus der Druckschrift ihre individuelle, teils verbundene Handschrift – ohne Umweg über die Schreibschrift entwickeln und verschiedene Buchstabenverbindungen ausprobieren.
……wenn das mal funktioniert ohne eine anleitende Unterstützung .
“Dieser Studie glaube ich endlich mal.”
Ich glaube, Sie missverstehen die Vorgehensweise und den Sinn bei Studien, wenn Sie meinen, da an etwas glaube zu können…
Das war der Landesschülerrat aus irgendeinem Bundesland, der die verbundene Schrift abgeschafft wissen wollte….dagegen haben sich nahezu alle Verbände und Lehrer ausgesprochen…..
Studien (ich Google jetzt nicht) fanden schon heraus, dass eine verbundene Schrift sinnvoll ist…..
Zum al si eau ch bei mle sen hil ft
Hahaha! Sehr schööööön!
Es gibt einen Unterschied zwischen Handschrift und verbundener Handschrift.
Die jetzt vorgestellte Studie belegt ihre Position also nicht.
“Die Schreibschrift ist Ballast, den man nicht mehr braucht”, sagt Ulrich Hecker, der zweite Vorsitzende des deutschen Grundschulverbands und Leiter einer Schule in Moers. Und weiter: “Ihre ersten Schreibversuche machen Kinder ohnehin in Druckbuchstaben. Erst in der zweiten Klasse kommt eine von drei normierten Ausgangsschriften hinzu. Dann können die Kinder gerade flüssig schreiben und lesen und müssen sich wieder umgewöhnen”, sagt Hecker. “Diesen Umweg können wir Kindern ersparen.” Abschied von der Schreibschrift
Genau, meine ich auch, den Umweg kann man sich sparen, in dem die Kinder sofort die verbundenen Kleinbuchstaben, hier die Schulausgangsschrift SA oder die Lateinische Ausgangsschrift LA , anwenden lernen zu schreiben und nicht eben die VA Vereinfachte Ausgangsschrift, weil diese an der Mittellinie aufgehängt ist und dadurch sehr krakelige Schriftbilder erzeugt.
Warum glauben Sie, dass Ihr Komantar eine Antwort auf mich ist?
Schreibschrift und Handschrift sind unterschiedliche Dinge. Auch die Druckbuchstaben aus Ihrem Zitat werden in Handschrift geschrieben (und nicht mit der Tastatur).
Die Druckbuchstaben der Tastatur sind gedruckte Buchstaben, die durch den Druck auf die jeweilige Taste erzeugt werden. Beim Schreiben einer verbundenen oder in Druckbuchsstaben erzeugten Schrift ruft man abgespeicherte Bewegungsabläufe im Gehirn ab, um dann einen Text zu erzeugen. Allerdings kann man eine verbundene Handschrift schneller schreiben als eine in Druckbuchstaben erzeugten Handschrift, da die kleinen Buchstaben miteinander verbunden sind, siehe auch die verbundene Schulausgangsschrift und die Lateinische Ausgangsschrift. Durch das Mehr an motorischer Aktivität wird auch in Folge einer stärkeren neuronalen Aktivierung mehr neuronal abgespeichert werden.
“Es geht nicht ums Schönschreiben, sondern um Schrift als Gebrauchswert”, sagt Hecker. Das soll die neue Grundschrift leisten: Sie soll lesbar sein, individuellen Spielraum bieten, schneller und ohne Verkrampfungen lernbar sein. Und aus dieser Grundschrift sollen die Kinder selbständig eine teilweise verbundene Handschrift entwickeln. Wenn das mal gut geht, und es gab mal wieder keinen Feldversuch, alles sollte wie bei der Einführung der VA ohne eine prospektive und randomisierte groß angelegte Studie durchgeführt werden. Das ist Elfenbeinturmpädagogik vom großen Vordenker mit ausgedacht.
Ob Grundschule oder später:
Natürlich schult das Schreiben.
Nicht nur die Rechtschreibung.
Da Schüler es aber meistens doof finden zu schreiben und die Fühli-fühlis ja ‘King’ sind…
…will der Schülerschaft mal mit meinen reaktionären Ansichten nicht so sehr auf den Geist gehen – Stichpunkte und Powah-poind tun es auch.
“Ohne die Handschrift drohen Lücken im Fundament sprachlicher Bildung.”
…. hatten wir das nicht schon gehabt?
Ich dachte, das wurde schonmal zerredet und es gab keine Anzeichen für ein Abschaffen der Handschrift, während Erwachsene selbstredend digital schreiben und Autokorrektur verwenden… :/
Ich bin da jedoch die Ausnähme und schreie ohne Autokorrektur 😛
Schlagzeile von morgen: “Wenn die Sonne aufgeht nimmt die Helligkeit zu”
Es kann doch nicht wahr sein, dass Universitäten dafür Forschungsgelder verschwenden. Der Wissenszuwachs durch diese Studie kann doch unmöglich die Ausgaben rechtfertigen.
Wie wäre es, Sie stellen sich der Wissenschaft als Orakel zur Verfügung – wenn Sie so viel vorab wissen, könnten Sie doch den Forschungsstandort Deutschland ungemein beleben.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Wissenszuwachs???
Ja, ich frage nach dem Wissenszuwachs durch diese Studie. Welches Ergebnis der Studie war vorher nicht schon bekannt? Die Studie diente doch nur der Bestätigung von zuvor bekanntem Wissen durch neuere Methoden und EDV-Unterstützung.
Ich meine einfach, dass auch Studien an Universitäten wenigstens ein kleines bisschen an die Wirtschaftlichkeit halten sollten. Man kann doch nicht tausende Euro ausgeben für die reine Bestätigung von schon gegebenen Ergebnissen. Auch wenn es keine deutsche Uni ist.
Es ist wie damals mit der Studie “Die Grenzen des Wachstums” – wenn es mit dem Computer berechnet bzw. jetzt mit Gehirnstromsensoren gemessen wurde, – dazu noch von einem nordischen Land kommt – besteht Hoffnung, dass man das endlich glaubt, was von Anfang an nahe lag.
Si e ha lte nda s als ofü r kwatsch?
Man wird seit 30 Jahren als “oldschool” oder “digitalfeindlich” tutuliert, wenn man es für lernphysiologisch unabdingbar hält, dass Kinder zuerst ganzheitlich lernen und üben, mit ihren eigenen Fingern und fassbarem Material, bevor sie mit digitalen, nicht ganzheitlich erfahrbaren “Dingen” zu tun bekommen…
Konkret kam immer schon vor abstrakt, oder??
Seit Menschheitsgedenken lernen Menschen (und Tiere, vermutlich auch Pflanzen) durch Reize, die ihre Sinne ansprechen, je mehr Sinne beteiligt sind, um so besser und umfassender und nachhaltiger lernen sie.
“Begreifen durch Be-greifen” oder “Lernen durch Selbst-Tun” oder wie auch immer…
Ein Gehirn muss sich entwickeln.
“Große” Pädagogen wussten und berücksichtigten das.
Man gewinnt den Eindruck, in gewisser Hinsicht inzwischen mehrheitlich mit “Kaspar-Hauser-Kindern” zu tun zu haben… digital haben sie mehr gesehen (nicht verarbeitet) als ihrem Alter guttut, sind im Grunde digital verwahrlost, weil sie Sexualisierung, Gewalt, soziale Deprivatisierung, Reizüberflutung ausgesetzt sind – ihr Gehirn hat aber nichts gelernt, das sie zu einem Leben in der Gesellschaft, womöglich mit lebenslangem Lernen, brauchen werden.
Viele zeigen extreme/erlernte Stressreaktionen, haben eine allzu kurze Zündschnur, gehen sofort in die Luft, wenn sie auch nur ansatzweise gefordert oder überfordert sind.
Gleichzeitig haben sie weder in Kita noch in Grundschule wirklich gelernt, zu sich zu kommen, zur Ruhe zu kommen, sich mit Dingen zu befassen, auch wenn sie nicht auf Anhieb funktionieren, die man üben muss; ihnen fehlen alle Voraussetzungen, weiteres Wissen aufzunehmen und zu integrieren.
Zentral verheerend sehe ich da den Verzicht auf echtes Schreibenlernen – statt dessen schon im Kinderwagen “Digitales” rundherum.
Schon bei der Überschrift musste ich lachen: neue Studie!!!
Das Ergbnis der Studie wurde mir bereits im Rahmen meiner Ausbildung am Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts vermittelt.
Schreiben hilft zwar, etwa beim Vokabellernen, zuviel davon führt aber auch zu Muskelverspannungen. Man soll es also nicht übertreiben.
Alles einer Frage des Trainings – wie beim Sport.
Aber nicht, wenn man jeden Tag Stunden schreiben muss
Ja, die armen Klosterschüler und Mönche im Scriptorium. Die litten auch alle an Muskelverspannungen. 🙂
https://de.wikipedia.org/wiki/Skriptorium
Wo wird denn gefordert jeden Tag stundenlang zu schreiben ?
Davon war auch nicht die Rede….Ihre verkürzte Sichtweise (Ganztag schadet dem Rücken, Lesen macht kurzsichtig) hilft nicht….erweitern Sie mal Ihren Horizont…..
….Training und die richtige Technik! Wenn ich so manche junge Menschen sehe, wie verkrampft die Hand und Arm beim Schreiben/Malen mit einem Stift oder beim Umgang mit einer Schere (und anderen Werkzeugen) halten, dann wundert es mich nicht, dass sie nach 5 Minuten unter “Muskelverspannungen leiden”. Auf die richtige “Technik” (wie hält man einen Stift, eine Schere) achteten früher die Kindergärtnerinnen von Anfang an, damit sich keine Fehler einschlichen, die man in der Schule kaum noch “wegtrainiert” bekommt.
Mehr als 8 Stunden täglich Schreiben ist überhaupt nicht gesund!
Braucht man dazu eine teure Studie? Das ist doch jedem Lehrer seit langem klar. Auf die Leute aus der Praxis wird nur leider selten gehört und es ist ja soviel cooler schon den Grundschülern I-Pads in die Hand zu drücken.
Wir wundern uns immer wieder, dass manche Lehrkräfte (sind Sie?) glauben, ohne Wissenschaft auskommen zu können, weil sie ohnehin alles schon vorher wissen. Woher kommen denn bloß die Inhalte, die Sie im Unterricht vermitteln? Zwischen Glauben und Wissen besteht eben ein Unterschied.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Um mal ein wenig Spannung rauszunehmen: Wissenschaft entwickelt sich nur durch Diskurs. Es gibt tausende Studien, die schlecht gemacht sind (ich empfehle den Podcast Science Cops), und es ist absolut notwendig, Studien und die abgeleiteten Aussagen kritisch zu hinterfragen, insbesondere in Bezug auf das Studiendesign. Es ist mitnichten unwissenschaftlich, Studienergebnisse resp. abgeleitete Aussagen anzuzweifeln.
„Ich GLAUBE der Studie“ ist hier aus meiner Sicht unglücklich formuliert, besser wäre mMn „die Ergebnisse erscheinen mir schlüssig“.
Hier werden aber Studien nicht methodisch kritisiert – es wird behauptet, alle Erkenntnisse schon vorher gehabt zu haben (natürlich stets mit dem unsachlichen Hinweis verbunden, wie teuer Forschung doch sei). Das ist ebenso ignorant wie wissenschaftsfeindlich.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Es gibt Dinge, die Millionen/Milliarden von Menschen selbst beobachtet und erlebt haben. Dann bräuchte man eine Studie nur dafür, weshalb etwas so und nicht anders ist. Die Suche nach der Ursache. Das trifft ja auch auf die hier vorliegende Studie zu.
Manchmal kriegen wir im Bildungsbereich aber wissenschaftliche Ergebnisse präsentiert, die den Erfahrungen der allermeisten Lehrkräfte widersprechen.
DAS liegt dann in der Regel daran, dass man unter “Laborbedingungen” geforscht hat, anstatt mit sehr vielen echten im Bildungsbereich tätigen Menschen gesprochen hat, die unter ganz anderen Bedingungen arbeiten.
Mir scheint, dass sich Kristine eher darüber aufregt. Das legt ihr letzter Satz nahe.
So oder so: Gemeckert wird immer. Das lässt aber im beschriebenen Kontext tief blicken.
“DAS liegt dann in der Regel daran, dass man unter ‘Laborbedingungen’ geforscht hat” – sorry, was für ein Quatsch. Es gibt keine Menschenversuche im Labor, “in der Regel” schon gar nicht (welche Regel?). Aber natürlich gibt es Rahmenbedingungen, unter denen Erkenntnisse gewonnen werden. Die werden (das ist Wissenschaft!) offengelegt. Sie sind also frei, sich jede Studie vorzunehmen und methodisch zu hinterfragen. Sie können auch gerne Ihre eigenen Erfahrungen und Beobachtungen schildern. Sie können hier aber nicht unwidersprochen pauschal die Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern herabwürdigen, ohne jemals selbst in eine Studie hineingeschaut zu haben.
Im Forum eines Bildungsmagazins immer wieder solch wissenschaftsfeindlichen Käse lesen zu müssen, tut fast körperlich weh. Die Aufgabe von Lehrkräften ist es, Verstand in die Welt zu tragen – nicht Voodoo. Zum Thema Wissenschaftsfeindlichkeit gerne hier nachlesen: https://www.tagesschau.de/faktenfinder/kontext/wissenschaftsfeindlichkeit-102.html
Die Folgen sind gravierend.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Ach so, es gibt also keine “Laborbedingungen”.
Na, dann …
Sie brauchen sich gar nicht zu echauffieren, finde ich, denn selbst Wissenschaftler*innen würden mir wahrscheinlich dahingehend zustimmen, dass ihre Ergebnisse nicht allgemein auf alle Situationen/Fälle/Körper … anwendbar sind.
“Im Forum eines Bildungsmagazins immer wieder solch wissenschaftsfeindlichen Käse lesen zu müssen, tut fast körperlich weh. Die Aufgabe von Lehrkräften ist es, Verstand in die Welt zu tragen – nicht Voodoo. Zum Thema Wissenschaftsfeindlichkeit gerne hier nachlesen:”
Nun, ich gehöre zu denen, die früher (und ja – vieles war besser! Und ja – nicht längst alkes war besser) das Schreiben mit Schwungübungen gelernt haben.
Lateinische, verbundene Schrift – wo ganz klar war, wo ein Wort anfängt und wo es aufhört.
Wir haben Buchstaben in die Luft gemalt – mit geschlossenen Augen!, auf den Rücken des Sitznachbarn, in Sand, mit Kreide auf den Schulhof … und meine Lehrkräfte in der GS, Orientierungsstufe und später auf dem Gymnasium waren nicht verlinkt mit dem Rest der Wissenschaftswelt – das Uraltwissen war auf uns erfolgreich abwendbar. Wir hatten in all der Zeit einen Legastheniker. Es gab noch keinen Erlass dazu, aber dieser schrieb die Diktate mit und sie wurden – ganz selbstverständlich für uns alle! NICHT bewertet. Punkt!
Facharbeiten wurden eine Note schlechter bewertet, wenn der Inhalt aufgrund der RS nicht verständlich war.
Voll der Rechtschreib-Horror-Knast – aus heutiger Sicht.
Wenn uns unsere Noten wichtig waren, haben wir gelernt. Unsere Lehrkräfte haben mit uns geübt, ohne Drill, Stress und Vorführung.
Wie kamen die bloß ohne Dauerzugang zum Internet zu ihrem Wissen? Und wir erst?
So eine Studie wie oben angeführt ist m.E. deshalb wichtig, weil sie m.E. zeigt, dass sich erfolgreiches Lernen, und vor allem Anfangslernen, nicht groß verändert hat.
Dafür haben sich Mensch und Gehirnzelle noch nicht weiter von Menschen und Gehirnzellen vor nun, etwa 55 Jahren entfernt.
Den “Käse” setzen hier doch gerade die gerne in die Welt, die nicht in der realen Welt ihre Füße haben.
Unsere schöne (un)heile Digi-Welt kommt bestimmt nicht von ungefähr. Wer wurde reich? Da haben wir die Hyper und die Grundlagenverdränger aus finanzieller Gier und nicht aus pädagogischem Enthusiasmus heraus.
Und ich sage ganz klar – MEINE Meinung, meine Erfahrung.
Über dreißig Jahre lang.
So – und nun darf gebashed werden.
Beim Erlernen von Kulturtechniken, hier das Lesen und Schreiben, nutzen wir Menschen die Hirnareale des Visuellen Cortex und der Handmotorik für einen anderen Zweck, als dies neuronal eigentlich vorgegeben ist. Das Gehirn des Menschen verfügt über eine beachtliche neuronale Plastizität, und mit dieser Fähigkeit zu lernen, können wir Menschen durch wiederholende Übungen auch hochkomplexe Arbeitsvorgänge und Fähigkeiten durch die Entwicklung einer weitgehenden Automatisierung der erlernten manuellen und geistigen Fertigkeiten uns aneignen.
Stanislas Dehaene, ist einer der führenden Neurowissenschaftler, der das aktuelle Wissen über das Erlernen von Kulturtechniken des Menschen in im englischen veröffentlichen Sachbuch ” How we learn ” zusammengefasst hat. Er ist Professor am Collège de France. Sein Hauptarbeitsgebiet ist die kognitive Neurowissenschaft und hier insbesondere die numerische Kognition und die Theorie der neuronalen Korrelate des Bewusstseins.
Dehaene gehört zu den einflussreichsten Forschern im Bereich der mentalen Verarbeitung mathematischer Probleme und hat die kognitionswissenschaftliche Debatte in Frankreich maßgeblich beeinflusst.
Eine sehr gute Rezension zu diesem Sachbuch von Herrn Voß ist hier verlinkt. Rezension zu “How we learn” von Stanislas Dehaene | Sebastian Voß
Meine Oma hat’s jedoch gereimt:
“Durch die Hand in den Verstand!”