DORTMUND. Mehr individuelle Förderung, mehr Bildungsgerechtigkeit oder grundsätzlich mehr Konsequenzen auf Basis wissenschaftlicher Daten – das sind einige der Forderungen, mit denen Bildungsgewerkschaften und -verbände auf die Ergebnisse des aktuellen IQB-Bildungstrends reagiert haben (News4teachers berichtete). Auch die Kultusministerkonferenz sieht den Sinn und Zweck der Studie darin, „länderspezifische Handlungsbedarfe zu identifizieren und geeignete Maßnahmen ergreifen zu können“, um die Qualität der Bildung zu sichern und weiterzuentwickeln. Vor diesem Hintergrund hat sich auch das Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS) an der Technischen Universität Dortmund mit den Studienergebnissen befasst und verweist auf drei Handlungsfelder.
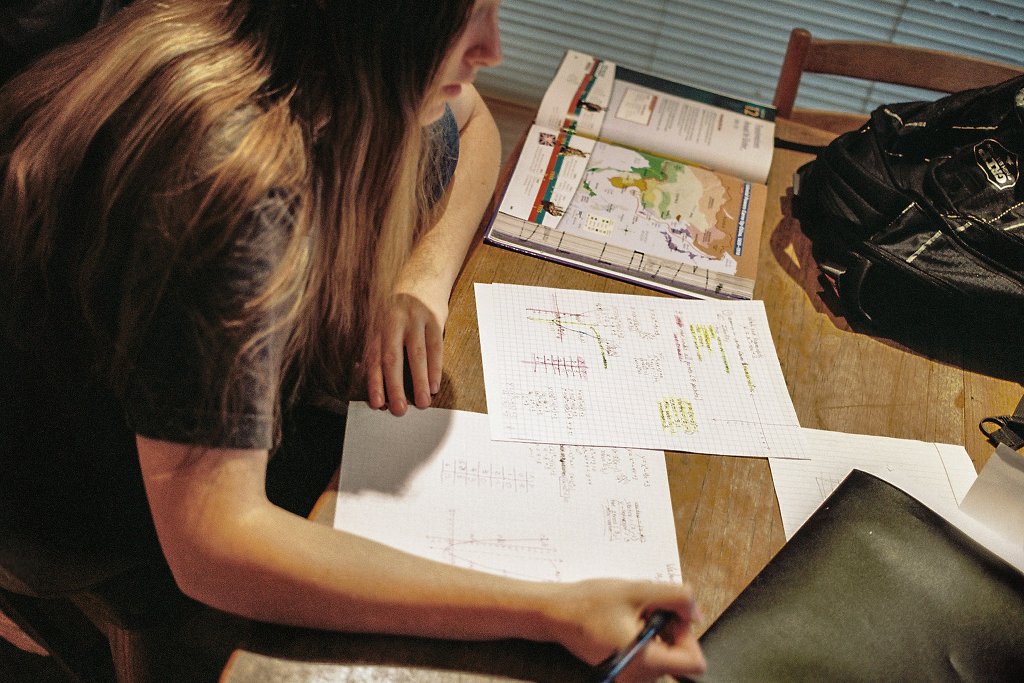
Der IQB-Bildungstrend 2018 hat zum zweiten Mal das Erreichen der Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz in den Fächern Mathematik, Biologie, Chemie und Physik in der Sekundarstufe I überprüft. An der Studie nahmen 44.941 Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse aus allen sechzehn Bundesländern teil. Damit konnte erstmals ein Entwicklungstrend festgestellt werden – und dieser regt zum Nachdenken an, da sich einige ungünstige und wenige positive Entwicklungen zeigen. Bildungsforscherin Prof. Dr. Nele McElvany, Geschäftsführende Direktorin des IFS, nennt drei mögliche Gründe:
1. Gender und Wertschätzung von Mathematik und Naturwissenschaften
Bei dem Thema Gender berichtet der IQB-Bildungstrend wichtige Befunde: Mädchen erreichen im Mittel nach wie vor schwächere Mathematikkompetenzen als Jungen, Jungen zeigen hingegen schwächere Leistungen als Mädchen in Biologie, Chemie und mit Blick auf den Erkenntnisgewinn in Physik. Jungen fallen auch häufiger hinter den Ergebnissen aus 2012 zurück.
Gleichzeitig gelingt es offensichtlich nicht, junge Menschen ausreichend für Mathematik, Chemie und Physik zu interessieren. „Es ist erschreckend, wenn zum Beispiel 62 Prozent der Mädchen in der 9. Klasse ein niedriges fachliches Interesse an Physik berichten“, bedauert IfS-Geschäftsführerin Nele McElvany. Auch mit Blick auf spätere Studienfächer sei eine verstärkte Förderung von Kompetenzen und Interesse im schulischen Unterricht nötig. „Wenn nur 44,9 Prozent der Neuntklässlerinnen und Neuntklässler (mindestens) den Regelstandard in Mathematik erreichen, hat dies auch Auswirkungen auf ihre Studierfähigkeit“, so die Dortmunder Bildungsforscherin.
2. Mangelnde Lese- und Sprachkompetenzen
Ein wichtiger und oftmals unterschätzter Aspekt, sobald die Bildungsstandards in MINT-Fächern betroffen sind: die Lese- und Sprachkompetenzen. „Lesen ist einer der grundlegenden Schlüssel zum Bildungserfolg und sollte daher auch noch in der Sekundarstufe I als Querschnittsaufgabe aller Schulfächer verstanden werden“, mahnt Nele McElvany. Denn wie könnten richtige Ergebnisse erzielt werden, wenn bereits das Verstehen der Aufgabenstellung Probleme bereitet?
3. Frühere Erhebungen wiesen auf mögliche Probleme hin
Die TIMSS-Erhebung 2015 des Instituts für Schulentwicklungsforschung, bei der die Leistungen von Schülerinnen und Schülern im Fach Mathematik und in den Naturwissenschaften gemessen wurden, zeigte, dass rund 23 Prozent der Grundschülerinnen und -schüler in Mathematik nicht die Leistungsstufe III erreichten. Die Autoren prognostizierten damals, dass diese Kinder mit Schwierigkeiten auf ihrem weiteren Lernweg in der Sekundarstufe I zu rechnen hätten. Dies scheint sich nun in manchen Ländern zu bestätigen und verdeutlicht, dass Verbesserungen nur gelingen können, wenn der Grundschulunterricht mitgedacht wird. Agentur für Bildungsjournalismus
“Mangelnde Lese- und Sprachkompetenzen: Ein wichtiger und oftmals unterschätzter Aspekt, sobald die Bildungsstandards in MINT-Fächern betroffen sind: die Lese- und Sprachkompetenzen. „Lesen ist einer der grundlegenden Schlüssel zum Bildungserfolg und sollte daher auch noch in der Sekundarstufe I als Querschnittsaufgabe aller Schulfächer verstanden werden“, mahnt Nele McElvany. Denn wie könnten richtige Ergebnisse erzielt werden, wenn bereits das Verstehen der Aufgabenstellung Probleme bereitet?” Man kann nicht oft genug darauf hinweisen, leider MUSS man feststellen: Hier passiert nichts bzw. nichts Gutes!
Brandenburg ist Schlusslicht beim nationalen Bildungsvergleich 2018 im Fach Mathematik!
Um es vorwegzunehmen: Beim IQB-Bildungstrend 2018, wo insgesamt ca. 45 Tausend Schüler der 9. Klasse aus ca. 1460 Schulen dran teilnahmen, ist Brandenburg im Fach Mathematik Schlusslicht von den 16 Bundesländern und hat sich im Vergleich zu 2012 in den mathematischen Leistungen der Schüler um 11 Punkte (!) verschlechtert, wobei knapp über 24 Prozent der Schüler nicht den vorgegebenen Bildungsstandard erzielten! Um sich ein Bild vom Schwierigkeitsgrad einer Mathe-Aufgabe (verkürzte Darstellung) zu machen: An einer Tankstelle wird der Geldbetrag von 58,51 € für die getankten Liter ausgewiesen. Für jeden Euro sind 73 Cent Steuern zu entrichten. Es sollte hier der Steuerbelastung errechnet werden (die weiteren Angaben, wie Preis pro Liter und getankte Liter erwiesen sich als irrelevant). Die mathematischen Anforderungen, die sich auf Zahlenräume, das Messen und die Geometrie bezogen und das mathematische Formulieren, Problemlösen, Modellieren und Kommunizieren beinhalteten waren vom Schwierigkeitsgrad also zu bewältigen! Positiv ist aber hervorzuheben, dass der Einfluss vom sozialen Status (Gradienten) sich in Brandenburg im Fach Mathematik insgesamt um 15 Punkte verringert hat (von ursprünglich 49 im Jahre 2012 auf 34 Punkte 2018 = 15 Punkte). In der Bunderepublik liegt dieser Wert momentan bei 39 Prozent. Nur rund 45 Prozent der Schüler der Bundesrepublik bewältigten den vorgegebenen Bildungsstandard der Kultusministerkonferenz in den Fächern Mathematik, Physik, Bio und Chemie. Und 31 Prozent erzielten hier nur mit Ach und Krach das Minimalniveau, wo hingeben über 24 Prozent der Schüler das Bildungsziel verfehlte. Führend waren wieder traditionell beim Bildungsvergleich die Schüler aus Bayern, Thüringen und Sachsen. Man muss dem Vorsitzenden der GEW-Brandenburg, Günther Fuchs unbedingt Recht geben, dass das Desaster der Ergebnisse des IQB-Bildungstrend 2018 auf eine verfehlte Bildungspolitik in Brandenburg und darüber hinaus zurückzuführen ist. Auch seine Schlussfolgerungen sind logisch und nachvollziehbar: Die Grundkenntnisse in den einzelnen Fächern müssen immer wieder abgerufen und trainiert werden. Dies heißt üben, üben und nochmals üben! (beispielsweise die Grundrechenarten, das Kopfrechnen,…). Der sogenannte Bildungsexperte, Gordon Hoffman (CDU) lag mal wieder meilenweit mit seiner Diagnose daneben, wie bereits in den Vorjahren beim gescheiterten Mathe-Abi in Brandenburg!
Siegfried Marquardt, Königs Wusterhausen
Man kann ja mal den Iran fragen:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/RIPE-79-Vom-IT-Studium-und-umgekehrten-Geschlechterverhaeltnissen-4561784.html
Der kriegt das mit der Frauenförderung in technischen Studiengängen so gut hin, dass eine Männerquote gefordert wird.
In Mathematik wenigstens zeigt uns PISA 2018, dass wir auf gutem Wege sind, diese “gender gap” zu schließen. Auf S. 187 der Langversion des Berichts steht:
“Der Leistungsvorsprung der Jungen ist im Vergleich zu PISA 2015 zurückgegangen, was auf einen signifikanten Rückgang der mittleren mathematischen Kompetenz der Jungen – im Vergleich zu 2012 – bei weitgehend gleichbleibender Kompetenz der Mädchen zurückzuführen ist.”
Also Jungs: weiter so, ihr müsst nur noch ein bisschen schwächer in Mathe werden, dann haben wir die Gendergerechtigkeit endlich erreicht. Nur kein Streber werden! 🙂