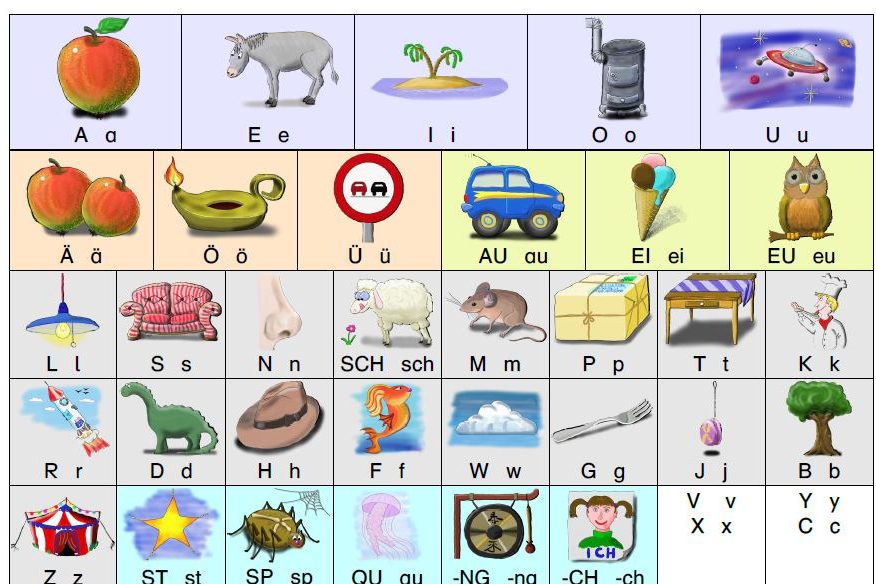Die Aussagen in der Pressemitteilung waren eindeutig und allgemeingültig formuliert – kein Wunder also, dass die Studie wie eine Bombe in die Presselandschaft einschlug: „Der ‚Fibelunterricht‘ führt bei Grundschülern zu deutlich besseren Rechtschreibleistungen als mit den Methoden ‚Lesen durch Schreiben‘ oder ‚Rechtschreibwerkstatt‘. Das haben Psychologen um Prof. Dr. Una Röhr-Sendlmeier von der Universität Bonn in einer groß angelegten Studie herausgefunden“, so heißt es in dem Text, den die Pressestelle der Hochschule am 10. September herausgab.
Endlich schien Klarheit zu herrschen in einer zunehmend aggressiv geführten Debatte um die Rechtschreibung von Kindern und Jugendlichen. „Mancherorts sollen Schüler die Wörter so schreiben, wie sie klingen – eine Studie hat die Wirksamkeit der Methode nun jedoch widerlegt“, so schrieb beispielsweise die FAZ. „‘Lesen durch Schreiben‘ hat ausgedient“, titelte pointierter die Main-Post. „Schüler lernen am besten mit einer uralten Methode“, befand schlicht die „Welt“.
Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) und der Präsident der Kultusministerkonferenz, Helmut Holter (Linke), forderten Konsequenzen. Die Ergebnisse müssten „schnell in der Praxis Anwendung finden“, sagte Karliczek. Die Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) reagierte umgehend – und schrieb den Grundschulen in ihrem Bundesland ab sofort den „Fibelunterricht“ zwingend vor (News4teachers berichtete).
In den Grundschulen und in der Grundschulforschung rumort es seitdem gewaltig. Denn so klar, wie die Pressemitteilung und die Reaktionen darauf es vorgeben, können die Befunde der Studie kaum sein. Es sei „fachlich Blödsinn, nur noch den Fibelunterricht zuzulassen“, meint etwa aktuell Jörg Ramseger, Professor im Ruhestand der Freien Universität Berlin und Vorstandsmitglied des Grundschulverbands, in einem Interview mit der „Zeit“. Warum? „Der Schriftspracherwerb ist sehr anspruchsvoll. Lehrkräfte, die die Kinder ausschließlich Seite für Seite einer Fibel abarbeiten lassen, nutzen eine überkommene Methode. Denn sie behandeln alle Kinder gleich. Das sind sie aber nicht. Manche lernen es auf diese Weise nie, sie bräuchten mehr Zeit. Andere langweilen sich mit den oft einfältigen Fibeltexten. Kompetente Lehrkräfte nutzen verschiedene Methoden und mischen sie.“ Individuell zugeschnitten für jedes Kind eben.
Verbreiteter Methodenmix
Dieser Methodenmix scheint in der Praxis der Grundschulen verbreitet zu sein. In der Pressemitteilung zur Bonner Studie aber taucht er nicht auf – dort wird sauber zwischen den unterschiedlichen Methoden unterschieden, als würden Lehrer streng nach Vorgabe unterrichten. Ist das in der Studie auch so? Und auf welcher Grundlage? Haben sich die Lehrer selbst zugeordnet? Oder wurde ihr Unterricht begutachtet? „Über die Studie kann ich kaum etwas sagen. Sie ist noch nicht veröffentlicht worden, weil wesentliche Teile von einem Doktoranden verfasst wurden, der sein Promotionsverfahren noch nicht abgeschlossen hat“, erklärt Ramseger. „Wir wissen also nicht, ob die Kompetenz der Lehrkräfte mit erhoben worden ist oder ob erhoben wurde, ob die verschiedenen Methoden einzeln unterrichtet oder gemischt wurden. Wir wissen auch nicht, ob Fachdidaktiker an der Studie beteiligt waren und den Unterricht überhaupt beobachtet haben.“
Er, Ramseger, bezweifle das. Denn solche Studien seien hochkomplex und sehr teuer. „Aber schon jetzt wissen wir, dass die Untersuchung in der dritten Klasse aufhört. Das ist zu früh. Außerdem wurden zwar mehr als 3.000 Kinder in die Studie aufgenommen, doch am Ende lagen nur die Daten von 237 Schülerinnen und Schülern vollständig vor. Das ist zu wenig, um repräsentativ für die ganze Republik zu sein.“ In der Pressemitteilung der Universität ist von dieser Einschränkung keine Rede. Dort heißt es nur, die „Wissenschaftlerin (hat) mit einem größeren Team die Rechtschreibleistungen von mehr als 3.000 Grundschulkindern aus Nordrhein-Westfalen systematisch untersucht“.
Was aber, wenn nicht die Methode, könnte denn sonst ursächlich sein für das Nachlassen der Rechtschreibkompetenzen, die große Vergleichsstudien unter Viertklässlern in den letzten Jahren nachgewiesen haben? „Dass immer weniger Stunden dafür zur Verfügung stehen“, so antwortet Ramseger lapidar. „Wenn zum Beispiel Englisch ab der 1. Klasse eingeführt wird, muss etwas anderes dafür wegfallen. Natürlich hat es auch einen Einfluss, wenn viele Kinder mit einer anderen Muttersprache als Deutsch schreiben lernen. Sicher ist, sie brauchen wie Kinder mit besonderem Förderbedarf einen differenzierten Unterricht und entsprechend kompetente Lehrer. Aber welche Methode besser für sie ist, wissen wir eigentlich nicht.“ bibo / Agentur für Bildungsjournalismus
Hier geht es zum vollständigen Interview mit Jörg Ramseger.
Prof. Una Röhr-Sendlmeier und Tobias Kuhl vom Institut für Psychologie der Universität Bonn nehmen wie folgt zu den von Jörg Ramseger aufgeworfenen Fragen Stellung:
“Die Bonner Studie zur Evaluation unterschiedlicher Rechtschreibdidaktiken hatte das Ziel, anhand einer substantiellen Stichprobe die Rechtschreibleistungen von Grundschulkindern zu dokumentieren. Das Kriterium für die Zuordnung der Kinder zu den drei didaktischen Zugängen – systematischer Unterricht (Fibel), “Lesen durch Schreiben” und “Rechtschreibwerkstatt” – war jeweils die Aussage der Schule und Lehrer über die von ihnen primär eingesetzte Didaktik. Vor Ort konnte sich das Forscherteam überzeugen, dass die gemachten Angaben und die verwendeten Methoden und Materialien übereinstimmten.
Die Studie wurde als kombinierte Längsschnitt- und Querschnittstudie mit insgesamt 3084 Kindern durchgeführt. Die Längsschnittstudie zeigt die Entwicklung von 284 Kindern während der ersten drei Schuljahre. Die Vorkenntnisse der Kinder sowie die in der Familie gesprochene Sprache wurden als Kontrollvariablen in den Berechnungen berücksichtigt. Die Querschnittstudie bildet die Rechtschreibkenntnisse von 2800 Erst- bis Viertklässlern ab. Weiterführende Informationen in gebündelter Form: https://bit.ly/2NdrmiD.”
Der Beitrag wird auch auf der Facebook-Seite von News4teachers diskutiert.