DORTMUND. Die frühe Lesesozialisation hat eine große Bedeutung für die spätere Lesekompetenz. Kinder von Eltern, die bereits vor Schuleintritt häufig lesebezogene Aktivitäten mit ihren Kindern durchführen und die selber gerne lesen, weisen am Ende der Grundschulzeit eine höhere Lesekompetenz auf. Jedoch sind die Kinder bei Schuleintritt in keinem anderen EU-Land so unvorbereitet wie in Deutschland – das haben Forscherinnen und Forscher des Instituts für Schulentwicklungsforschung (IFS) der TU Dortmund nun ermittelt.
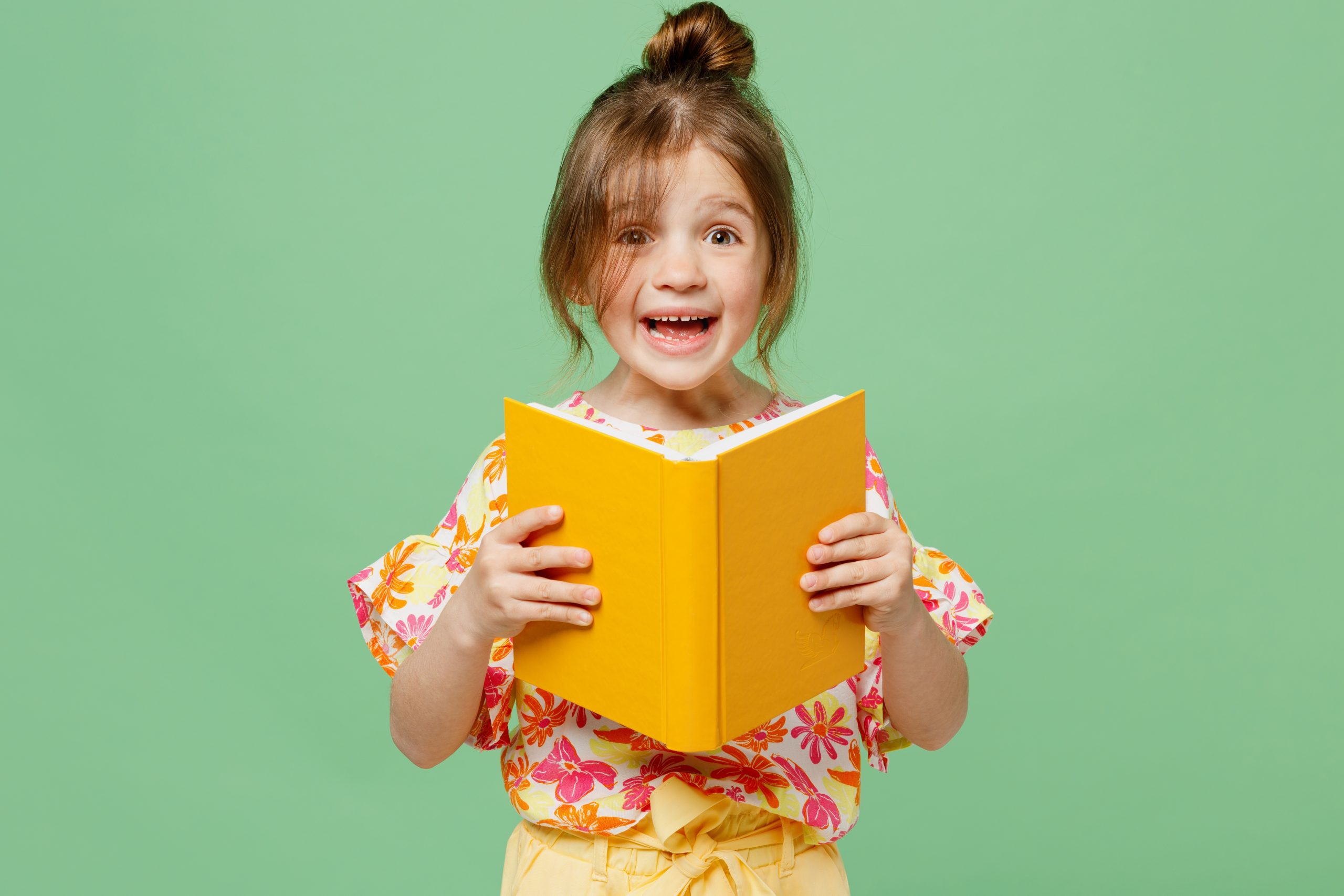
Lesen und Schreiben lernen die Kinder in der Schule, jedoch beginnt der Schriftspracherwerb bereits vor dem Schuleintritt – so stellt das IFS fest. Zu den leseförderlichen Aktivitäten gehören das Vorlesen von Büchern, das Erzählen von Geschichten, das Singen von Liedern, Unterhaltungen über Aktivitäten und vieles mehr. Die frühe Lesesozialisation legt wichtige Grundsteine für die Schulzeit.
Daher stellt sich die Frage, wie viele Kinder zum Schuleintritt bereits über grundlegende Lese- oder Schreibfähigkeiten verfügen. Denn Kinder mit zahlreichen leseförderlichen Aktivitäten vor Schuleintritt und mit Eltern, die gerne lesen, haben am Ende der Grundschulzeit eine höhere Lesekompetenz. Die Antwort: Ein Großteil der Kinder in Deutschland ist bei Schuleintritt schlecht vorbereitet.
„Die meisten Fähigkeiten, wie zum Beispiel die meisten Buchstaben des Alphabets erkennen oder einige Wörter lesen zu können, sind in Deutschland schlechter ausgeprägt als im Mittel der EU“
So geben 77,6 Prozent der Schulleitungen in Deutschland an, dass weniger als jedes vierte Kind bei Schuleintritt über grundlegende Lese- und Schreibkompetenzen verfügen. In der EU kamen 40,9 Prozent der Schulleitungen zu dieser Einschätzung. Gerade einmal 4,1 Prozent der Schulleitungen in Deutschland berichten, dass über 75 Prozent der Kinder bei Schuleintritt über diese grundlegenden Kompetenzen verfügen. In der EU wird diese Angabe von 22,3 Prozent der Schulleitungen gemacht.
Die Eltern der Kinder kommen zu einer ähnlichen Einschätzung. Nur 9 Prozent der Eltern von Viertklässler*innen in Deutschland beschreiben die lesebezogenen Fähigkeiten ihrer Kinder bei Schuleintritt als sehr gut. „Wir stellen fest, dass in keinem anderen Land in der EU Kinder so schlecht vorbereitet in die Schule starten, wie in Deutschland, konstatiert Rahim Schaufelberger, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) 2021. „Die meisten Fähigkeiten, wie zum Beispiel die meisten Buchstaben des Alphabets erkennen oder einige Wörter lesen zu können, sind in Deutschland schlechter ausgeprägt als im Mittel der EU.“ 67 Prozent der Eltern in Deutschland geben an, dass die lesebezogenen Fähigkeiten ihrer Kinder bei Schuleintritt nicht gut waren. Bei 24 Prozent sind die Fähigkeiten zumindest einigermaßen gut.
In Deutschland geben 40 Prozent der Eltern an, oft leseförderliche Aktivitäten mit ihren Kindern vor Schuleintritt durchzuführen. Deutschland liegt damit im EU-Vergleich im Mittelfeld. „Es gibt jedoch mit 60 Prozent der Familien, in denen leseförderliche Aktivitäten lediglich manchmal, nie oder fast nie durchgeführt werden, einen beträchtlichen Anteil an Kindern, mit ungünstiger Lesesozialisation“, betont Schaufelberger. „Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Kinder mit häufigen leseförderlichen Aktivitäten auch eine höhere Lesekompetenz aufweisen, ist ein solch hoher Anteil bedenklich“, führt er weiter aus.
Ein Drittel der Eltern von Viertklässler*innen gibt an, dass sie es sehr gerne mögen, zu lesen. Ein Fünftel mag es nicht, knapp die Hälfte mag es immerhin einigermaßen. Auch hier liegt Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern der EU im Mittelfeld. „Bemerkenswert ist, dass Eltern in Deutschland im EU-Vergleich das Lesen weit weniger häufig als eine wichtige Aktivität zu Hause sehen und sich weit weniger gerne über das Gelesene austauschen“, erläutert der Wissenschaftler. 33,33 Prozent der Eltern in EU-Ländern sehen im Lesen eine wichtige Aktivität, in Deutschland sind es lediglich 25,6 Prozent. 34,8 Prozent der Eltern in EU-Ländern unterhalten sich gerne über das Gelesene, in Deutschland sind es 25,5 Prozent.
„Der hohe Anteil von Schülerinnen und Schülern, der bei Schuleintritt keine guten lesebezogenen Fähigkeiten aufweist, deutet darauf hin, dass die Vorbereitung auf die Schule in Deutschland verstärkt in den Blick genommen werden sollte. Insbesondere sollte die grundlegenden Fähigkeiten, die die Lesekompetenz anbahnen, stärker systematisch gefördert werden“, so resümiert die Studienleiterin Professorin Nele McElvany. News4teachers
Das interdisziplinäre Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS) an der TU Dortmund ist als Forschungseinrichtung an der Schnittstelle von Wissenschaft, schulischer Praxis und Politik angesiedelt. Die durch vier Professuren und rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestalteten Forschungsbereiche des Instituts arbeiten zu aktuellen Themen im Bereich der Empirischen Bildungsforschung mit dem Ziel, schulische Lern- und Entwicklungsprozesse, Schulentwicklung und Bildungsergebnisse im Kontext ihrer individuellen, sozialen und institutionellen Bedingungen zu erfassen, zu erklären und zu optimieren. Das IFS trägt mit seiner Arbeit wesentlich den Profilbereich Bildung, Schule und Inklusion der TU Dortmund mit.
CDU will verpflichtende Sprachförderung in Kitas (das hat allerdings einen Haken)
Wenn die einheitliche Meinung doch ist, dass Kinder Kinder sein sollen, am liebsten sogar bis sie sieben sind, dann muss man sich nicht wundern.
Dass Kinder nicht überfrachtet werden sollten, versteht sich von selbst. Aber dass man sie intellektuell bis zum Schuleintritt so gar nicht herausfordern soll, ist wohl nur in Deutschland Mehrheitsmeinung.
Wenn die Meinung wäre, dass Kinder Kinder sein sollen, dann würde man sie nicht mit 1 Jahr in die KIta geben, denn ein Kind braucht eine familiäre Bindung.
Wie wäre ein normaler Mittelweg wie bei uns damals? Mit 3 in der Kindi. Mit 6/7 in die Schule mit einer ordentlichen Vorschule im letzten Kindijahr? Würde aber wahrscheinlich das Problem auch nicht lösen, wenn die Kinder nach wie vor keine ordentlichen Vesper bekommen, ihnen nicht vorgelesen wird, sie zu Hause kein Deutsch sprechen …
Sehe ich auch so, @Jan.
Selbst lesen können oder die Buchstaben beherrschen, das muss nicht sein, dafür gibt es die Schule (außer vielleicht den eigenen Namen schreiben können).
Aber bevor Kinder die erste Klasse besuchen, sollten sie grundlegende Dinge beherrschen:
Selbst anziehen können
Schuhe anziehen können
Getränk in ein Glas füllen
Ordentlich essen können
Mit Messer und Gabel umgehen können
Alleine auf die Toilette gehen können
Stift richtig halten können
Schere richtig verwenden können
Muster ordentlich ausmalen können
Bilder zeichnen können
Ganze Sätze sprechen können
Mitmenschen begrüßen können
Zuhören können
Mündlich gestellte Aufgaben erledigen können (praktische Aufgaben)
Einfache Kinderlieder singen können
Einfache Tänze zu Musik ausführen können
Im Spiel verlieren können
Gemeindmsam mit anderen Kindern ein Projekt umsetzten können (z.B. Turm mit Bauklötzen bauen)
Teilen können
Ein “Nein” akzeptieren können (Frustrationsgrenze)
Ein gewisses Maß an Geduld haben
Sich länger als 5 Minuten mit einer Sache veschäftigen können
Über einen Baumstamm balancieren können
Schaukeln können
Auf einem Bein hüpfen können
Radfahren können
Sandburgen bauen können
Plätzchenteig ausrollen und ausstechen können
Anderen zuhören können
Auf einem Stuhl eine gewisse Zeit sitzen bleiben können
Anderen helfen können
Abzählreime auswendig können
Seilhüpfen
Ein Erlebnis erzählen können
Fünf Minuten Stille aushalten
Einer Musik lauschen ohne dazwischenreden
…
usw.
Der Erwerb solcher Fähigkeiten sollte im Elternhaus und in der KiTa unterstützt werden.
Aus meiner Sicht sind das Selbstverständlichkeiten. Jeder, der irgendwie mit Kindern zu tun hat, sollte das auch ohne Anleitung im Gefühl haben (mit den Kindern Spiele spielen, Basteln, Malen, Rätseln, Ausflüge machen, Singen, Herumtollen, Vorlesen usw.) – dem ist aber leider zu oft nicht so.
Leider fehlen heute selbst Sek1-Kindern einige dieser Kompetenzen.
Wie soll man in der Schule ohne ein Mindestmaß an Grundfertigkeiten mit den Kindern arbeiten können?
Es fehlt an zu vielen Basiskompetenzen.
Das führt oft zu ganz viel Frust und Verweigerung.
… keine gute Grundlage um motiviert etwas zu lernen
… die Kinder werden bei einfachsten Aufgaben überfordert.
Bedenklich und bedauerlich …
Ich finde aber auch die Diskussion über mögliche Schuldige an dieser Situation unsäglich. Das ist nicht Zielführend! Wir sollten uns eher über die Zukunft Gedanken machen.
Kinder sollten nur dann die Regelschule besuchen dürfen, wenn sie “schulreif” sind. Für Schulen gibt es Lehrpläne, aus denen man Kompetenzen ableiten kann, die beim Schuleintritt vorhanden sein müssen.
Wie sollte nun der vorschulische Bildungsweg aussehen? Wer trägt die Verantwortung? Wie können Eltern Beruf und Kinder vereinen? Was könnten Firmen beisteuern, was der Bund und die Kommunen, was die Eltern?
Ich wäre für einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab drei Jahren.
Ich wäre dafür, elterliche Familienarbeit mehr wertzuschätzen und daß die Eltern, die sich gerne bewußt dafür entscheiden würden, diese gesellschaftlich wirklich immens wichtige Aufgabe selbst zu übernehmen, nicht wegen finanzieller Aspekte daran gehindert werden.
Kinder ab drei Jahren sollten einen Kindergarten besuchen können. Dabei reicht es völlig, wenn sie vier bis fünf Stunden dort verbringen. Wenn Eltern mehr Betreuung für ihre Kinder brauchen, soll ihnen das selbstverständlich möglich sein.
Kindern mit wenig oder gar keinen Deutschkenntnissen MUSS natürlich mindestens der halbtägige Besuch eines Kindergartens ermöglicht werden.
Vor allem in Großstädten, in Hochhausvierteln, muss das Umfeld kinder- und familienfreundlicher gestaltet werden. Es braucht kindgerecht gestaltete, vor dem Straßenverkehr geschützte Bereiche, in denen Kinder sich frei bewegen und spielen können.
Es braucht in jedem dieser Viertel niedrigschwellige Hilfsangebote, z.B. Familientreffpunkte, wo Eltern sich auch mal Rat von qualifizierten Fachleuten holen können, wenn sie überfordert sind.
Wir können diese Probleme nicht ALLE den Schulen und Kitas aufbürden. Es muss doch auch wieder eine Kindheit ohne flächendeckende institutionelle Vollzeitbetreuung möglich sein, ohne daß deshalb die ganze Gesellschaft den Bach runtergeht.
Es muß doch irgendeinen Weg dazwischen geben.
Organisierte Betreuungsangebote für Kinder- ja. Aber bitte keinen Zwang zur Vollzeitmassenaufbewahrung schon für die Allerkleinsten. Damit tun wir unseren Kindern keinen Gefallen.
Eins möchte ich noch hinzufügen: Es gibt den klugen Satz, daß es “ein ganzes Dorf brauche, um ein Kind großzuziehen.” Heute gibt es dieses “Dorf” nicht mehr. Stattdessen gibt es Kindertagesstätten. Aber inwieweit können diese die Weite und Vielzahl an Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten ersetzten, die ein ganzes “Dorf” bietet? Bitte den Begriff “Dorf” jetzt nicht wörtlich nehmen.
Ich meine den Erfahrungsschatz, den Kinder aufnehmen, wenn sie stärker ins Erwachsenenleben eingebunden sind. Wenn da Nachbarn, Großeltern, ältere Kinder und Jugendliche sind, mit denen man den Alltag teilt.
Kann Krippe und Kindergarten von Mo bis Fr von morgens bis abends das wirklich ersetzen oder machen wir uns da nicht etwas vor? Im Grunde spiegelt Kita ja nicht das “echte Leben” wieder. Sie ist eine eigens für Kinder geschaffene Institution, in der sie das “echte Leben” sozusagen aus “zweiter Hand” vermittelt bekommen.
Aber da komm ich wieder an den Punkt, wo mir meistens Vergangenheitsverklärung vorgeworfen wird, drum hör ich an dieser Stelle besser auf. 😉
Kita könnte das ” wahre Leben” in die Einrichtungen holen, bzw.mit den Kindern entsprechende Exkursionen machen. Die Massenverwahrung verhindert aber leider vieles. Die oersonelken und räumlichen Mindeststandards für einen kindgerechten Kita-Alltag wurden wurden bereits schon vor vielen Jahren definiert. Umgesetzt werden die in keinem Bundesland.
Ich mag die “Vergangenheitsverklärung”
Kinder haben nun mal Eltern und DAS sind ursprünglich die wichtigsten Menschen in deren Leben.
Ich mag diese Abschieberei – aus welchen (notwendigen) Gründen auch immer – nicht.
Ich könnte jetzt wieder mit Wirtschaft und Politik kommen….
Mach ich auch!
Es kann m.E. eigentlich nicht darum gehen, die Fremdbetreuung zu fördern. Es MUSS meiner Meinung nach darum gehen, einem Elternteil, das sich um sein Kind selbst kümmern möchte, das zu ermöglichen.
Dazu gehört eine angemessene finanzielle Unterstützung, Beitragszahlung für Arbeitslosen- und Rentenkasse sowie selbstverständlich der Anrechnung auf die Rentenzeit.
Ohne Nachwuchs noch mehr Fachkräftemangel…. btw.
Mir bleibt schleierhaft, wieso es hier in Deutschland nicht möglich sein darf (so scheint es), dass sich um den eigenen Nachwuchs gekümmert werden kann.
“Familiäre Bildung” so, so.
Mutti schön drei Jahre mit jedem Kind zuhause ist also intellektuelle Herausforderung für Kiddies?
Es gibt ja nicht “nur “blöde” Muddis”…
Wenn ich ein Kind in die Welt setze, ist die erste Aufgabe, Elternteil zu sein.
Wer Karriere machen möchte, kann ja später ein Kind adoptieren.
Wer beides gleichzeitig will, braucht ein (eigenes) soziales Netzwerk.
(Fragt eigentlich mal jemand die Omma oder den Oppa, ob die sich ständig kümmern wollen? Jetzt, wo die eigenen Kinder aus dem Haus sind und sie sich mal um sich selber kümmern könnten…)
Kinder sollten nicht aus wirtschaftlichen Gründen abgeschoben und wegorganisiert werden müssen.
Eltern sollten nicht aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen sein, ihr Kind abzuschieben und es wegzuorganisieren.
Das ist ungesund. Punkt.
Wirtschaft und Politik sind gefordert – Lehrkräfte schuld.
? Wo schreibe ich, dass Kinder wegorganisiert werden sollten?
Wenn Sie sich mal zu mehr als ‘nem arrogant daher gerotzten Zwei- bis Dreizähler herablassen würden, könnte man Sie vielleicht besser verstehen.
Diese Kritik richtet sich ausdrücklich auch an diejenigen, die hier mit “wer seine Kinder in die Krippe abschiebt, hätte besser keine bekommen” – Parolen aufwarten, wie weiter unten zu lesen ist.
Nirgends.
Mir gingen die Finger auf der Tastatur über.
Was spricht dagegen?
Der Karrierewunsch?
Im Sinne der Kinder ist es gut, sie abzuschieben? Je früher desto besser, weil man sich dann nicht die traurigen Augen anschauen muss? Das ist auch viel bequemer – gebe ich zu.
Abgeschobene und wegorganisierte Kinder kommen sicher gut und recht lieblos, aber etwas unempathisch und hinreichend verunsichert durchs Leben.
Oder nicht? Oder doch? Schauen wir ein paar Jahre später mal wieder in irgendeine Studie und finden heraus, was der gesunde Menschenverstand bereits weiß.
Ich verstehe es nicht – ich schaffe mir nicht mal einen Hund an, wenn ich keine Zeit dafür habe.
Und auch da lässt sich bereits auf Hundesitter und -ausführer zurückgreifen. Muss man halt nur selber zahlen, kommt nicht vom Staat.
Sollten Eltern vielleicht auch mal Eltern sein dürfen und wollen?
Oder ist das inzwischen gesellschaftlich so verpönt und bashbar, dass die sich schon fast gar nicht mehr trauen, das Kind als Lebensmittelpunkt zu sehen und es auch so (nein, nicht helikoptern) zu behandeln?
Wie um alles in der Welt kann man mit kleinen Menschen nur so herzlos und lieblos umgehen (müssen)?
Wie gesagt – ich verstehe es nicht.
“Eltern sein” ungleich “Frau bleibt zuhause”
Bleiben Sie doch gern zuhause! Darum geht es doch nicht, sondern darum, dass nicht automatisch alles gut ist, sobald jemand (in Deutschland meist die Mutter) mit den Kindern zuhause bleibt.
Tatsache ist, dass es in Deutschland nicht nur Akademiker*innen, die sich ganz doll viele Gedanken über Kindererziehung usw. machen, gibt!
Es ist schräg, dass Sie und viele andere Kommentierende alles immer nur auf sich beziehen und sich total kritisiert fühlen.
Betrachten Sie das doch mal gesamtgesellschaftlich, bitte!
Danke!
Da widerspreche ich ja gar nicht.
Ganz im Gegenteil.
Ich fühle mich nicht im Mindesten kritisiert.
Wir haben alles gut in “trockenen” Tüchern.
Gesamtgesellschaftlich bin ich eindeutig gegen Massenkindhaltung.
Auch das führt zu – ich mag das Wort “Störungen” nicht so gern – verstörten Kindern.
Andere Gründe, dennoch Verstörungen.
Wir haben an unserer Schule (GemS) viele, sehr viele Kinder, wo wir uns alle wünschen, dass die Kids aus der Familie herauskommen.
Ich finde nur, dass es nicht sein kann, dass Kids der Arbeit und des Geldes wegen, sowie wegen fehlender Beiträge für Renten- und Arbeitslosenkasse nicht die volle Kinderbetreuzeit angerechnet wird.
Denn auch das ist eine Leistung – wenn nicht eine der wichtigsten! – FÜR unsere Gesellschaft.
Deswegen ist es m.E. nach auch dringend notwendig, dass die Arbeitgeber flexibler und familienfreundlich werden!
Es gäbe auch etwas zwischen Schwarz und Weiß. Wenn Mutti und Vati ihre Arbeitszeit reduzieren könnten und hier ein gewisser Lohnausgleich geschaffen würde, müsste kein Kind mit einem oder zwei Jahren 9 Stunden in einer Kita betreut werden. Die Kita- Betreuung findet unter Bedingungen statt, die nicht oder wenig entwicklungsförderlich sind. Das ist im Sinne der Kinder und damit der gesellschaftlichen Zukunft nicht hinnehmbar. Und die Folgen der schlechten Rahmenbedingungen in der frühkindlichen Bildung bringen bereits einen schweren Rucksack für die Grundschule.
Sehe ich auch so!
Vielen Dank
Ich habe nie gefordert, dass Einjährige neun Stunden in der Kita verbringen sollten.
Ich möchte lediglich der Aussage widersprechen, dass es für Kinder ganz allgemein am besten ist, wenn sie eher gar nicht untergebracht sind, sondern möglichst lange Elternbetreuung erleben.
Diejenigen, die hier besonders dafür eintreten, sind im Übrigen auch diejenigen, die bestimmten Menschen mit Migrationshintergrund die heftigsten Vorwürfe machen.
Auch interessant ist, dass es inzischen immer mehr Kinder gibt, die viel zuhause waren, und komplett schulunreif sind.
Nachtrag: zuhause lernen die Kids alle schön Deutsch.
Korrekt. Wenn es Alleinerziehende sind in Ordnung, aber es geht immer mehr darum, die lästigen Kinder bitte schnell los zu werden. Gleichzeitig bleibt aber die Hauptmacht und der Haupterziehungsauftrag bei den Eltern, funktioniert halt nicht, wenn die keinen Bock haben. Gefühlt werden dann auch die normal erzogenen Kinder komisch, wenn zu viele von den unerzogenen einer Klasse sind, die ziehen alle wie in eine Strudel mit.
Sie können sich nicht vorstellen, wie eng die Bindung in unserer Familie ist. Die Kinder sind jetzt erwachsen und aus dem Haus, aber wir merken immer noch,wie wichtig wir ihnen sind. Und dass, obwohl beide in der Betreuung und wir Vollzeit arbeiten waren. Wir hatten für unsere Tochter erst eine gute Tagesmutter, dann die Kita (ab vier). Ihr kleiner Bruder hat die Kita mit vier Monaten besucht. Wir wussten allerdings auch, dass die Betreuung gut ist und haben die Kinder nicht einfach nur abgeschoben. Eine enge Zusammenarbeit, engagierte Erzieherinnen und der Fakt, dass wir die Zeit nach der Kita aktiv mit unseren Kindern genutzt und gestaltet haben, waren eben eine Mischung, die letztendlich zu einem Ergebnis geführt haben, mit dem wir sehr, sehr glücklich sind. Ich weiß allerdings nicht, ob das Unternehmen heutigen Bedingungen noch so liefe, denn in unserer Kita gab es gezielte Beschäftigung, Basteln etc. sowie eine enge Zusammenarbeit mit uns Eltern. Und ich glaube, die gesellschaftlichen Probleme, die die Kitas ähnlich wie die Schulen inzwischen auffangen müssen, haben die Situation und Position der Erzieher und Erzieherinnen nicht einfacher gemacht.
Übrigens will ich nicht behaupten, dass unser Lebensentwurf, der für uns eben sehr gut funktioniert hat, für alle Familien gelten muss. Aber pauschal als ‘Kinder – Abschieben – Eltern’ eingestuft zu werden, das passt mir nicht. Leider haben Sie Ihre Aussage so knapp gefasst, dass das für mich so rüberkommt.
Das ist genau das, was ich meine. Wer das so haben möchte, wo Eltern UND Kinder mit diesem Lebensmodell glücklich und zufrieden sind, wunderbar. Dann machen sie das so.
Aber ich erlebe in meinem Beruf
eben auch Kinder, die mit dem Krippenalltag einfach noch überfordert sind.
In unserer Krippe arbeiten wirklich engagierte, liebevolle Erzieherinnen. Trotzdem können sie nicht immer in dem Maße auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes eingehen, wie es das jeweilige Kind gerade bräuchte.
Und da bleibt bei manchen Kindern wirklich was hängen.
Das spüren wir bei einigen Kindern, die dann zu uns in den Kindergarten kommen, ganz deutlich. Und das sind genau die Kinder, bei denen schon in der Krippe auffiel, daß sie sich mit der frühen Trennung schwer tun.
Natürlich finden da auch Gespräche mit den Eltern statt.
Aber nicht immer haben die die Möglichkeit, ihren Alltag so umzustellen, daß das Kind eben nicht zu kurz kommt. Dann müssen irgendwie Kompromisse gefunden werden, die die Situation etwas mildern, aber ideal ist das trotzdem nicht.
Dieser Aspekt wird bei all dem Geschrei um Bildungsgerechtigkeit, die angeblich nur dann gewährleistet ist, wenn jedes Kind möglichst frühzeitig einen Platz in einer öffentlichen Betreuungseinrichtung hat, vergessen. Es profitiert eben nicht jedes Kind davon, schon mit einem oder zwei Jahren in den Genuss der außerfamiliären Ganztagsbetreuung zu kommen.
In der Öffentlichkeit wird das aber völlig ignoriert. Es wird den Leuten vermittelt, sie würden ihrem Kind wertvolle Bildungschancen verweigern, wenn sie es nicht zumindest ein Jahr in die Krippe schicken.
Da gibt es verunsicherte Mütter, die tatsächlich fragen, ob sie ihr Kind denn wirklich mit zwei Jahren schon in die Krippe geben müssten. Die würden es gern noch zu Hause lassen, sehen aber daß es im Bekanntenkreis inzwischen üblich ist, nach ein/zwei Jahren wieder arbeiten zu gehen und daß sie fast schon irritiert gefragt werden, wann sie denn gedenken ihr Kind endlich in der Krippe anzumelden.
Und DAS geht mir gegen den Strich.
Ginge es wirklich um Gerechtigkeit, müssten Eltern ECHTE Wahlfreiheit haben.
Im Moment läuft es aber eher darauf hinaus, daß die Leute gezwungen sind ihre Kinder in die Krippe zu geben, weil sie es sonst finanziell nicht hinkriegen.
Und das ist UNGERECHT.
Ihre Beschreibung glaube ich Ihnen absolut. Mein Protest ging auch eher gegen ein pauschales “Das kann nur schiefgehen”, gegen eine “Rabeneltern” – Pauschalverurteilung, wie ich sie hier (allerdings nicht in Ihren Kommentaren) stellenweise herauslese und wie wir sie, witzigerweise von völlig wildfremden Menschen, damals zu hören bekommen haben. Ich habe nicht nur diese Antwort, sondern alle Ihre Kommentare gelesen und empfinde Ihre Darstellungen als sehr treffend und differenziert. Welche Einflüsse zwischen 2011 (Einschulung unseres jüngeren Kinds) und jetzt die Arbeit in den Kitas für das dortige Personal verändert haben, kann ich mir lebhaft vorstellen und es könnte sein, dass wir heute nicht mehr mit so einem guten Gefühl rangehen könnten. Das liegt aber nicht pauschal am Personal, da gibt es mit Sicherheit immer noch die ganz tollen, engagierten (kenne ich persönlich), aber wahrscheinlich auch die weniger interessierten – wie in jeder Berufsgruppe.
Das gibt’s doch gar nicht. In der Schule ist es so wichtig, logisch argumentieren zu lernen und beim Thema zu bleiben. Und dann ist es hier im Forum doch wieder so, dass Leute jedes Mal abdriften. Wenn Außerhausbetreuung eine Ursache für die Probleme bei der Schulvorbereitung wäre, müsste sie ja in anderen Ländern, die diese besser hinbekommen, nicht präsent sein – ist sie aber sehr wohl. Nur im DACH-Raum bleibt man in verkrusteten Vorstellungen verhaftet und verpasst Chancen auf echte Veränderungen in dieser Zeit.
“Vorlesen von Büchern, das Erzählen von Geschichten, das Singen von Liedern, Unterhaltungen über Aktivitäten”
Komisch, haben wir mit unseren Kindern gemacht, ohne groß darüber nachzudenken.
Aber gut, wenn in der Kita zukünftig planvoller gehandelt wird, Defizite aufzufangen.
Es geht wahrscheinlich auch nicht um Ihre Kinder, sondern um die Kinder, bei denen die Eltern nicht in der Lage sind/es nicht wollen/es als nicht relevant erachten.
Ist auch ein Unterschied, ob ich das zu Hause mit einem oder zwei Kindern mache, oder in der Kita mit einem oder zwei Kindern, während drumherum 15 andere quieken und rumhupfen und ich das Lesen alle naselang unterbrechen muß, weil Levin schon wieder heult, daß sich die Balken biegen, Tamara mit betröppelter Miene und grünem Rotz, der schon über den Mund rinnt, vor mir steht und Hanna dem Hannes grad eins mit dem Bauklotz überbrät.
Da hab ich leider keine Zeit auch noch irgendwelche Defizite aufzufangen, sorry. Da bin ich mit “Überleben” beschäftigt.
Und mit dem Vorlesen wird das so auch nix mehr, tut mir leid, Kinder.
So ist es. Keine öffentliche Kita hat die Ressourcen und die Erzieher i.d.R. nicht das Ziel und den Ehrgeiz, so viel Zeit und Energie in die betreuten Kinder zu investieren, wie dies viele Eltern für die eigenen Kinder tun. Mehrwert der Kita Gegenüber einer Betreuung zu Hause ist vermutlich der soziale Aspekt. Ansonsten bin ich auch der Meinung, dass es für Kleinkinder besser ist, wenn diese in den ersten Jahren durch ihre Eltern betreut und erzogen werden. Dies ist jedoch konträr zum aktuellen Zeitgeist und dem eigenen Anspruch der meisten Eltern (da beide Elternteile meist arbeiten wollen).
Natürlich gibt es auch Familien, bei denen es besser ist, wenn die Kinder extern betreut werden. Dies sollte aber m.E. eher die Minderheit sein (ansonsten läuft etwas sehr schief in der Gesellschaft)
Die aktuellen Zustände sind zum heulen und davon laufen. Wer weiß heute noch, was eine richtig gute Kita sein kann?
Meine Kinder hatten das große Glück solch eine Einrichtung besuchen zu dürfen. Niemals hätte ich das allein zu Hause leisten können, selbst nicht, wenn ich täglich eine Haushaltshilfe gehabt hätte und mich nur um die Kinder gekümmert hätte.
Es hätten ja zusätzlich eines Umfeldes bedurft, in dem gleichaltrige Kinder zusammen ab ca 4 Jahren gefahrlos draußen ohne ständige Aufsicht spielen können, also etwa wie es bis in die 60iger-, 70iger Jahre üblich war. Kinder brauchen andere Kinder.
Aber nicht schon mit 6 Monaten. Betreuung ab 2 oder 3 Jahren ist vollkommen in Ordnung, aber auch nicht 8 Stunden am Tag.
Das können Grundschullehrer nur bestätigen!
Was läuft eigentlich in 5 Jahren Kita????? Offenbar nichts.
Ein Satz: Einheitliche Leistungstest in Kitas. Deutschland hat die Digitalisierung verpennt.
Ich denke nicht, dass Kita eine 1:1 Leseförderung ersetzen kann. Das Lernen von Anlauten/Buchstaben findet in der Kita in NRW nicht statt.
Bei keinem meiner drei Kinder wurde die richtige Stifthaltung in der Kita angebahnt, viele meiner Achtklässler halten ihn immer noch mit 4 Fingern. Mein 5jährige bekommt zurzeit maximal 1x pro Woche vorschulische Förderung in einer Gruppe von 15 Vorschulkindern in der Kita – was soll das bringen? Zudem sind dort vor allem mathematische Vorläuferfähigkeiten und sozial-emotionale Kompetenzen im Fokus und nicht Leseförderung. Lesen tun sie dort mit Kindern aus allen Altersstufen in großen Gruppen regelmäßig. Aber meine Tochter hat dort keine Buchstaben gelernt, keine Handmotorik – das machen wir zuhause. Jedes meiner drei Kinder hat im Vorschulalter zwischen 3 und 6 Jahren ganz von alleine Interesse an Buchstaben entwickelt und diese nebenher aus Eigenantrieb erlernt (Anlaute, nicht sie zu schreiben). Ob aber alle Eltern in der Lage sind, das zu erkennen, das zu begleiten?
Wenn man eine richtige Vorschule will, sollte man diese auch wieder einführen und von Experten durchführen lassen. Unsere Grundschule erwartet nicht, dass die Kinder Buchstaben kennen. Sie fangen bei Null an, wenn es sein muss, ermöglichen jedem Kind auf seinem Niveau zu arbeiten – warum sollten Eltern also überhaupt das Bedürfnis haben, ihre Kinder so sehr vorzubereiten?
Damit Kinder aus Eigenantrieb Buchstaben lernen müssen Buchstaben bzw Bücher aber eine ausgeprägte Position im Haushalt haben. Ich kenne Mütter denen ist sogar in Bilderbüchern mit jeweils einem Satz auf jeder Seite zu viel Text. Dann entwickelt auch keins der Kinder das Bedürfnis und den Trieb Buchstaben zu lernen. Erst wenn Bücher im Haus vorhanden sind und die Eltern “Lesen” vorleben werden Bücher für Kinder interessant.
Hat übrigens bei unseren Kindern auch funktioniert.
Jepp!
Nennt sich auch Nachahmungslernen bzw. Lernen am Modell.
Davon gibt es halt leider die einen und die anderen.
Bereits diese Mütter (Bsp. s.o.) sind ohne (gut, richtig) lesen zu können durch die Schule gekommen….
Sollte einem zu denken geben.
Ich wünschte sehr, ich könnte Ihnen widersprechen …
Aber die EuE in den Kitas, die sagen, dass auch “Freiheit+Selbstbestimmung” Grundlagen haben müssen, um überhaupt sinnvoll damit umgehen zu können, stehen einfach zwischen einer abstrusen Vorstellung von der Beziehung zwischen Kindern und EuE in den Bildungsleitlinien und Eltern, die ihnen aufs Dach steigen, weil das Kind zu Hause erzählt, dass es irgendetwas üben musste, obwohl es keine Lust dazu hatte.
Jedes kleine Unbehagen eines Kindes wird zur Menschenrechtsverletzung hochgejazzt. Die Aussage, dass auch Umgang mit Unbehagen (= Frustrationstoleranz) erlernt werden muss, wird rundweg abgelehnt.
Und EuE haben gesellschaftlich einfach nicht das Standing, das LuL haben. Und schon gar nicht können sie sich hinter “Leistung wird nun einmal benotet” zurückziehen, weil von Vorschulkindern ja keinesfalls Leistung erwartet werden darf.
Und wenn einem der gesellschaftliche Rückhalt fehlt und man auch nicht in Auftritt und Habitus auf die Selbstsicherheit von (akademischer?) Bildung zurückgreifen kann, dann ist es einfach schwer, sich und “Unpopuläres” durchzusetzen:
– etwas üben
– sich anstrengen
– still sitzen
– zuhören
– Regeln einhalten
usw.
Macht keinen Spaß? Darf nicht sein.
Ich hatte immer gehofft, dass der Erz.-beruf mittelfristig akademisiert wird.
Genau das Gegenteil passiert jetzt.
Die Zugangsvoraussetzungen sind ein Witz und der Lehrplan ist ebenfalls lachhaft.
(Ich habe gerade heute unsere Auszubildende im 3. Jahr zu einer Fortbildung “Entwicklungspsychologie” angemeldet. Darf die Kita zahlen, weil die Berufsschule meint, dass “Freud bis Eriksson” vollkommen ausreichend ist.)
Wir waren da zwischenzeitlich schon weiter.
Ich gebe Ihnen in allem Recht.
Bis auf: LuL haben ein Standing.
Wenn, dann ist es so verschwindend gering gegen minus zehn tendierend, wie das der EuEs.
Die Eltern ändern sich ja selten in ihrer Haktung. Die Kids werden lediglich älter.
Und Leistung einzufordern, ist nach zig Jahren eingeübter Leistungslosigkeit kaum drin, ohne Krach, Stress und Frust.
Ich glaube nicht, dass Eltern Schlechtes für ihr Kind wollen.
Sie haben nur keine Ahnung mehr, was zum und für das Leben gebraucht wird.
Ich plädiere ja schon lange für eine Eltern”schule” oder Erziehungshilfe. Kann man ja anders benennen.
Begleitung/Betreuung bis mindestens zur GS.
Als Selbstverständlichkeit, nicht als “ihr könnt das nicht”.
Es ist soviel Wissen über Erziehung verloren gegangen. Das muss wieder her.
Bei uns wird inzwischen an unsere “päd. Kompetenz” bzw. unsere “Mitmenschlichkeit” appelliert, wenn ein Kind eine Extraaufgabe wegen “drolligen” Verhaltens nicht ausführen will.
Sek. I – wohlgemerkt.
Da weiß man, wer zu Hause das Sagen hat und wer da vor den eigenen Kindern kuscht.
Und WIR bekommen einen auf den Deckel, wenn wir unseren Erziehungsauftrag ernst nehmen…..
Sollten sich lieber freuen, dass jemand diese Aufgabe übernimmt – trotz der ganzen Widrigkeiten, die uns in den Weg gelegt werden.
Nur (m)eine Meinung.
Sie haben nur keine Ahnung mehr, was zum und für das Leben gebraucht wird.
Das nehme ich jetzt persönlich. Was wollen Sie mir damit sagen bzw. unterstellen?
Welche Eltern meinen Sie?
Auch die Lehrer, die Kinder haben?
Warum wissen Sie “was zum und für das Leben gebraucht wird” und ich nicht?
Was wissen Lehrer denn besser als – in diesem Fall – ich oder mein Mann?
Im Gegenteil. Wir schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, weil wir mitbekommen, was in der Schule gelehrt – oder besser nicht gelehrt – wird.
Es ist erschreckend, wie niedrig der Anspruch und das Niveau ist.
Was wird denn nicht gelehrt?
q.e.d.
Nun, ich halte Selbstvertrauen für extrem notwendig zum und für das Leben.
Gesundheit auch, ebenso wie Vertrauen in andere Menschen.
Hilfsbereitschaft ist auch nicht zu unterschätzen.
Ebenso der Mut, um Hilfe zu bitten und diese anzunehmen.
Herauszufinden, was ein Kind stark und glücklich macht, ist absolut notwendig.
Grenzen zu erkennen – die der anderen und die eigenen.
Respekt und Akzeptanz gehören unbedingt dazu.
Für sich und andere einzustehen.
Konflikte gewaltfrei zu lösen.
Usw. Usf.
Ich glaube, so weit liegen wir vermutlich nicht auseinander.
Dass LuL bezogen auf ihren komplexen und belastenden Berufsalltag ein viel zu geringes gesellschaftliches Ansehen haben, ist absolut richtig. Es ist aber immer noch höher als das der EuE.
Ich gehöre zu den wenigen Erzieherinnen bzw. KitaLeitungen mit akademischem Hintergrund – einen fachfremden, der nun wirklich null zur pädagogischen Kompetenz beiträgt und damit inhaltlich völlig unerheblich ist!
Ich bin hoch gewachsen, habe ein eher selbstbewusstes Auftreten und kann mich ganz gut ausdrücken.
Aber bei fast jeder Begegnung mit Kommunalpolitikern, Interessensvertretern, Amtsleuten usw. ändert sich deren Verhalten mir gegenüber immer erst in Richtung Respekt, wenn ich im Plauderton einfließen lasse: “Als ich mir damals mit Spielgruppen und Nachtwachen mein Studium finanziert habe, da …”
Wie aus Wasser Wein wird, wird dann ganz wundersam aus der Kindergärtnerin eine Pädagogin.
Ich glaube, dieses Manko im Bezug auf “ernst-genommen-werden” haben LuL nicht.
Das hört sich gruselig an.
Das “Image” der “Spieletante” ist leider in sehr, sehr vielen Köpfen fest verankert.
Mir ist klar, was EuEs täglich leisten.
Mir ist leider auch klar, wie wenig Anerkennung diese bekommen.
Mir bleibt aber unklar, warum so viele die Leistung nicht sehen (wollen).
Was läuft eigentlich 6 Jahre im Elternhaus? Offenbar nichts.
Das kann man so nicht verallgemeinern. Bei den Eltern sollte man im Einzelfall genauer hinschauen.
Mein Beitrag war als ironische Antwort auf den Post von “Alter Pauker” gemeint. Denn auch was die Kitas angeht, darf man nicht verallgemeinern. Am Ende haben die Eltern die Pflicht, ihr Kind zu erziehen. Keiner kann die komplette Erziehungsarbeit an Kita oder Schule auslagern. Doch genau das geschieht immer häufiger.
Ja, so ein alter Pauker hat jetzt gerade noch gefehlt, der offenbar glaubt, sich zur eigenen Entlastung an Kitas und EuE abarbeiten zu müssen.
Müssen jetzt die Kitas und EuE wirklich jede Suppe auslöffeln? Obwohl sie trotz permanent kindeswohlgefährdender Unterbesetzung, vom Träger mit Billigung des Landes (BW: Formbrief des KVJS) angeordneter Überbelegung, ohne besondere sprachliche Ausbildung und Ausrüstung Kinder betreuen müssen, die teils zu 90% und mehr ohne jede sprachliche Ambition und Hintergrund bei sich und in der Familie zur Aufbewahrung in der Kita abgeliefert werden und die praktisch jeden nächsten Tag mit tatkräftiger Unterstützung der Familie und des sozialen Umfelds wieder alles vergessen haben und wieder bei null anfangen? Für die Kinder, die erst gar nicht in die Kita gegeben werden, sind die EuE offenbar auch verantwortlich, ebenso wie für die inzwischen fast völlig entfallene externe Unterstützung bei der sprachlichen Früherziehung?
Stimmung! Alle gegen die Kitas! Denn die EuE sind ja jedenfalls gefühlt zu dumm, um sich zu wehren. Wenn man einen Schuldigen hat, braucht man ja keine Konzepte mehr.
Dringender Tipp an die EuE: Raus aus dem Job, so wie ich auch. Und zwar schnell. Die Wertschätzung liegt ganz offensichtlich bei null und auf angemessene Bezahlung und Arbeitsbedingungen könnt ihr eh warten bis ihr schwarz werdet. Die Kommunen haben eh kein Geld und müssen sich um wichtigere Dinge kümmern.
Nee!
Gerade jetzt drinbleiben im Job!
Und gut, dass wegen PISA auch die Kitas kritisiert werden. Das ist für alle von uns, die schon seit Jahren sagen:
“Diese an den Grundlagen und dem Kern des Ganzen vorbeischießende Vorschulpädagogik geht schief!”
eine Chance, gehört zu werden.
Wer nicht weiß, dass auch der Spracherwerb zu übende, quasi präverbale Grundlagen hat, ist in der Pädagogik falsch.
Sprache ist ein kommunikativer Akt, der im sozialen Kontext geschieht – also bedarf es eines sozialen Verhaltens.
Sprache ist AUCH (Zu-)Hören. Dazu gehört ein so niedriger Geräuschpegel, dass das möglich ist.
Sprache bedeutet auch Ausredenlassen. Hier ist Impulskontrolle und Selbstregulation Voraussetzung – in einem klaren Ordnungsrahmen, in denen Erwachsene den Ton angeben.
All das, das spezifisch dem Spracherwerb dient, dient auch ganz allgemein dem Bildungserwerb. Nicht hintereinander, sondern gleichzeitig.
Zwei Fliegen mit einer Klappe.
JETZT ist ein Zeitfenster geöffnet, um wieder zu den Basics zurückzufinden.
Zur Bezahlung:
Gruppenerzieherin: SuE TvöD S8a.
KitaLeitung – kleine bis mittlere Einrichtung: SuE TvöD S13.
Für nichtakademischen Berufe ist das ordentlich.
Als studierte Geschichtswissenschaftlerin (M.A.) habe ich im Verlagswesen minimal mehr verdient, aber ohne die sichere Anstellung.
Außerdem sind wir eine wertvolle Rarität. Das kann man bei Gehaltsverhandlungen gut in die Waagschale werfen.
Schon angestellt, aber ohne Tarifzahlung? Dann droht man halt mit Kündigung.
Die Drohung wirkt nicht? Egal! Wir werden überall gesucht.
Dass die meisten von uns Frauen sind und wir uns oft unter Wert verkaufen, ist dann irgendwie auch unser Problem, oder?
Keine Wertschätzung?
Kein Wunder, wenn wir immer so verdammt
w a s c h l a p p i g auftreten.
😉
@BeWa
Für diese Ausführungen würde ich gern 10 grüne Daumen geben!
Schauen Sie, welche Kinder in welchen Zustand in die KITA schauen und schauen Sie sich die dünne Personaldecke an. Die Erzieherinnen können auch nicht aus “Sch… Gold machen”, auch wenn das hart klingt.
Ja!
Von 42 Erstis, die nächstes Jahr eingeschult werden, haben wir 13 ab Januar zum wöchentlichen Schulkindertraining eingeladen. Diese Stunden knappsen wir von den SoFa-Zeiten ab und hoffen, dass es sich wenigstens ein bisschen lohnt. Diese Kinder kommen so bildungsfernen Elternhäusern, haben mit Sicherheit auch noch nie ein Buch in der Hand gehabt, gehen nicht in die Kita oder nur selten und wir sehen das Kind schon in den Brunnen gefallen……
Diese 13 Kinder sind allerdings das untere Ende der Fahnenstange, Förderung hätten sicherlich noch mehr nötig gehabt, aber wir haben dafür einfach keine Ressourcen…..
Bei uns laufen in diesem Jahr so viele AO-SF bei zukünftigen Erstklässlern wie noch nie.
Bei uns auch
Bei uns nicht, denn bis auf ganz eindeutige Fälle von GB geht sowieso keines mehr durch…..alle Förderschulen und GL-Schulen sind voll, übervoll….
Das ist ein echtes Drama, denn da gibt es nur VerliererInnen:
Wir reiten ein totes Pferd und können nicht absteigen. Das ist so furchtbar frustrierend. Und die nächsten Jahre werden eher noch härter als besser.
In anderen EU-Ländern gibt es teilweise eine Art Vorschule zur Vorbereitung auf die Schule. Das gibt es in Deutschland nicht. Hier gibt es ein “Vorschulprogramm” im Kindergarten, dass die angehenden Schulkinder durchlaufen und wo sie in den Grundkompetenzen gefördert werden sollen. Aber angesichts des Fachkräftemangels läuft das auch immer mehr so nebenbei oder es wird gekürzt: Das Sparprogramm sozusagen. Was erwartet man also? Und damit ist es umsomehr abhängig vom Elternhaus, wie die Kinder auf die Schule vorbereitet sind.
Da man ja so viel Wert auf frühkindliche Bildung legt, ist es ja eigentlich erstaunlich, dass die Kinder immer schlechter auf die Schule vorbereitet sind, obwohl sie immer früher und damit länger in die KiTa gehen?!?
Die Vorschule gab es einmal. Sie war der GS angegliedert. Unsere war hervorragend, ich habe gesehen, wie sich ” schulunreife” Kinder in wenigen Monaten entwickelt haben. Ich habe mit der Erzieherin dort zusammen gearbeitet. Sie hat mich tatsächlich gefragt, was ich bräuchte. Die Vorschule wurde irgendwann in den Nullerjahren eingespart.
In NRW war das derSchulkindergarten. Eine hervorragende Einrichtung, die aus vermeintlich pädagogischen Gründen abgeschafft wurde. In den NRW- Schulen wurden uns viele Sparmaßnahmen als pädagogisch sinnvoll verkauft. Unverantwortlich – aber bei uns wird ja niemand aus dem Ministerium zur Verantwortung gezogen …
… stattdessen müssen die Lehrkräfte und Kinder es ausbaden.
“Zu den leseförderlichen Aktivitäten gehören das Vorlesen von Büchern, das Erzählen von Geschichten, das Singen von Liedern, Unterhaltungen über Aktivitäten und vieles mehr.”
Was nicht gar! Zu den Bedingungen um diesen leseförderlichen Aktivitäten nachkommen zu
können gehören ausreichend Rückzugsmöglichkeiten und ruhige Ecken, mindestens zwei
pädagogische Fachkräfte in einem Raum damit die vorlesende bzw. erzählende Person
nicht ständig unterbrechen muß, FESTE Beschäftigungseinheiten, wie z.B Bilderbuchbe-
trachtungen, an denen auch die Kinder teilnehmen, die freiwillig niemals ein Buch in die Hand
nehmen oder sich aufs Geschichten hören einlassen würden.
Zu den leseförderlichen Aktivitäten gehört eine mindestens ein- bis zweimal wöchentlich stattfindende Einheit eigens für Vorschulkinder, die sich mit Themen aus dem sprachlichen Bereich wie Reimen, Silben, Sätzen aber auch Formen, Farben Mengen- und Zahlenverständnis widmet. Das alles muß lebendig und alle Sinne umfassend umgesetzt
werden. Zusätzlich schadet es nicht, die Kinder auch mal ein Vorschulblatt passend, zum
Thema, bearbeiten zu lassen. Es wäre gar nicht so schwer, wenn….
Wenn, ja was eigentlich?
Mehr Personal, kleinere Gruppen, weniger Dokumentationn, mehr Zeit….?
Vielleicht den Kindern zumuten auch mal “unfreiwillig” an einem Angebot teilzunehmen. Verstärkt darauf achten, daß vor Schuleintritt jedes Kind regelmäßig die grundlegenden Basisfertigkeiten trainiert hat? Also auch Dinge wie Umgang mit Schere, Kleber; Stift? Das hat jetzt nicht unbedingt mit Leseförderung zu tun.
Aber nach meinem Kenntnisstand mangelt es den Schulanfängern ja auch daran.
Und wenn Kitas nicht mehr in der Lage sind das zu leisten, brauchen wir vielleicht auch Einheiten zur Förderung der elterlichen Erziehungskompetenz? Brauchen wir möglicherweise
wieder mehr Eltern, denen sowohl genügend zeitliche als auch finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um ihrem elterlichen Erziehungsauftrag nachkommen zu können?
Brauchen wir für Kinder im Vorschulalter vielleicht auch weniger digitalen Medienkonsum?
Weniger Handy, Tablet, Tonie und mehr Bilderbuch, Geschichten, Märchen, die von echten Menschen im Dialog MIT dem Kind angeschaut, erzählt und vorgelesen werden. So voll analog mit Blickkontakt und Kuschelpotenzial?
Manchmal denke ich, wie bescheuert sind wir als Erwachsene eigentlich schon, wenn wir es nichtmalmehr hinkriegen VORSCHULKINDERN!!! genug Basiskompetenzen zu vermitteln, um gut in die erste Klasse starten zu können?
Vielleicht einfach mal wieder auf das Wesentliche konzentrieren? Weniger ProjekteZertifikats-
HausderkleinenSonstwaskönnerDokumentationsBeobachtungsPortfolio-Hype?
Bein Kinderwagenschieben den Blick weg vom Handy und öfter mal aufs Kind richten und einfach ein wenig Unsinn mit dem kleinen Menschlein plappern?
Fragen über Fragen, für deren Beantwortung ich nicht mehr zuständig bin. Aber ich wollt sie
wenigstens mal gestellt haben.
Absolut. Diesen Bildungsdokumentationsordner mit Fotos meines Kindes – braucht kein Mensch! Stattdessen mehr Zeit für die Förderung der Kinder, das wäre es. Ich weiß nicht, wer sich dieses fetten Ordner ausgedacht hat, die jetzt jedes Kind gebastelt bekommt. Da guckt niemand mehr rein, durch die Dokumentation lernt kein Kind mehr.
Leider greift auch die Bedürfnisorientierung immer weiter um sich, so dass viele Kinder mittlerweile in der Schule aufschlagen ohne ein einziges Mal nach Anleitung in der Gruppe gebastelt zu haben.
Es gehört meiner Meinung nach allgemein mehr Wert auf Fertigkeiten gelegt werden, die zur Selbstregulation beitragen. Kooperationsaufgaben, Vorlesen in Gruppensettings mit Fragen, gemeinsam nach Anleitung basteln, Rituale einhalten, Durchhaltevermögen entwickeln.
Einfache Aufgaben selbständig erledigen.
Dann könnten wir uns danach in der Schule mehr auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren.
Die Grundlagen eben !
Solange mir Eltern stolz erzählen, dass sie zuhause gar keine Bücher haben, weil die so viel Platz wegnehmen und das im Wohnzimmer nicht gut aussieht, wundert mich gar nichts.
Also die Gymnasien schieben die Verantwortung an die Grudnschulen. Schritt 2, die Grundschulen beschweren sich bei den Kindergärten. Bzw. den Eltern. Vielleicht sollten wir ja noch früher mit der leistungsorientierten Erziehung anfangen, kann ja nicht sein das 2jährige nur mit Bauklötzchen spielen.
Die Gymnasien haben recht.
Die GS haben recht.
Leistungsorientierte Erziehung ab 2 wäre absolut sinnvoll.
Würg, jetz aber…
Leistungsorientierte Erziehung ab zwei…
Für Zweijährige reicht Zeit haben, da sein, Zuwendung schenken, Spielen, begleiten beim Welt entdecken, und das, wenn möglich in Gesellschaft einiger anderer Kinder und eines liebevoll zugewandten Erwachsenen, der a bisserl Ahnung von der kindlichen Seele und deren Entwicklung hat. Dann läuft das.
Leistung ist das Letzte, woran ich bei der Erziehung von Zweijährigen denke.
Echt, Leute, bleibt doch mal auf dem Teppich.
Ich finde noch früher. Schlimm auch das die Embryonen so völlig faul im Mutterleib rumchillen, das läuft doch einer Leistungsgesellschaft zuwider.
Richtig! Diese Kinder werden es nie schaffen, Konjunktionen von Artikeln und Pronomen treffsicher zu unterscheiden, Subtexte zu erkennen oder witzig zu sein. Leider ist das den wenigsten – bedauernswerten – Betroffenen bewusst.
Mein Ironiedetektor kommt zu keinem eindeutigen Ergebnis.
Ich nehm das mal als Ironie – sonst wird mir ….
Es gab mal einen Menschen, der entdeckte, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind, sondern – huch! – Kinder.
Mir scheint, das geht hier gerade wieder ins Mittelalter….. zurück.
Digital first, children…. welche Kinder?
Ich denke mal der allererste Post von “Uwe” war Ironie.
Dann kam der Post von “Lera” den ich zunächst ernst genommen habe. Angesichts der folgenden Posts gehe ich inzwischen aber in allen Fällen ganz fest von Ironie aus. 🙂
Es würde reichen, wenn die 2-jährigen tatsächlich mehr mit Bauklötzchen spielen würden als mit einem Tablet ruhig gestellt werden. Wenn sie dann noch lernen, sich in Geduld zu üben, in einer Gruppe ruhig zu bleiben, spätestens am Ende der KiTazeit flüssig deutsch sprechen würden usw., wäre viel geholfen.
Meine Sicht liegt irgendwo zwischen Marion, Erzieherin, und Ihrer Darstellung. Ich Frage mich nur, ob bei Uwes und Leras Kommentaren einfach nur die Ironie-Antenne ausgefallen ist. Ehrlich gesagt hoffe ich das. Bauklötzchen hat unser Sohn übrigens geliebt, heute macht er eine Lehre im handwerklichen Bereich. Wer weiß, ob er mit der nötigen Medienausstattung im Kleinkindalter nicht schon ein berühmter Influencer wäre….
Apropos “Bauklötzchen”:
Sogar meine Viertys lieben sie und sind dabei unerhört kreativ. Vielleicht, weil der Umgang damit “früher” gefehlt hat?…
Wie so vieles, was den heutigen Zwergen leider vorenthalten wird. Und was in vielen Kommentaren hier schon treffend berichtet wurde.
Das ist mit ein Punkt – ihnen wird etwas vorenthalten.
Sie dürfen etwas nicht lernen.
Diese Entwicklung finde ich …. entsetzlich.
Niemand in Grundschulen macht den Kitas einen Vorwurf, denn sie verwalten nur den Mangel und sind eben nicht mehr so leistungsfähig, wie sie mal waren. Und dann kommt auch noch dazu, dass Kinder, die zuhause keine Anregungen erhalten, gar nicht oder nur selten in der Kita aufschlagen.
Auch die verbindliche sprachliche Überprüfung im Alter von 4 Jahren und der daraus verbindliche Sprachkurs ist nur noch Makulatur. Oft wird der Sprachkurs gar nicht von den EuE angeboten, da die Ressourcen fehlen. Oft gibt es gar keinen Schukinaclub mehr, da die Kapazitäten fehlen…..
Und übrigens, das Spielen mit Bauklötzen fördert das räumliche Vorstellungsvermögen und ist deshalb sehr förderlich….
Wir brauchen keine „leistungsorientierte“ Erziehung, sondern nur genug Anregungen und genug Zeit und ja auch manchmal sanften Druck, damit Kinder auch Sachen mitmachen, die Ihnen nicht nur Lust bereiten (z.B. malen und basteln, wo sich einige Kinder ja gerne drücken)…..
Letzteres mache ich den Kita allerdings zum Vorwurf: Der sanfte Druck, auch mal zu basteln, obwohl ein Kind nicht so gerne möchte, fehlt in vielen Einrichtungen völlig. Das ist großer Mist, wenn ein Kind sich in der Kita nie zu etwas überwinden muss.
Ich habe das bei einem Sprachförderprogramm in Kitas mitbekommen. Wer nicht will, muss nicht mitmachen. Das hat mich erschüttert.
Immer wieder schön ist auch das „offene Konzept“. Die Kinder suchen sich einen Raum aus (geht wohl der nicht-gern-Bastler in den Bastelraum?) und wenn sie keine Lust mehr haben, wechseln sie einfach in den nächsten Raum. Kein Wunder, dass die Erstis sich kaum noch mehr als 5 Minuten mit einer Sache beschäftigen können.
Naja das kommt darauf an, wie man das Konzept umsetzt. Wir haben einen offenes Konzept und trotzdem behalten wir im Blick, dass die Kinder regelmäßig wechseln und sich nicht nur die ganze Zeit im Bauzimmer oder im Turnraum aufhalten sondern auch mal im Atelier mit Schere, Kleber und Stift arbeiten oder Brettspiele spielen. Es mag auch Kitas geben, die komplett lasse faire arbeiten aber das dies der überwiegende Teil ist halte ich für ein Gerücht. Auch im Bauzimmer lassen sich Zahlen und das Zählen üben bei Brettspielen sowieso. Wenn Förderung nicht statt findet dann auf Grund von Personalmangel und schlechten Rahmenbedingungen. Die meisten EuE, die ich bisher kennen lernen durfte legen sehr wohl wert , dass die Kinder, die in die Schule entlassen werden wichtige Grundfähigkeiten erlernen aber wir erleben eben auch, dass sich zu Hause darum nicht gekümmert wird, aus ganz verschiedenen Gründen. Wenn aber Kinder teilweise monatelang ins Ausland verschwinden um die Familie zu besuchen und ich dann 3 Monate brauche um das Kind wieder auf den alten Stand zu bringen oder die Kinder nur unregelmäßig in die Kita kommen und die Eltern auch nicht mitziehen, dann fällt das was wir an Förderung und Bildung anbieten können eben auf unterschiedlich fruchtbaren Boden. Hinzu kommt, dass viele Kinder heute einen enormen soziale-emotionale Förderbedarf haben, hinzu kommt nicht selten noch dazu einen hohen Bedarf an Ergotherapie oder Logopädie, das sind das ABC zu lernen oder zählen lerne eben zweitrangig.
Beim sog. “offenen Konzept” muß alles passen. Enorm wichtig sind auch die baulichen und räumlichen Voraussetzungen.
Und das Team muß überzeugt sein und die Kommunikation muß laufen wie am Schnürchen.
Wenn nur ein Aspekt nicht wirklich gut paßt, kann das offene Konzept schnell zu noch mehr Streß und Belastung führen.
Immer im Auge zu behalten, daß auch der chronische Bastelverweigerer regelmäßig eine Schere zur Hand nimmt, ist gar nicht so leicht. Auch wenn man sich noch so bemüht, da rutscht schon auch einiges durch. So ist zumindest meine Erfahrung.
Ich stehe dem offenen Konzept nicht unbedingt ablehnend, aber doch eher kritisch gegenüber.
Das liegt vielleicht auch mit daran, daß die Kita, in der ich bis zuletzt gearbeitet habe, sehr ungünstige bauliche und räumliche Voraussetzungen für die Umsetzung der offenen Arbeit hat.
Ich habe allerdings auch den Eindruck, daß die Beziehung zum einzelnen Kind dadurch oberflächlicher wird. Aber das sind meine persönlichen Erfahrungen.
Sicher kann ein gut gemachtes offenes Konzept, wenn die Vorraussetzungen dazu passen, auch viele Vorteile bringen.
Wir sind ein kleines Team und unsere Räume liegen direkt neben einander, die Wege sind also kurz und wir sind im ständigen Austausch miteinander. Einmal im Monat gibt es eine Teambesprechung ,wo nur die Kinder in den Blick genommen werde. Zugegeben mir fehlt manchmal der Gesamtüberblick über ein Kind und ich erlebe ein Kind nicht beim Basteln aber ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn mehrere Leute auf ein Kind schauen. Da ergibt sich oft nochmal ein anderes Bild vom Kind. Aber ich gebe dir natürlich Recht, dass es passieren kann das Kinder mal durchrutschen, aber bei uns klappt es eigentlich ganz gut.
Da bin ich doch baff! Man hat doch ständig propagiert, dass die Kinder in der Kita gut aufgehoben sind. Eltern, die ihre Kinder mit 1 Jahr schon abgeben, rechtfertigen sich generell mit der Aussage “aber die lernen da doch so viel!”. Nun, wenn sie doch so viel lernen, warum dann diese Defizite, das Gegenteil müsste doch der Fall sein. Es sei denn, das “Lernen” ist nur Reproduktion von Gruppenangeboten, es wird nachgeplappert ohne Individualität.
Meine Meinung: drei Jahre zuhause, Eltern kümmern sich und nehmen die Elternzeit nicht als Fernreise-Möglichkeit, 3 Jahre muss machbar sein, vielleicht mit Hilfe von Großeltern, wieder mehr Wert auf Zeit mit Kindern statt materiellem Schrott legen, 1 Stunde puzzlen oder vorlesen ist mehr Wert als 3 Stunden Freizeitpark oder andere Events, es ist euer KInd, ihr wollt es doch nach euren Vorstellungen erziehen und fördern, zumindest in den ersten Jahren. Oder ist das tatsächlich nicht mehr so? Wenn ich sehe, dass heutzutage die meisten Kinder nicht mehr in der Lage sind, konzentriert und kreativ zu spielen, dann ist mir klar, was da läuft und dass dies nicht unbedingt eine gute Entwicklung ist. Kitas können eine enge und herzliche Eltern-Kind Bindung nicht ersetzen.
Ja, Mutti sollte schön bei jedem Kind drei Jahre zuhause bleiben. Läuft.
Psst, mal so unter uns: Die Vatis dürfen auch.
Nein, das ist verboten. –
Vielleicht sollte man mal die Realitäten betrachten. Wer bleibt denn in Deutschland mehrheitlich tatsächlich immer noch zuhause?
Und welche Kinder beherrschen nachher immer noch am wenigsten unsere Sprache?
Erinnern Sie sich noch an die Diskussionen um die sog. Herdprämie?
Wenn Sie sich da mal nicht täuschen. Doch, immer mehr Väter bleiben zuhause, ich spreche da aus Erfahrung.
Wue lange denn so? In meinem Kollegium bleiben die Herren max. drei Monate zuhause.
Manchmal liegt das aber auch an den Müttern, die den Vätern nicht zutrauen, sich genausogut um das Kind kümmern zu können, wie sie selbst.
Manchmal liegt das auch daran, dass Männer keine Brüste haben.
Wie lange wird denn ein Kind in der Regel gestillt?
Ja, in Ihrem Kollegium…..Aber mal über den beruflichen Tellerrand blicken…..da gab und gibt es doch recht viele Männer, die länger oder gleich ganz zuhause bleiben…..
Ich kenne da jemanden, der mit mir verheiratet ist 🙂
In Prozent? 5% aller Väter in Deutschland?
Spricht was dagegen? Kann auch der Vati sein. Die Hilfe der Großeltern habe ich auch angesprochen. Und könnten Sie Ihre Kurzantwort etwas mehr präzisieren? Außerdem habe ich etliche Argumente angeführt, die Sie nun auf “Heimchen am Herd” reduzieren.Kann ich so nicht stehen lassen. Aber ich akzeptiere natürlich auch andere Meinungen und bin aber trotzdem besorgt, dass die frühe Fremdbetreuung nicht unbedingt positive Auswirkungen hat. Als veritable Ausnahme der heutigen Einstellung war ich 12 Jahre für 2 Kinder zuhause, zahle meinen Tribut finanzieller Art, aber mir wurde klar, dass der finanzielle Faktor nicht das Non-Plus-Ultra ist, was habe ich davon Kinder in ferne Länder mitzuschleppen (möglichst mit Kinderanimation) und ihnen tolle Klamotten und teure Events bieten zu können? Meine Kids, inzwischen erwachsen, erinnern sich gerne an die originellen Momente der Familien-Aktivitäten, Campingplatz statt Malediven, selbst gestaltete Geburtstagsfeier statt Disneyland, Krabelgruppe mit Eltern (selbst daran erinnern sie sich noch) statt Kita etc.
Merken die Eltern eigentlich, dass sie der Wirtschaft dienen sollen und dass die KIndererziehung und Familie aufgrund dieser Interessen völlig in den Hintergrund getreten ist? Materialismus und Erfolg im Beruf sind kein Garant für Glück und Zufriedenheit, allerdings meinen immer mehr Leute heutzutage, dass Besitz (man muss ja alles gleich kaufen, was auf en Markt kommt) glücklich macht. Nun ja, dieses Glück ist nicht von Dauer, denn mit dieser Einstellung möchte man immer mehr, und wird nie zufrieden sien, da es immer Leute gibt, die noch mehr haben.
Ja, so redet Mutti, die lange zuhause war für ihre Kinder. Und ich kann nicht erkennen, dass ich komplett falsch liege.
Ich spitze zu, ja.
Es geht nicht immer nur um die Wirtschaft. Es geht auch um einen selbst.
Wenn man das alles so machen will, wie Sie es getan haben, sollte man das tun dürfen, keine Frage. Allerdings sollten Frauen, die anders leben wollen, es nicht so schwer haben. Denn es ist nach wie vor so, dass es Frauen sind, die unter dieser traditionellen Rollenverteilung leiden.
Was Lehrkräfte angeht, so haben die es im Vergleich zu vielen anderen Berufsgruppen viel besser, weil sie wieder gut einsteigen können, mit reduzierter Stundenzahl, ohne sich Sorgen um eine Beförderung machen zu müssen.
Und betrachtet man die Angelegenheit mal in einem größeren Kontext, dann stellt man fest, dass gerade Kinder aus Haushalten, wo die Mutter die ganze Zeit zuhause war, zurück sind in ihrer Entwicklung. Sie vergessen hier immer, dass es nicht nur Lehrkäfte oder Erzieher*innen in Deutschland sind, die Kinder kriegen.
Ich arbeite an einer sehr großen Schule mit sehr – sagen wir mal – heterogenen Klientel. … Mich wundert dieses Ausblenden von Realitäten in diesen Diskussionen immer wieder.
Es ist ja schön, wenn Sie das gut hingekriegt haben, aber es gibt eben sehr viele, die das überhaupt gar nicht hinkriegen. Und hier würde ich sogar behaupten, WEIL die Kids ihnen die ganze Zeit “ausgeliefert” waren.
Vor 15 Jahren haben die Eltern diskutiert, dass mehr als drei Jahre Kindergarten zu viel sind, weil sich die Kinder ja anfangen dort zu langweilen. Das ist irgendwie auch Quatsch, aber heute sind 4-5 Jahre Standard – nicht unbedingt, weil es gut für die Kinder ist, sondern für die Eltern, die früh wieder arbeiten gehen. Ich würde sagen, kein Kind verpasst etwas, wenn es erst mit 3 in die Kita geht. Auch der Spracherwerb ist in drei Jahren Kindergarten machbar. Das familiäre Notwendigkeiten andere Modelle erfordern, wurde erkannt, aber der qualitative Ausbau ist nicht entsprechend erfolgt.
Sie haben nicht wirklich gelesen, was ich geschrieben habe, oder?
Oder weil der Dienstherr sagt: Bleibst du länger zuhause als die Bezugsdauer von Elterngeld, dann versetze ich dich im Umkreis von 50km
Sie haben durchaus Recht mit der Behauptung, dass manche Kinder in der Kita besser aufgehoben sind. Aber Kitabetreuung ab 6 Monaten scheint ja schon ein Must-have zu sein, jeder rennt unreflektiert nach einem Kitaplatz. Es geht doch nur um die ersten 2-3 Jahre, und das würde die Kitas massiv entlasten, denn damit wäre der Personalschlüssel wieder akzeptabel und der Beruf attraktiver. Alles eine Frage von Ursache uns Folgen.
Und zu Ihrem “auferzwungenen” Rollenverständnis. Auch das kann man so nicht pauschalisieren, oft werden solche Gedanken gerade von Leuten nach außen getragen, die nicht so leben und meinen, die anderen müssen dann totunglücklich sein. Dem ist nicht so. Ich denke, die meisten Eltern kommen mit ihrer Rollenverteilung und Aufgabenteilung gut zurecht. Und wie gesagt, es geht um die ersten 2-3 Jahre, warum wird hier so ein Geschrei gemacht? Ist es nicht doch eher ein wirtschaftliches Interesse statt ausschließlich das Wohl des Kindes?
Ja, ob das Kind profitiert, hängt sehr an der Offenheit der Mutter. Ich sage absichtlich nicht ” Bildung”, sondern eher, ob sie bereit ist, Neues auszuprobieren.
Nö, auch Fliesenleger*innen, Frisör*innen, Bäckereifachverkäufer*innen, Altenpfleger*innen, Stuckateur*innen, Elektriker*innen, Bürokaufleute und Krankenschwestern- und brüder werden Eltern.
Und die verdienen häufig nicht genug, um mit einem Gehalt ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können, weshslb sie GEZWUNGEN sind ihr Kind schon mit einem Jahr in die Krippe zu geben, obwohl sie es lieber noch länger zu Hause betreuen würden.
Auch das ist Realität und das ist auch nicht schön.
Und ich verrate ohnen noch ein Geheimnis: Manchmal sind es gerade die Lehrer- und Erzieherkinder, die in der Kita unangenehm auffallen.
Glaube ich sofort. Habe aber nie behauptet, dass die die tollsten Eltern sind. Für die gilt nämlich genauso, dass sie ihre Probleme an ihre Kinder weitergegeben. Sind schließlich auch Menschen.
Schon die Großmutter wusste: „Lehrers Kinder, Pfarrers Vieh, gedeihen selten oder nie“. 😉
Deshalb muss sich der Arbeitgeber auch flexibel und familienfreundlich aufstellen.
Es ist Ihnen zu wünschen, dass Ihr Partner für Sie ordentlich in eine Rentenversicherung eingezahlt hat, während Sie viele Jahre nicht erwerbstätig waren, und dass Ihre Beziehung hält. Wie viele Frauen bereuen das Zuhause-Bleiben oder Teilzeit irgendwann sehr, weil sich das deutlich auf die Rente auswirkt.
Ich finde übrigens, das Einbeziehen von Großeltern in die Kinderbetreuung kann man nicht so einfach voraussetzen, wie Sie das in mehreren Beiträgen tun. Viele Großeltern sind selbst noch berufstätig oder weit weg oder wollen sich im Ruhestand nicht so binden.
Und das Betreuen, Nachlaufen, Heben und Halten von Babys und Kleinkindern ist körperlich anstrengend, belastet den Beckenboden der postmenopausalen Großmutter – nein danke
Das ist doch der Punkt, der verändert werden muss –
Betreuungszeit muss angemessen finanziert werden, Beiträge für AL, RV und deren Anrechnung müssen eine Selbstverständlichkeit sein.
Mein Schwager ist vor über dreißig Jahren wegen der beiden Kinder zu Hause geblieben.
Mutti ging arbeiten.
“Es sei denn, das „Lernen“ ist nur Reproduktion von Gruppenangeboten, es wird nachgeplappert ohne Individualität.” – Manche Krippenerzieherinnen “liiieben” Fingerspiele und dichten sogar selbst zu allen möglichen Anlässen. Es soll ja so wichtig zur Förderung der Kleinen sein. Dabei wird aber leider oft ausgeblendet, dass Animationen für eine größere Gruppe nicht zu vergleichen sind mit dem Spiel mit nur einem Kind, zu dem gerade ein inniger Blickkontakt besteht.
Kleinen Kindern bleibt gar nichts anderes übrig, als sich an die realen Betreuungsbedingungen anzupassen. Manche Rituale tauchen in Krippen alle Jahre im gleichen Stil auf, weil sie von den älteren Krippenkindern unter dem Lob der ErzieherInnen an Jüngere weitergegeben werden. Aber weil es so viel attraktives Plastikspilezeug gibt, lernen Kleinkinder nicht so leicht den Pinzettgriff, als wenn sie etwas aus Rindenstücken und Tannennadeln bauen. Wenn dann noch die Sprachförderung mit Hilfe von Bildkarten und Lerngeschichten auf dem Programm steht, ist es gar nicht so erstaunlich, dass manches gut gemeinte Angebot nicht sonderlich viel bringt.
Für uns mussten die Eltern keine dreieckigen Stifte mit Nöppchen gegen das Abrutschen der Finger kaufen und trotz fehlenden Kindergartnenbesuchs klappte es wesentlich besser mit dem Schreiben als heute.
Eltern und Erzieher müssen sich einfach Zeit nehmen, auf das zu achten, was Kinder können. Dann bekommen Kinder auch das Feedback, das für sie wichtig ist. Das zeitaufwändige Verfassen von Bildungsdokumentationen könnte man sich meiner Meinung nach ersparen. Einige ErzieherInnen sind ja schon dazu übergegangen.
Als Aushilfe im Frühhort kann ich inzwischen gut unterscheiden welche Grundschulkinder Zuhause mit digitalen Medien versorgt werden. Die tun mir echt leid. Diese Kinder sind völlig überwältigt von den Eindrücken digitaler Suchtprodukte. Die stehen neben sich, da ist nichts zu erwarten.
Das kann gar nicht sein, weil die Eltern es doch am besten können.
Da ist ein Junge, der malt nur Bilder mit halb Mensch-, halb Dämon Gestalten. Fragt man ihn danach redet er unverständliches Zeug über Elemente und töten. Es ist gruselig.
Glaube ich sofort.
Deshalb ja auch – Elternbetreuung bei der Erziehung als Selbstverständlichkeit bis mindesten GS.
Viele müssen erst lernen, wie man sich in welchem Alter angemessen um sein Kind kümmert.
Habe viele Eltern – trotz tausender influencender Mummys and Families auf YT auch nicht mehr so unbedingt drauf.
Wer guckt schon (lange) zu, wie ein Kind beruhigt wird, wie einem Kind vorgesungen oder vorgelesen (gibt es solche vids überhaupt?) …. wird?
Ist laaaaaangweilig. Würde ich auch so sehen.
Denn die eigentliche Faszination ist doch das eigene Kind und dessen Entwicklung -zumindest in meiner Familienwelt.
Das müssen viele Eltern erst lernen.
Ist ja nix mehr mit mehreren Generationen und Klaus erzieht Peter und Peter erzieht Sophie und …..
Und das Dorf, das ja zum Erziehen auch mal wichtig war, zieht sich raus, weil es eins von den Eltern auf die Nuss kriegt oder weil es Angst vor den Jugendlichen hat…..
Wie ich schon immer gedacht habe, die erste 6 Lebensjahre sind sehr wichtig, da muss man als Eltern ran. Es macht doch Spaß, seinem Kind die Welt zu erklären. Ich habe z.B. so eine schönes Bodenpuzzle mit Buchstaben und Zahlen gekauft aus Schaumstoff. Wenn ich mich recht erinnere, konnte mein Sohn schon zwischen 2 und 3 alle Buchstaben und Zahlen – ganz spielerisch. Außerdem gibt es doch tolle Bücher. Und wenn man draußen ist, dann sieht man vielleicht ein P für Parkplatz – das spricht man dann aus oder E wie bei Edeka usw.. Da gibt es doch so viel, was man draußen zeigen kann.
Die Kleinen sind so neugierig und fragen immer, warum. Dieses Wissenwollen muss man ausnutzen und dem Kind so viel wie möglich beibringen.
Also bei uns in der ersten Klasse konnten alle Kinder bis Weihnachten lesen. Und so einen Quatsch mit Schreiben nach Hören gab es bei uns nicht, das hätte ich auch nicht geduldet als Mutter. Bei uns wurde nach Fibel gelernt und gleich korrekt von Anfang an geschrieben.
Eine verpflichtende Vorschule, dann wahrscheinlich IN der Schule, sollte es zukünftig geben, sonst klappt hier wahrscheinich gar nichts mehr.
Um Ihnen mal Ihre Illusionen zu nehmen: zu jedem Fibellehrgang gehört heutzutage eine Anlauttabelle (die ursprünglich für „Lesen durch Schreiben“ entwickelt wurde). Und ob Sie das als Mutter „geduldet“ hätten oder nicht, spielt keine Rolle, die Schule entscheidet über das Lehrwerk und damit auch über die Leselernmethode.
Ich will mich darüber nicht streiten, aber unsere Lehrerin, hat nach der alten Methode unterrichtet. Rechtschreibfehler wurden von Anfang an korrigiert. Sie ist eine Toplehrerin gewesen, besser kann man gar nicht unterrichten, da hatten wir absolutes Glück.
Es gibt immer einen gewissen Spielraum beim Lehrplan und als Eltern haben wir schon ein bisschen mitzureden, denn ganz so doof sind wir nicht.
Die Methodendiskussion ist insofern unsinnig, als dass jeder der Wege nur dann zum Ziel führt, wenn man ihn weise, mit Herz und Verstand und nicht dogmatisch umsetzt. An unserer Grundschule gab es zwei Parallelklassen, unsere beiden Kinder haben mit der Lesen – durch – Schreiben – Methode, klug umgesetzt mit sanfter Rechtschreiborientierung von Anfang an gelernt. Deutsche Rechtschreibung war keins Ihrer Probleme und bei unserer Tochter hat sich so eine echte Liebe zum Lesen und zu Sprachen entwickelt. Die Deutschlehrerin, die beide in der fünften Klasse übernommen hat, hat meinen subjektiven Eindruck, dass man da nicht mehr gemerkt hat, wer mit welcher Methode gestartet ist, bestätigt. In der weiteren Zeit haben sich die Wege unserer Kinder in Bezug aufs Lesen völlig unterschiedlich entwickelt, aber das hat eher mit dem WhatsApp -Zeitalter zu tun, wo Zeichensetzung sowie Groß- und Kleinschreibung keine Rolle mehr spielen und vielleicht auch mit einem Lehrerinnenwechsel nach der dritten Klasse, wo dann die aktive Arbeit an Lesetexten ein wenig in den Hintergrund trat. Ich möchte nicht fallsch verstanden werden, mir ist klar, dass Lesen durch Schreiben nicht für alle Kinder geeignet ist – umgekehrt aber genauso. Wer schon gut Vorkenntnisse hat, dürfte sich bei der dritten Fibelseite zu Tode langweilen. Es sei denn, er oder sie hat gute, engagierte Lehrer bzw. Lehrerinnen, womit ich wieder am Anfang meines Kommentars wäre.
Danke, noch ein Grund für smarterstartab14.de
Okay, das kam jetzt vielleicht etwas missverständlich rüber. Er hat dadurch keineswegs die deutsche Sprache verlernt, es wird bei dieser Kommunikation nur weniger drauf geachtet. Sein erstes Smartphone hatte er in der siebenten Klasse, also mit knapp 13. Gar nicht so weit weg von 14, aber damals unvermeidlich, denn wenn der Einzugsbereich seiner Klasse etwa 40 km beträgt und der eigene Wohnort dreimal pro Schultag vom Bus angefahren wird, ist das Netz als Kommunikationsmöglichkeit leider so gut wie unverzichtbar. Klassengruppe, Fußballgruppe, ohne wäre er angehängt gewesen. Es blieb auch genug Zeit für das Radfahren, Rumstromern im Wald, die Fußballmannschaft sowie Freunde im wahren Leben.
Aber ansonsten stimme ich mit Ihnen überein, dass vor dem Ende der Grundschule (bei uns in Klasse 6) durchaus aufs Smartphone verzichtet werden kann oder vielleicht sogar sollte. Dem steht meinem Empfinden nach oft entgegen, dass es doch so schön bequem ist, denn das Kind ist ja beschäftigt.
Im SV lassen die Entwickler ihre Kids erst mit – tada! – 14 Jahren an die Geräte.
Vorher Kunst, Musik, Sport und der ganze andere Schulkram…
Hat wohl doch Auswirkungen auf das Hirn….
Scheinbar sind in keinem EU-Land den Eltern ihre Kinder so egal wie in Deutschland.
aber Bildung kostet doch Geld!
(und bessere Bildung sogar noch mehr Geld)
Ihr wollt doch ncht etwa anfangen, richtig viel Geld auszugeben für Bildung und Personal?
Das wäre ja Sozialismus pur!
Wer sich in absehbarer Zeit eben keine Privatschule leisten kann, kriegt halt einen staatlichen Abschluss. Den aber geschenkt.
Vorlesen kostet nichts, hilft aber ungemein.
Nö. In Frankreich zB gibt es einfach eine Vorschule
Ist doch gut, wenn es mal was gibt, das in Rumänien und Bulgarien besser ist als in Deutschland, vielleicht sogar im Albanien und Nordmazedonien, zwei Beitrittskandidaten. Warum soll Deutschland immer der Streber-Musterknabe sein? 🙂
Vielleicht wandern dann mehr Leute in die genannten Länder aus, weil ihre Kinder da einfach eine bessere Bildung erhalten? 🙂
Gerade wenn das Kind in der Kita war, kann es doch zum Schulbeginn zumindest seinen Namen lesen. Es ist bei einem Kitakind doch alles mit Namensetiketten versehen, von Jacke bis Brotdose. Da lernt es doch automatisch, wie sein Name geschrieben aussieht. Uns würde im Kindergarten auch immer vor dem Mittagsschlaf vorgelesen, wobei ich das Glück hatte, dass meine Eltern und älteren Schwestern mir ebenfalls vorgelesen hatten.
Der Artikel sagt aus, dass sich in Deutschland eine Unterschicht verfestigt hat. Ich habe das bereits befürchtet, als ein Herr Schröder so stolz darauf war, den größten Niedriglohnsektor Europas geschaffen zu haben. Es ist ein Schichtenproblem. Ich selbst ermutige Mütter immer, auch in ihrer Muttersprache vorzulesen, zu spielen etc. Gerade wenn sie nicht gut Deutsch spricht, und daher Angst davor hat. Die Sprache ist im Grunde nicht so wichtig, ein sozialisiertes Kind lernt dann Deutsch. Es gibt sehr gute Curricula über Prä – Zweitsprachenerwerb und Mathematik, systematisch habe ich das aber erst im Ausland gehört. Das gehört hier dringend ins Lehramtstudium! Und in die Erzieherausbildung.
Ich finde es bemerkenswert, wie viele Forumsteilnehmer hier von sich und ihren eigenen – wohl bildungsaffinen – Lebensumständen ausgehen. In diesen Familien wachsen die Kinder behütet und reichlich gefördert auf und gehören sicherlich nicht zu den Kindern, von denen im Artikel die Rede ist.
Aber genau um die geht es doch gar nicht. Es geht um die Kinder, die in bildungsfernen Haushalten aufwachsen, die wenig Anregungen erhalten, wo zuhause kein deutsch gesprochen wird, wo niemand vorliest (vielleicht kann das in diesen Familien auch keiner), wo niemand bastelt oder schreibt (zumindest nicht mit der Hand und einen Stift)…..Familien, die ganz andere Lebensumstände habe, als sich das die meisten vorstellen können (zumindest lese ich das aus zu vielen posts heraus).
Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es schwer ist, sich vorzustellen, wie solche Familien leben und warum viel zu viel nicht oder anders funktioniert. Wir sollten aber nicht den Fehler machen, alles von unsere – z.T. preveligierten Warte aus betrachten. Das wird den Familien nicht gerecht.
Hier sind so viele mit „es müsste“, „es sollte doch möglich sein“ unterwegs, aber das genau der Punkt, denn diese Familien können nicht, aus welchen Gründen auch immer und da müssen Wege gefunden werden Abhilfe zu schaffen, indem überlegt wird, welche Angebote man diesen Kindern machen kann, damit auch sie einen besseren Start in ihre Zukunft haben.
Da gebe ich ihnen durchaus recht.
Diese Familien gibt es und sie brauchen dringend Unterstützung. Aber: Es gibt viele Eltern die, auch wenn sie kein Abitur oder gar Studium vorweisen können, all die schönen Dinge wie vorlesen, basteln usw. viel öfter mit ihren Kindern machen würden.
Allerdings arbeiten sie 40 Stunden in der Woche und zwar nicht, weil sie das so wollen, sondern weil sie müssen, da ansonsten das Geld nicht reicht.
Da reicht dann oft die Energie nicht mehr, um am Abend neben der Hausarbeit, die sich ja auch nicht von alleine erledigt, noch fröhlich die Kinder zu bespaßen. Dann greift man vielleicht ganz gerne mal zum “digitalen Ruhigsteller” anstatt ein Buch vorzulesen oder mit dem Kind Brettspiele zu spielen.
Wenn ich mir vorstelle, ich würde von morgrns bis abends bei Aldi an der Kasse sitzen oder hinter der Wursttheke im Supermarkt stehen oder ich wäre den ganzen Tag damit beschäftigt Pakete auszutragen – ich weiß nicht wieviel Energie und Geduld ich dann noch aufbringen könnte abends Papiefliegerchen zu falten oder Märchen zu erzählen, wenn sich nebenan die Wäsche stapelt und die Spülmaschine ist auch noch nicht ausgeräumt.
Vielleicht würde ich den dringenden Wunsch verspüren, weniger arbeiten zu können und mehr Zeit für meine Kinder zu haben.
Aber in unserer Gesellschaft wird das inzwischen ganz selbstverständlich erwartet:
Beide Eltern sollen am besten Vollzeit arbeiten, ihre Kinder in überfüllte Einrichtungen stecken und abends dann gutgelaunt den Rest des Familienalltags wuppen.
Wenn,s klappt – schön.
Und wenn nicht?
Es sind nicht nur die Kinder aus Familienverhältnissen, die wirklich desolat sind, die Defizite haben.
Es sind auch Kinder aus Familien, wo die Eltern sich redlich bemühen, es aber aufgrund permanenter Überlastung nicht schaffen.
Denen nützen noch mehr noch mehr Kitaplätze eher weniger, sie haben ja schon einen. Die bräuchten einfach mehr Zeit für ihre Kinder.
Danke, für Ihre Ausführungen. Da gehe ich mit, habe in all den Jahren auch wahrgenommen, wie bemüht die Familien sind, die Sie angesprochen haben. Die sind gesprächsbereit und unterstützen ihre Kinder, wenn sie entsprechendes Feedback bekommen. Diese Familien nehmen auch gerne Angebote, die wir unterbreiten, an. Nach einem meist etwas holprigen Start, entwickelt sich eine Mehrzahl dieser Kinder dann recht positiv.
“Aber in unserer Gesellschaft wird das inzwischen ganz selbstverständlich erwartet:
Beide Eltern sollen am besten Vollzeit arbeiten, ihre Kinder in überfüllte Einrichtungen stecken und abends dann gutgelaunt den Rest des Familienalltags wuppen.”
Nein, das wird nicht ganz selbstverständlich erwartet. Wer erwartet das denn genau? Die Gesellschaft sind wir alle. Und nicht einmal ich;-) erwarte so etwas.
Der Punkt ist doch eher, dass viele Eltern aus unterschiedlichsten Gründen leider so viel arbeiten müssen.
Ich erwarte, dass der Staat endlich Arbeitgeber dazu verdonnert, flexiblere Möglichkeiten anbieten zu müssen, die außerdem keine Benachteiligung in puncto Karriere mit sich bringen.
In meinem Beruf ist das ja möglich. (Leider hauptsächlich immer noch) Frauen steigen mit Teilzeit wieder ein und stocken dann irgendwann auf, können aber während dieser Zeit befördert werden und dürfen nicht benachteiligt werden. Ich habe eine Kollegin, mit vier Kindern, die ihre A14 während der Schwangerschaft mit dem letzten Kind erhalten hat. Und sie war natürlich immer wegen der Geburten ihrer anderen Kinder zuvor raus gewesen.
Dieses Modell muss woanders auch endlich möglich sein!
Frauen, die beides wollen (Doch, das geht und ist auch völlig okay!), sollte das auch möglich sein. Nach wie vor ist es so, dass sehr gut ausgebildete Frauen aufgrund von Kindern das Nachsehen haben.
Na, da sind wir uns ja mal fast einig. Beides zu wollen ist ok und muß genauso unterstützt und gefördert werden, wie eben auch nicht beides zu wollen.
Frauen sollten beruflich keine Nachteile in Kauf nehmen müssen, nur weil sie auch Mütter sind. Da haben sie recht.
Ich finde aber, es müssen auch die Frauen (und Männer) wertgeschätzt und berücksichtigt werden, die ihre Hauptaufgabe zuallerst darin sehen, sich für einige Jahre aus der Erwerbstätigkeit zurückzuziehen, um die überaus wichtige und wertvolle familiäre Erziehungsarbeit zu übernehmen.
Das Geld, daß der Staat hier einspart, weil er keinen Krippenplatz zur Verfügung stellen muß, könnte er direkt den Familien geben.
Das würde den Personalnotstand in den Kitas entschärfen und vielen Eltern den Druck nehmen, kurz nach der Geburt eines Kindes wieder in den Beruf zurückkehren zu müssen, weil sie sonst nicht über die Runden kommen. UND –
Erziehungszeiten müssen auch bei der Rente berücksichtigt werden.
Ja ich weiß, dann bleiben die Kinder von all den “saufenden, Kette rauchenden, Haushalt und Familie vernachlässigenden, sozial und intellektuell minderbegabten Rabeneltern” auch zu Hause.
Ich weiß aber nicht, ob es gerecht ist, deshalb all den vielen Vätern und Müttern, die es gut machen und gerne mehr Zeit für ihre Kinder hätten, vor allem in den ersten Jahren, diese Chance zu verweigern.
Es geht mir, wohlgemerkt, hauptsächlich um die ersten drei Jahre. Kinder, die kein oder nur wenig deutsch in ihrer Familie sprechen, hätten dann im Kindergarten immer noch drei Jahre Zeit bis zum Schuleintritt.
PS: Es ist sch…egal, ob die Eltern Polizisten oder Verkäufer bei Aldi sind. Kinder brauchen Eltern. Ansonsten brauchen Eltern Gummis oder Pille.
Ach ja…..
Kann man bitte einmal aufhören, die Eltern, die sofort nach dem gesetzlichen Mutterschutz wieder anfangen Vollzeit zu arbeiten und ihre Kinder in die Krippe geben darzustellen, als würden sie ihren Kindern ein großes Unrecht antun?
Meine Eltern waren beide Polizisten in Vollzeit und wir sind sechs Schwestern. Meine Mutter hatte jeweils nach dem ersten Geburtstag wieder Vollzeit gearbeitet.
Sowohl meine Schwestern als auch ich haben unsere Zeit in Kita und Hort in guter Erinnerung. Wir konnten so auch die Nachmittage mit unseren Freunden verbringen und hatten viele Ausflügen, beispielsweise zum Eselreiten oder ins Kindertheater, unternommen.
Abends würde darauf geachtet, dass es ein gemeinsames Abendessen gibt, bei dem die Themen des Abends besprochen wurden. Und trotz Vollzeit hatten unsere Eltern Zeit gehabt, uns beim Lernen zu unterstützen, uns vorzulesen oder Brettspiele zu spielen.
Nein! Wer nach 8 Wochen sein Kind in die Krippe gibt, hätte besser kein Kind bekommen.
Vienuss man sich einfach mal entscheiden, reichlich Kohle oder Kinder.
Wer nur ansatzweise zur Kohle neigt- es gibt Verhütungsmittel.
Diese verantwortungslos Elternschaft führt ihre Kinder und die Gesellschaft ins Verderben!!!!
Ach so, und wer seinen dementen Ehepartner ins Pflegeheim gibt, hätte besser nicht heiraten sollen?
Schließlich hätte man bereits vor der Hochzeit so eine Situation gedanklich durchspielen können und dann merken, dass man damit überfordert wäre.
Nicht ärgern. Der “Alte Pauker” sieht offenbar nicht mehr so gut.
Da nimmt man die Welt bisweilen nur noch schwarz/weiß wahr.
Je geringer die (Aus)Bildung, desto größer die Klappe!
Da haben wir ja Glück gehabt, dass es bei unserem Sohn nicht acht, sondern 12 Wochen waren. Wer weiß, was sonst aus ihm geworden wäre…. So ist er zu einem empathischen, herzlichen und offenen Menschen herangewachsen. Übrigens dank sehr guter Erzieherinnen, einer tollen Gruppendynamik (Die etwa ein Jahr älteren Knirpse aus seiner Gruppe bildeten jahrelang, bis ins Gym einen echten Freundeskreis) sowie Dank eines engen Miteinanders zwischen Kita und uns. Und dank eines Zuhauses, das ihm immer Rückhalt, aber auch Regeln gegeben hat. Ihre Pauschalverurteilungen sollten Sie einfach mal steckenlassen. An alle anderen, sachlicheren Kommentatoren: Ja, ich weiß, dass viele Elternhäuser nicht in dieses ‘Schema” passen und mir sind die diversen Gründe dafür bewusst. Bin nur sauer wegen solch extremer Pauschalisierungen.
Es fühlen sich immer die falschen auf den Schlips getreten.
Wir hatten ebenfalls eine fantastische Kita, alle unsere 4 Kinder haben sie besucht, ab 7 – 12 Monate.
Aber natürlich gibt man seine Erziehungskompetenz nicht an die Einrichtung ab, sondern arbeitet mit den Erzieherinnen zusammen.
Im übrigen besuchen Kinder aus sozioökonomischen gut gestellten Familien häufiger und früher eine Krippe bzw. Kita.
Der Unterschied liegt mMn in unterschiedlichen Erziehungsverhalten der Elternhäuser und das Interesse, die Empathie, die Unterstützung und Ermutigung, die Kinder dort erfahren. Die Beteiligten wie EuE, LuL, aber auch Sozialarbeiter, Familienhelfer, Mitarbeiter von SPZs, Ergotherapeuten etc. sollte man mal Fragen stellen und eine sinnvolle und aussagekräftige Studie erheben. Es ist nicht der Unterschied fremdbetreut oder nicht, denn sonst wären die Ergebnisse in Ostdeutschland zu DDR Zeiten gravierend anders gewesen- da gab es eine fast 100 prozentige fremdbetreuung schon sehr früh.
https://www.zeit.de/2023/53/integration-schulen-aladin-el-mafaalani-pisa-studie
Als lange stille Mitleserin wollte ich mich aktiv in diesem Forum beteiligen, verabschiede mich aber wieder.
Ich liebe und bewundere meine Eltern und möchte nicht in einer Umgebung diskutieren, in der sie beleidigt werden, nur weil sie Elternschaft und Beruf kombiniert hatten.
Da ich mit einem Gendefekt geboren wurde, hatte man meinen Eltern gesagt, ich sei maximal “bedingt schulfähig”. Durch ihre Ermutigung und Unterstützung habe ich es bis an die Universität geschafft.
Puh, heftig! Ich dachte nicht, dass wir mit Wert legen auf Lesen, auch gemeinsames, sowie miteinander sprechen in der Familie, in der Minderheit wären. Das ist echt hart.
Und das hat gar nichts mit der Frage Kita oder nicht zu tun – meine Kinder konnten bei Schuleintritt lesen und waren beide ab 14 Monaten in der Kita. Es bleibt noch genug Zeit jeden Tag – wenn man sie sich denn nimmt. Und auch Kitas haben Bücher. Qualität, nicht auf Biegen und Brechen Quantität… die fehlt. Aber alle doktorn an der Quantität herum.