KÖLN. Dass der Wirtschaftsstandort Deutschland vom technischen und naturwissenschaftlichen Know-how seiner Fachkräfte abhängt, ist eine Binsenweisheit. Und natürlich davon, dass es genügend solcher Fachkräfte gibt. Die Grundlage dafür legt die Schule mit Unterricht in den sogenannten MINT-Fächern (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Dummerweise sieht es gerade hier besonders düster aus – wie eine aktuelle Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) schonungslos deutlich macht.
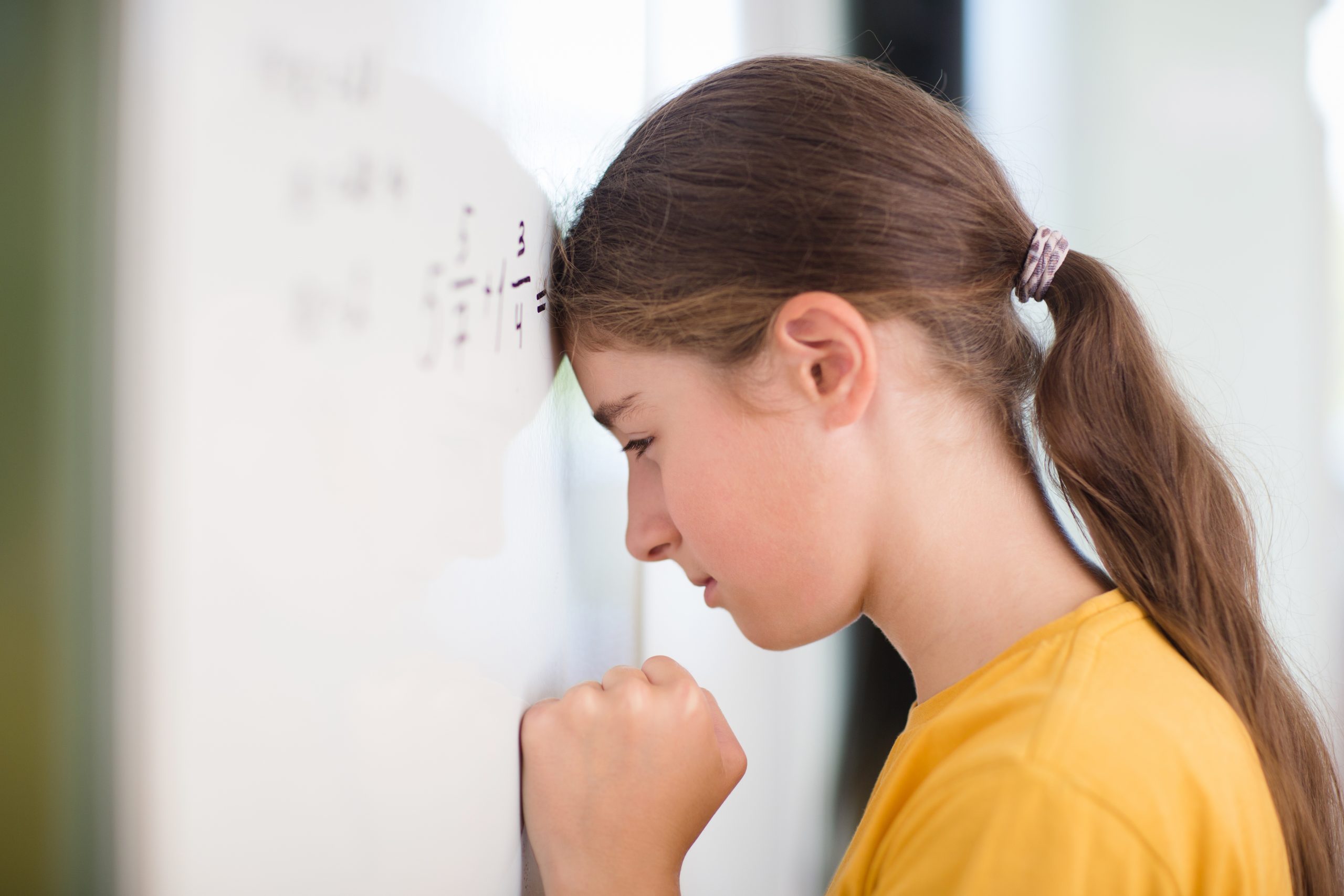
Mittel- bis langfristig wird in Deutschland der Bedarf an Fachkräften, die in sogenannten MINT-Berufen arbeiten, stark zunehmen – getrieben durch Mega-Trends wie die Digitalisierung, den Klimaschutz und die Demografie. Aktuell scheiden dem IW-Bericht zufolge jährlich über 64.800 MINT-Akademikerinnen und MINT-Akademiker aus Altersgründen aus dem Arbeitsmarkt aus. In fünf Jahren wird der jährliche demografische Ersatzbedarf laut Prognose um 9.300 auf 74.100 zunehmen. Bei den MINT-Facharbeiterinnen und -Facharbeitern beträgt der aktuelle demografische Ersatzbedarf rund 259.800 – und wird in fünf Jahren um rund 12.200 auf 272.000 steigen.
„Der Nachwuchs von MINT-Expertinnen und -Experten ist daher für die Zukunftsfähigkeit in Deutschland von besonderer Bedeutung“, heißt es. In den nächsten Jahren sei aber mit einem Rückgang der MINT-Absolvierendenzahlen zu rechnen: Betrug die Zahl der MINT-Studierenden im ersten Hochschulsemester im Studienjahr 2016 noch rund 198.000 und sank bis zum Studienjahr 2019 leicht auf 192.500, so nahm die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger danach stark auf knapp 179.500 im Studienjahr 2023 ab.
Betrachtet man die Studienanfängerzahlen in Ingenieurwissenschaften und Informatik, so sind diese von 143.400 im Studienjahr 2016 auf 128.400 im Studienjahr 2023 um 10,5 Prozent gesunken, wobei die Anzahl deutscher Studienanfängerinnen und -anfänger sogar von 104.300 auf 80.100 noch deutlicher um 23,2 Prozent eingebrochen ist. „Langfristig dürfte der Nachwuchs an MINT-Fachkräften in Deutschland noch weiter sinken, da durch die Demografie die nachrückenden Jahrgänge kleiner sind“, erklären die IW-Forscherinnen und Forscher.
Auch in puncto Qualifikation sind die Aussichten düster. „Für die kommenden Jahre ist besonders bedenklich, dass bei 15-jährigen Schülerinnen und Schülern in den letzten Vergleichsarbeiten die Kompetenzen in Mathematik deutlich gesunken sind“, heißt es. Bei den Naturwissenschaften sieht es kaum besser aus. Zwischen PISA-2012 und PISA-2022 sind die naturwissenschaftlichen Kompetenzen der 15-Jährigen von 524 auf 492 Punkte und die mathematischen Kompetenzen von 514 auf 475 Punkte stark gesunken – „das schlechteste Ergebnis aller bisherigen PISA-Studien.“ Und: „Ein Rückgang der durchschnittlichen MINT-Kompetenzen lässt sich dabei sowohl an nicht gymnasialen Schularten als auch an den Gymnasien feststellen.“
Weiter berichteten die Wirtschaftsforscherinnen und -forscher: „Der Rückgang der durchschnittlichen Kompetenzen in Mathematik und den Naturwissenschaften geht damit einher, dass immer mehr Jugendliche nicht mindestens die PISA-Kompetenzstufe II erreichen. Ihnen fehlen damit grundlegende Kompetenzen und ein Übergang, z. B. in die berufliche Ausbildung, gestaltet sich für diese Personengruppe schwierig. Gleichzeitig ist der Anteil der leistungsstarken Schülerinnen und Schüler geringer geworden.“ In Mathematik nahm der Anteil der leistungsstarken Schülerinnen und Schüler von 17,5 Prozent auf 8,6 Prozent ab, der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit sehr geringen Kompetenzen stieg dagegen von 17,7 Prozent auf 29,5 Prozent an.
„Im internationalen Vergleich verschlechterten sich die Ergebnisse in Deutschland besonders stark“, heißt es – was auch mit der Corona-Krise zu tun habe: „Im Vergleich zu anderen Ländern zeigt sich auch, dass Deutschland vergleichsweise schlechte Ausgangsbedingungen für den Distanzunterricht hatte und weniger familiäre Unterstützung während der Schulschließungen leisten konnte.“
„Negativ beeinflusst werden die Ergebnisse, wenn die Jugendlichen sehr viele Stunden am Tag außerhalb der Schule mit digitalen Medien (wie Videospiele oder soziale Netzwerke) verbringen“
Eine eigene empirische Untersuchung der 2022er PISA-Daten zeige, dass ein hoher beruflicher Status der Eltern, der eng mit deren Bildungsstand verknüpft ist, einen positiven Einfluss auf die PISA-Ergebnisse hat, ebenfalls die Anzahl der verfügbaren Bücher im Haushalt. „Wird im Haushalt die deutsche Sprache gesprochen, hat dies ebenso einen signifikant positiven Einfluss auf die PISA-Ergebnisse in Mathematik und in den Naturwissenschaften. Negativ beeinflusst werden die Ergebnisse, wenn die Jugendlichen sehr viele Stunden am Tag außerhalb der Schule mit digitalen Medien (wie Videospiele oder soziale Netzwerke) verbringen“, schreiben die Autorinnen und Autoren.
„Der Besitz eines eigenen Computers hat zumindest in Mathematik einen positiven Einfluss auf die Kompetenzen. Ein Index über die Unterstützung der Schule während der Schulschließungen, der z. B. Angaben darüber enthält, ob Lehrmaterial versendet, Aufgaben kontrolliert oder digitaler Unterricht abgehalten wurde, hat ebenso einen signifikant positiven Einfluss auf die Lernergebnisse. Je mehr Probleme die Jugendlichen jedoch beim Selbstlernen hatten, wie z. B. Probleme beim Zugang zu einem digitalen Gerät oder zum Internet, Probleme, einen ruhigen Platz zum Arbeiten zu finden oder auch mangelnde Unterstützung bei den Schulaufgaben, desto niedriger fallen die Kompetenzen in Mathematik aus.“
Es werde ferner deutlich, dass auch die Einstellung der Jugendlichen zum Fach Mathematik eine Rolle spielt. „Schülerinnen und Schüler, die angeben, dass Mathematik zu ihren Lieblingsfächern gehört und die damit eine positive Einstellung zu diesem Fach aufweisen, weisen höhere Kompetenzen auf. Daneben ist es auch wichtig, dass es den Lehrkräften gelingt, eine ruhige Arbeitsatmosphäre im Klassenraum zu schaffen. Je höher der Indexwert für die Disziplin im Mathematikunterricht, je höher fallen auch die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler aus“, so heißt es in der Studie.
„Mit den Veränderungen der Kompetenzen hat sich auch die Einstellung der Schülerinnen und Schüler zum Fach Mathematik verändert. Nur 38 Prozent der Schülerinnen und Schüler geben in der aktuellen PISA-Studie an, dass Mathematik zu ihren Lieblingsfächern gehört. Die naturwissenschaftlichen Fächer sind etwas beliebter. Befragt, wie sie sich im Mathematik-Unterricht fühlen, geben die meisten Schülerinnen und Schüler in Deutschland ‚müde‘ (48,9 Prozent) oder ‚gelangweilt‘ (40,6 Prozent) an.“ Ebenfalls alarmierend: „Verglichen mit früheren PISA-Erhebungen hat die Ängstlichkeit der deutschen Schülerinnen und Schüler bezogen auf das Fach Mathematik zugenommen. Gleichzeitig hat die Freude und das Interesse an diesem Fach abgenommen und immer weniger sind der Meinung, dass Mathematik für den späteren Beruf von wichtiger Bedeutung ist.“ Im Vergleich zu den Jungen falle die Ängstlichkeit der Mädchen größer aus.
„Ein Grund dafür, dass die Kompetenzen der deutschen Schülerinnen und Schüler nicht höher ausfallen, kann der relativ enge Zusammenhang zwischen dem sozio-ökonomischen Status und dem Lernergebnissen in Deutschland sein. Durch die Zuwanderung nach Deutschland in den letzten Jahren ist dieser Zusammenhang im Vergleich zu vorherigen PISA-Studien wieder größer geworden. So ist der Anteil der Fünfzehnjährigen mit Zuwanderungshintergrund zwischen den Jahren 2012 und 2022 von 25,8 auf 38,7 Prozent angestiegen“, berichten die Wirtschaftsforscherinnen und -forscher.
Im Vergleich zu Schülerinnen und Schülern ohne Zuwanderungshintergrund weisen die zugewanderten Jugendlichen deutlich niedrigere Kompetenzen in Mathematik auf. Bei den Schülerinnen und Schülern der ersten Generation fallen diese besonders gering aus. In dieser Gruppe fällt auch der Rückgang der Kompetenzen mit -62,6 Punkten im Vergleich zum Jahr 2012 besonders hoch aus. Damit einhergehend ist auch der Anteil der Schülerinnen und Schüler der ersten Generation, die nicht die Kompetenzstufe II erreicht und damit zur Risikogruppe zählt, besonders hoch. In Mathematik beträgt dieser Anteil 64 und in den Naturwissenschaft 61 Prozent. Damit gehören weit über die Hälfte der Schülerinnen und Schüler aus der ersten Generation zur Risikogruppe. „Hier müssen dringend Anstrengungen unternommen werden, diese Gruppe besser in das Bildungssystem zu integrieren und insbesondere die Angebote zur Sprachförderung sollten daher ausgeweitet werden“, so fordern die Autorinnen und Autoren.
„Aufgrund der fehlenden Qualität der Ganztagsbetreuung gibt es keine ausreichenden Bildungsimpulse aus der Ganztagsinfrastruktur, um die Schulqualität und die Integration zu verbessern“
Gut aufgestellt sehen sie das Bildungssystem dafür nicht. „In den letzten zehn bis zwanzig Jahren sind die Herausforderungen im Bildungssystem bei den häuslichen Inputs gestiegen. So ist der Anteil der Kinder, die zu Hause nicht deutsch sprechen und zugleich einen bildungsfernen Hintergrund aufweisen, gestiegen. Der Anteil der Jugendlichen, der regelmäßig liest, ist rückläufig und der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit vielen Büchern im Elternhaus nimmt ab. Zwar gibt es Verbesserungen bei den öffentlichen Inputs wie bei den Betreuungsrelationen und den Ganztagsschulen, jedoch gibt es aufgrund der fehlenden Qualität der Ganztagsbetreuung keine ausreichenden Bildungsimpulse aus der Ganztagsinfrastruktur, um die Schulqualität und die Integration zu verbessern bzw. die steigenden Herausforderungen aus den Entwicklungen der häuslichen Inputs zu kompensieren. Ferner fehlen institutionelle Veränderungen wie mehr Schulautonomie, verbunden mit jährlichen und flächendeckenden Vergleichsarbeiten sowie gezielten und sozial differenzierten frei verfügbaren Zusatzfördermitteln für die Schulen, die einen Qualitäts- und Entdeckungswettbewerb zwischen den Schulen zur Schaffung gleicherer Bildungschancen entfachen könnten.“
Um die Herausforderung der Gegenwart und der Zukunft zu meistern und die Bildungschancen und MINT-Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu stärken, sei die Verfügbarkeit von Lehrkräften von hoher Bedeutung. „Häufig rezipiert wird in diesem Zusammenhang der Bildungsforscher John Hattie, der mit seinem Werk ‚Visible Learning‘ (2009) eine umfassende Synthese zahlreicher Metaanalysen über die Einflussfaktoren auf Schülerleistungen schaffte. Hattie zeigt in seiner Analyse, dass (gute) Lehrkräfte zu den wichtigsten Einflussfaktoren beim Lernen zählen.“ (Zu Hatties neuer Studie – hier ein Bericht.)
Die Wirtschaft stützt Forderungen nach mehr staatlichem Engagement im Bildungsbereich nahezu einhellig. Unternehmen wurden vom IW um ihre Einschätzung gebeten, wie bedeutsam bestimmte Faktoren sind, damit die deutsche Wirtschaft die Herausforderungen – Digitalisierung, Klimaschutz, Demografie – bewältigen und gestalten kann. Dabei konnten die Unternehmen eine Bewertung auf einer Skala von 0 (völlig unwichtig) bis 100 (unbedingt erforderlich) vornehmen.
Ergebnisse: Der Median der Antworten der Unternehmen in dieser Skala liegt mit 96 besonders hoch bei der Forderung nach mehr Investitionen des Staates in das Bildungssystem. Die anderen Bedingungen/Faktoren, wie mehr staatliche Förderung der Investitionen, eine höhere Veränderungsbereitschaft seitens der Unternehmensführungen und Belegschaften, mehr Innovationen seitens der Unternehmen sowie die politische Flankierung der unternehmerischen Maßnahmen (zum Beispiel durch Freihandelsabkommen und Außenwirtschaftsförderung) liegen mit einem Median bei etwa 75 deutlich dahinter. News4teachers
Hier lässt sich der vollständige MINT-Frühjahrsreport herunterladen.
Nach Pisa-Debakel: „Es müsste ein richtiger Wumms her“ – Mathe-Professor will Schulfächer aufbrechen
„Ein Grund dafür, dass die Kompetenzen der deutschen Schülerinnen und Schüler nicht höher ausfallen, kann der relativ enge Zusammenhang zwischen dem sozio-ökonomischen Status und dem Lernergebnissen in Deutschland sein.“
Was könnte die Wirtschaft für den sozioökonomischen Standard in Deutschland unternehmen?
“Die Wirtschaft stützt Forderungen nach mehr staatlichem Engagement im Bildungsbereich nahezu einhellig.“
Was könnte die Wirtschaft selbst tun? Wie wäre es mit einer Bildungsabgabe der Wirtschaft, damit die geforderten Verbesserungen in den aufgezeigten Bereichen umgesetzt werden können? Also Geld für die Schulen, die die benachteiligten Schüler:innen aufnehmen und beschulen?
Wieso fragen Sie sich nicht, was die Schulen für bessere Leistungen in Mathematik tun können?
Wieso spielen Sie “Schwarzer Peter? Dass die Schule in erster Linie für Bildung zuständig ist, sollte doch klar sein.
Und damit meine ich nicht, dass die Lehrkräfte sich noch mehr ins Zeug legen sollen, sondern dass die Weichen politsch so gestellt werden, dass die Kinder in den Kernkmpetenzen Schreiben, Lesen und Mathematik mehr lernen. Das geht zum Beispiel durch eine Erhöung der Stundenzahl in diesen Fächern. An anderer Stelle kann gerne etwas wegfallen.
Dafür braucht man: zusätzliche Lehrkräfte.
Die kosten: Geld
Das bekommt man: vom Steuerzahler.
Interesse vieler Firmen (der „Wirtschaft“): möglichst wenig Steuern zahlen
Ich seh das schon genauso wie Palim: unisono großes Jammern von Politik und Wirtschaft, aber wenig Handeln.
Braucht man dafür wirklich mehr Lehrkräfte?
Wenn die Mathelehrkraft nur noch Mathe unterrichtet und nicht mehr sein anderes Fach oder seine anderen Fächer, geht das mit derselben Zahl an Lehrkräften.
Die Gesamtzahl an Unterrichtsstunden soll schließlich nicht erhöht. Für die Erhöhung der Unterrichtsstunden in Mathe und Deutsch soll anderer Untericht in gleicher Höhe gekürzt werden oder entfallen.
Würde ich mich aber bedanken, wenn ich mit meinem Hauptfach tagtäglich verheizt werde. Auf solche Ideen kommt man nur, wenn man sie selbst nicht ausbaden muss.
Als Deutschlehrer kenne ich das gar nicht anders. Ich werde ohnehin fast nur in meinem Hauptfach eingesetzt.
Ich unterrichte dann nur noch Mathe, Informatik und Physik lasse ich weg. Lehrer anderer Fächer machen dann was? Die Angestellten kann man entlassen, aber die Beamten sind weiterhin da und kosten. Welche Fächer sollen eigentlich wegfallen? Sport? Politik?Kunst? Mir fällt nichts ein, worauf man verzichten könnte.
Sport. Habe ich immer gehasst.
Meiner bescheidenen Erfahrung nach verlieren Sie dann die anderen Bereich der naturwissenschaftlichen Bildung, denn nicht selten unterrichtet der Mathelehrer auch die naturwissenschaftlichen Fächer (oder umgedreht 😉 ).
Ich warte noch immer auf Ihre Liste, was Sie streichen wollen.
Ich werde wohl endlos auf ihre Selbstreflektion warten.
Auf die können sie lange warten,
ändern sie erst ihre Methoden,
dann kann´s was werden.
Machen wir doch einen Schritt nach dem anderen.
Zuerst einmal muss man sich einig sein, dass mehr Studen in den Kernfächern auch die Fähigkeiten dort erhöhen und dass eine Verbesserung dieser Fähigkeiten nötig ist.
Wenn wir uns da einig sind, akzeptiere ich Ihre Streichliste. Es wird keine Streichliste geben, mit der alle einverstanden sind. Wenn man die Gesamtstundenzahl nicht erhöhen will, ist sie aber notwendig.
Laut Hattie hat die Erhöhung der Stundenzahl in einem Fach übrigens eine der höchsten Wirksamkeiten.
Immer der gleiche Sermon: Die (Grund)Schule muss halt….Die Frage, wie groß die Spielräume sind und ob sie wirklich kann, stellt sich bei Ihnen gar nicht erst. – Erst gestern habe ich einen ausführlichen Zeit-Online-Bericht über eine Studie gelesen (Jan Skopek, “Skopekurve”). Er wollte die Chancengerechtigkeit von Kinder während der Schulzeit untersuchen und fand heraus, dass zwei Drittel der Unterschiede schon in den Jahren vor der Schule entstehen, bei Eintritt in die Schule “die Messe also weitgehend gelesen” ist. Der Knackpunkt sind v.a. Wortschatz und die Anregung durch die Eltern (Sprache, Denkaufgaben, Bücher….). Die Grundschule schafft es, diese Unterschiede ein Stück weit zu verringern, ab da laufen die entstandenen Unterschiede bis zur Pubertät quasi parallel weiter, um sich dann noch ein Stück weiter aufzuspreizen. Sprich: Der Einfluss des Elternhauses ist immens, die Einflussmöglichkeiten der Schule eher gering. Das wird natürlich zu einem Riesenproblem, wenn der Anteil an sozioökonomisch schwachen Kindern z.B. mit Migrationshintergrund (in Dtl. leider sehr häufig aus bildungsfernen Familien) immer weiter zunimmt. Natürlich kann und muss Schule etwas verändern – und tut es ja auch (s. z.B. Hamburg und BW mit BiSS). Aber zu glauben, dass man das wieder auf den Stand kriegt wir vor 20 Jahren, ist mit den jetzigen Maßnahmen und auch der politischen Einstellung eine Illusion. Dänemark hat eine Kita-Pflicht für Kinder aus sozialen Brennpunkten – und ich bin mir sicher, dass sie damit deutlich erfolgreicher sein werden als das politisch-unverbindliche Gelaber eines Angebots von “Begleitung”, “Elterncafes” usw. in Deutschland!
Ob es die Spielräume gibt, ist eine politische Frage. Die Änderungen in der Stundentafel werden nämlich politisch bestimmt.
Immer nur darauf zu verweisen, dass sich ja nichts ändern darf, führt sicher nicht zu einer Lösung.
Die Bundesländer haben ganz unterschiedliche Anzahlen an Stunden und Stunden für D in der Grundschule. Die Ergebnisse sind trotzdem dieselben! Nur Hamburg ist nicht wesentlich abgesunken. Das, was die aber (neben BiSS, was es ja auch in anderen BL gibt) anders machen, liegt VOR der Schule. Wer die Sprachstandstests nicht besteht, muss verpflichtend mit 5 in die Vorschule! Dazu noch verpflichtende GT-Angebote und verpflichtender Sprach- und Förderunterricht in Schulen für Kinder aus Brennpunkten. Aber doch nicht für alle die Stundentafel – und Kindern, die keine Probleme haben, Sport, Musik und Kunst wegzunehmen, geht gar nicht!
Das mit den verpflichtenden GT-Angeboten etc. bezieht sich nicht auf HH, sondern ist meine Idee, was man in den Schulen tun könnte. Aber das Hauptaugenmerk muss sich endlich auf die Zeit davor richten. Die Gymnasien kriegen nicht mehr das geliefert, was Leute wie Sie fordern. Der Grund dafür liegt darin, dass in den GS nicht mehr so unterrichtet werden kann, dass das möglich ist. Das liegt aber an den 7 Jahren davor! Und da muss man ansetzen, wenn man wirklich etwas ändern will. Ich finde Ihre Sichtweise einfach wesentlich zu eingeschränkt. Sie beharren wie eine kaputte Schallplatte darauf, dass allein die (Grund)Schule das gefälligst richten soll. Ob sie es kann oder wo die wahren Ursachen liegen, kommt in Ihrer Argumentation nicht vor. Auch als ich Studienergebnisse aufgeführt habe, die belegen, dass das Problem v.a. vor der Schulzeit liegen. Ihre Folgerung: Es ist nur politischer Wille und als Lösung muss die Stundentafel der GS geändert werden. Was, wenn das aber nicht die Lösung ist, weil es nicht die Ursache des Problems ist?
Es geht doch nicht darum, dass die Gymnasien irgendetwas nicht geliefert bekommen, sondern darum, dass den Kindern durch schlechte Schulbildung ein Schaden entsteht.
Wie die täglichen zusätzlichen 20 Minuten Lesen gezeigt haben, hat eine höhere Stundenzahl eine große Wirkung auf die Lernleistung der Kinder.
Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, das erfolgreiche Modell nicht auf das Kernfach Mathematik zu übertragen.
Christian Lindner würde an dieser Stelle als marktliberaler Finanzminister massiv Einspruch erheben.
Die deutsche Wirtschaft bezahlt doch bereits so ungeheure Mengen an Steuern, dass dieser Vorschlag nahezu unanständig ist
Die Wirtschaft muss maximal entlastend werden … da kann man diese doch nicht im Gegenzug auffordern, Gelder zur Unterstützung von Bildungsinstitutionen locker zu machen.
Andersherum kann ein Schuh daraus werden, nämlich wenn die Schulen ubd hier natürlich die LuL über die normale Ausbildungszeit hinweg den leistungsprekären Auszubildenden v.a. im Mint-Bereich in den Spätnachmittags- und Abendstunden gratis Förderunterricht und weitere Stützungsmaßnahmen anbieten.
Mehr Bock auf Überstunden!!! – im Sinne der Gewinnmaximierung natürlich unbezahlt!
Damit holen wir Deutschland aus der Krise.
Begreift das doch endlich mal!
Was bei Ihnen noch nach Sarkasmus klingt, ist nüchtern betrachtet die realistischste Zukunftsvariante.
Praktisch alle Ländern mit starken wirtschaftlichen Problemen sparen zuerst bei der öffentlichen Daseinsfürsorge, also Bildung und Gesundheit (nicht aber bei der “Sicherheit”!). Aktuelle Beispiele sind die Türkei, Argentinien, Ukraine (Ukraine ist ein Spezialfall, aber der Effekt auf Bildung und Gesundheit ist derselbe).
In Argentinien z.B. wurden aktuell die Löhne der Lehrkräfte in einem Jahr gedrittelt (über 200 Prozent Inflation, die von Milei einfach nicht durch entsprechende Lohnerhöhungen kompensiert wurde). In der Türkei hat dieser Prozess einige Jahre gedaurt, aber auch hier leben Lehrkräfte aktuell am oder unter dem Existenzminimum.
In Deutschland wird es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm kommen, aber wenn der aktuelle Trend weitergeht, wird man wohl bis 2040 eine reale Einkommenshalbierung für Lehrkräfte erwarten müssen. Bei noch weiter erhöhter Arbeitsbelastung.
Warten wir es erst einmal ab, was da noch kommen wird.
? Das würde ja aber alle Arbeitnehmer*innen Deutschland betreffen. Nicht, dass ich das gutheißen will, aber Sie stellen die Problematik irgendwie verzerrt dar.
Bei der Interpretation von statistischen Daten ist m.M. immer etwas Vorsicht geboten. Die Leistungsunterschiede bei PISA 2022 Mathematik betrugen zwischen den sozioökonomischen Schichten in DE z.B. 111 Pkt. , OECD-Schnitt 93 PKt. In Schweden waren es 99 Pkt, , in Finnland 83 Pkt, in Norwegen nur 81 Pkt. Trotzdem wäre ich vorsichtig daraus zu schließen, dass in Skandinavien “gerechterer” Matheunterricht gemacht wird.
Eine Lösung wäre, die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass Menschen mit hohem sozio-ökonimischem Status mehr Kinder bekommen, und Menschen mit niedrigerem sozio-ökonimischem Status weniger Kinder bekommen.
Wie sollen diese Rahmenbedingungen Ihrer Meinung nach aussehen?
Siehe Frankreich. Je mehr Kinder, desto weniger Steuerlast.
Kein Einkommen, keine Entlastung.
Also Anreiz, bei hohem Einkommen (idR hohe Bildung) viele Kinder zu haben.
Genau das wären die richtigen Anreize. Man könnte den Freibetrag für Kinder deutlich erhöhen (zum Beispiel auf das Niveau von. Erwachsenen) und zugleich das Kindergeld unverändert belassen oder senken.
Kita Gebühren könnten für alle stärker gedeckelt werden. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten.
Bei Beamten gibt es ja den Familienzuschlag, der an dem dritten Kind überproportional steigt. Das ist etwas ähnliches, was bereits heute existiert.
Dafür zahlen wir zum Beispiel 10%Beamtenzuschlag für die Kita. Aber ja das wäre eine Anreiz.
Der Beamtenzuschlag für die Kita wird erhoben um die Befreiung von der Sozialversicherung auszugleichen (Beamte zahlen ja keine Beiträge in die Rentnen- und Arbeitslosenkasse ein). Ist aber ein anderes Thema.
Das ist allerdings dann spezifisch für Ihre Kita? Hier gibts sowas nicht.
Sie wollen also die Armen belasten und die Reichen entlasten.
Danke für ihre Sichtweise.
Ihre Worte zur finanziellen Förderung von Kindern
klingt für mich so, dass sie die Kinder von Familien
mit einem niedrigeren Einkommen weniger förderungswürdig
halten, als jene Kinder aus Familien mit einem höheren Einkommen.
Weniger Transfer-Leistungen an Menschen mit niedrigem sozio-ökonimischem Status.
Geringere Besteuerung von Menschen mit gutem Einkommen aber vielen Kindern (zum Beispiel deutliche Entlastung ab dem dritten Kind).
Kita-Gebühren Einkommensunabhängig.
Usw. Es gibt viele Möglichkeiten entsprechende Anreize zu setzen.
Sie werden ja immer erschreckend deutlicher.
Wo bleibt der gesellschaftliche Kontext,
um den sozialen Status der abgehängten Kinder
zu verbessern.
Sie denken nur an ihr Klientel der besser Verdienenden.
Finanziell schlechter gestellte Familien sollen bewusst
finanziell schlechter gestellt werden.
Erschreckend deutlich @ AvL –
aber passend – danke.( @ DerDip dagegen lasiert- wieder einmal )
dto
* laviert, sorry
Zu “Sie denken nur an ihr Klientel der besser Verdienenden”.
Das stimmt nicht. Mit ging es um die Anreize, Kinder zu bekommen.
Das hat nichts mit der benachteiligung bereits vorhandener Kinder zu tun. Wenn es nach mir geht, sollen die staatlichen Schulen so gut ausgestattet sein, dass jedes Kind eine ordentliche Bildung bekommt.
Aber eines muss klar sein: Der Staat wird NIEMALS in der Lage sein, das Engagement und den Einsatz engagierter gutsituierter Eltern für ihre Kinder auszugleichen. Wer glaubt, das sei möglich, muss betrunken sein.
Und da nun Mal die Problemkinder an den Schulen aus bestimmten sozio-ökonimischen Kreisen kommen, ist es nicht sinnvoll die Anreize so zu setzen, dass weitere Kinder diese jeweiligen Eltern nichts kosten.
Umgekehrt sind die Kosten für weitere Kinder bei gut gestellten Familien oft sehr hoch (Höhe Kita Beiträge plus Oportunitätskosten durch die Reduzierung einen gutbezahlte Arbeitsstellen).
Gedankenexperiment: Angenommen gutsituierte Familien bekommne mehr Kinder und von Transfer-Leistungen abhängige Familien weniger.
Effekt: Weniger Problemfälle an Schulen. Bessere Bildgungsergebnisse. Weniger Sonderförderbedarf nötig. Staat spart Transfer-Leistungen, usw.
“Gedankenexperiment: Angenommen gutsituierte Familien bekommne mehr Kinder und von Transfer-Leistungen abhängige Familien weniger.”
Für Menschenzuchtprogramme á la “Lebensborn” bieten wir hier keine Bühne. Wir veröffentlichen diesen entsetzlichen Post nur deshalb, um zu dokumentieren, mit was für abartigen – faschistoiden – Vorstellungen wir mitunter hier konfrontiert sind.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Das ist wirklich nur noch abartig und eklig !!!
-2 Es bräuchte außer den Bereichen Nachrichten, Tagesthemen……
noch einen Bereich > namens Pranger –
nachlesbar, wenn Sie für die Veröffentlichung nicht eingesperrt werden und auch wichtig: nicht kommentierbar 😉
Das hat bereits seit den Augusteischen Ehegesetzen niemals funktioniert.
Deutschland hat kein Geldproblem, sondern ein Sozialproblem.
Noch mehr Geld in ein kaputtes System zu stecken wird überhaupt nichts bringen.
Eine Besserung wird es erst dann geben, wenn Handlungen Konsequenzen haben:
Ich weiss, dass das Kritik hervorrufen wird, aber irgendwann wird man sich sonst entscheiden müssen: entweder einige wenige leiden oder irgendwann leiden alle, weil das Sozialsystem, so wie es jetzt ist, nicht mehr aufrecht erhalten werden kann.
“Schüler, die aggressiv sind und unentschuldigt fehlen, werden ausgeschult” – Nur aus Interesse: Was machen diese Schüler, ohne Schulbildung, Berufsausbildung oder Perspektive, dann als Erwachsene?
Im Prinzip schaffen Sie ein Reservoir von Menschen mit genau zwei Berufsmöglichkeiten:
a) Hartz IV-Empfänger (das ist die weniger schlimme Variante)
b) Krimineller (besonders falls Sie als flankierende Maßnahme Hartz IV zumindest für diese Menschen abschaffen wollen)
Ist es die Aufgabe der Lehrer die falschen Lebensentscheidungen der Menschen zu überwachen und zu lenken?
Es gibt immer noch so etwas wie Selbstverantwortung.
Die Menschen sind zufrieden mit H4 oder Niedriglohnjobs? Ok, dann ist es so (die Gewährung von Bürgergeld will ich gar nicht erst als Fragestellung aufmachen).
Die Menschen sind nicht damit zufrieden, dann werden sie versuchen einen Abschluss nachzumachen (sicher wird es dann entsprechende Angebote, so wie bereits ja jetzt vorhanden, nutzen).
Die Menschen werden kriminell? Dann sollte ihnen der Rechtsstaat in voller Konsequenz zeigen, dass er das nicht toleriert.
Die Fragen, die mich viel mehr interessieren als sich darum zu kümmern, dass es den Unwillige doch bitte nicht zu ungemütlich gemacht wird, ist doch: wie kann ich die Willigen mehr fördern und verhindern, dass ihr Lebensweg durch die Unwilligen behindert wird?
und
wie kann ich die begrenzte Ressource Lehrer schonen und entlasten, so, dass diese noch lange durchhalten und wie kann ich das Arbeitsumfeld so angenehm gestalten, dass dieses Berufsbild wieder Interessenten anzieht?
und
wie kann ich Bildungsbürger schaffen, dass sie einen Nutzen für die Gesellschaft haben, sprich, wie kann diese Industrienation bestehen und den wachsenden Ansprüchen gerecht werden?
Dann hat man genau ein Land der dritten Welt. So ist es beispielsweise in Kolumbien. Die staatlichen Schulen können jeden Schüler, der sich schlecht benimmt, der Schule verweisen. Viele werden kriminell. Der Rest schützt sich mit bewachten Wohnanlagen. Ist das das Deutschland, was gewollt wird?
Die beiden Länder kann man so nicht vergleichen. Kolumbianische Verhältnisse entstehen nicht durch Schüler, die sich schlecht benehmen, sondern durch Drogenkartelle, Guerillas und Paramiitärs, die mehr Macht als die Regierung haben.
Vielleicht ist Kolumbien dahin gekommen, weil es das dort vorher nicht gab? Kolumbien hat jawohl schon etwas länger Probleme.
Gegenfrage: was hat sich in Deutschland verbessert, je mehr man sich von meinen Vorschlägen entfernte? Das Gegenteil ist doch wohl eher der Fall.
Die Folgefrage ist also, wie lange wird es noch dauern bis Deutschland zu Kolumbien gemacht wird? Vielleicht muss das Koks dann auch nicht mehr extra importiert werden (wäre besser für die Ökobilanz)?
Es macht einfach Spaß kreative Rechenmöglichkeiten zu verwirklichen,
immer wieder etwas Neues, was da an Ergebnissen eigeninnovativ da
so entwickelt wird.
Die Wirtschaft wird sich im Besonderen an derartig wertschöpfende
Ergebnisse bei Schulabgängern erfreuen, mit denen sie ja auf
Grund der zeitlichen Distanz niemals in Verbindung gebracht
werden können, da nachfolgende Schulformen verantwortlich für
die Ergebnisse eines Schulabschlusses immer schon sind.
Mir ist nicht ganz klar, ob die dramatischen Einrüche aus den PISA-Ergebnissen abgelesen wurden (das ist ja bekannt) oder auf eigener Forschung/Analyse der PISA-Daten basieren.
Die Einbrüche wurden den PISA-Ergebnissen entnommen, die Ursachenforschung um eigene Analyse der PISA-Daten ergänzt. Herzliche Grüße Die Redaktion
Danke!
Oh mein Gott, wer konnte denn damit schon rechnen?
Schön gerechnet wird es trotzdem …
Es können eben immer weniger rechnen, deshalb hat keiner damit gerechnet. Da beißt sich die Katze in den Schwanz! 🙂
Und manche Katze kotzt, da sie sich schon zu lange in den Schwanz beißt.
Kausale Zusammenhänge im anspruchsvollen MINT-Bereich! Wer wundert sich denn überhaupt noch über den IST-Zustand schulischer und beruflicher Bildung in Deutschland.
Was wird seit Jahrzehnten bestellt?
Niveau-Limbo von der Grundschule bis zum Gymnasium bei Einser-Inflation und schulischem Komfortzonen-Wohlfühlambiente möglichst ohne Anstrengung und Wettbewerb sind Kompetenzen zu erwerben, die immer weniger von fachlichem Wissen und praktischem Können abhängig sein sollen. Finde den Fehler.
Und wieder Würgereiz bei sinnfreien Aufgaben mit geringstem fachlichen Anspruch. Mir fehlt der unerschütterliche Glaube ans Gelingen.
„Wenn man heute im Chemieabitur mehrere Aufgabenteile ganz ohne das Aufstellen einer einzigen Reaktionsgleichung absolvieren kann, dafür aber seitenlanges Material einfach nur wiedergeben muss, dann ist das mehr als bedenklich.“
Kann ja kaum mehr einer rechnen – Also keiner.
Man erinnere sich an Jens Spahn: “Bereits jeder Vierte ist bereits geimpft. Bald wird es jeder Fünfte sein.” !!!
Dieses Zitat ist falsch. Hier ist das richtige: “Mittlerweile ist jeder fünfte Deutsche geimpft, Anfang Mai wird es jeder vierte sein, in wenigen Wochen jeder dritte.” Quelle: https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/rede-des-bundesministers-fuer-gesundheit-jens-spahn–1895324
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Danke! Dann hatten wir im Kollegium wohl umsonst gelacht…
Ich dachte Lehrkräfte sollten eigentlich SuS u.a. Medienkompetenz beibringen? Gehört dazu nicht auch, wie man es vermeidet auf FakeNews reinzufallen?
Sind keine Fake News gewesen. Spahn hat das am 26.04.21 in einem Interview mit dem Welt-Nachrichtensender gesagt. Da hat er den Inhalt der Rede vom 21.4.21 wohl im Kopf gehabt, aber die Zahlen dann verdreht.
Alles klar. Wenn nur darüber gelacht wurde, dass er sich im Interview versprochen hat, ist aus meiner Sicht alles im Lot.
Ne, weil Lachen ist gesund.
Laut Faktencheck von Mimikama ist der Satz von Spahn (jeder vierte, dann jeder fünfte) echt. Er soll das in einem Interview mit Tatjana Ohm am 26.04.21 (Welt-Nachrichtensender) gesagt haben.
https://www.mimikama.org/spahn-jeder-4-geimpft/
Vielen Dank!!! ich hatte schon an meinem Verstand gezweifelt…GlG
EInfache Lösung: Erhöhung der Stundenzahl in den Kernfächern Deutsch und Mathematik schon in der Grundschule.
Jüngst wurde ja erst gezeigt, dass mehr Zeit zum Lesenüben auch bessere Ergebnisse im Lesen mit sich bringt. In anderen Fächern wird das nicht anders sein.
Dann muss man halt in anderen Fächern, die nicht so wichtig sind, die Stundenzahl kürzen.
Berlin geht einen besseren Weg – Religion soll wieder Pflichtfach werden! 🙂
Dieser Beitrag ist aus ihrem Munde eindeutig ironisch gemeint.
Bei einem Beitrag zur Förderung von angewandten Musikunterricht
im gemeinsamen musizieren wären sie nicht ironisch gewesen.
Natürlich! Religion und Verbesserung der Schülerleistungen in den MINT-Fächern? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber ich bin ja auch nicht religiös.
Aber man muss schon GLAUBEN, was der Lehrer sagt…
Also doch?
Mir fällt gerade ein: es ist ja bald Pfingsten, kommt da nicht der Heilige Geist auf die Erde? Vielleicht erleuchtet er ja endlich einmal die Menschen MINT-mäßig oder so? Oder er erleuchtet wenigstens unsere KuMis? 🙂
Der Heilige Geist macht zu Pfingsten alle Fremdsprachen überflüssig. Daher auch die Pfingstferien. 🙂
Vielleicht stärkt Religion bei den SuS den unerschütterlichen Glauben ans Gelingen. Dann sind diese auch bald zu lobpreisen, wie die hochdotierten Lehrkörper mit Glaubens- und Gelingens-Botschaft. Der Religionslehrer überbringt die frohen Lobpreisungen und den unerschütterlichen Glauben.
Easy Peasy!
Nun gilt es nur noch die Botschaft der “Ungläubigen” zum Verstummen zu bringen. Die wollen doch nur kontraproduktiv Hader und Zwietracht säen.
Dieser Spruch ist jetzt der absolute running Gag. Ist aber auch zu verlockend.
Beten die dann um bessere Mathe- und Deutschergebnisse?
🙂 Das kostet wenigstens kein Geld!
Für solche Vorschläge wurde Bayern hier aber erst kürzlich ziemlich verrissen. Wobei in Bayern aber eh schon deutlich mehr Unterrichtstunden unterrichtet werden als in den meisten anderen Bundesländern.
Wer einen Sumpf trocken legen will, darf nicht die Frösche fragen.
Natürlich ist bei jedem Fach, bei dem die Stunden gekürzt werden sollen oder das komplett abgeschafft werden soll, mit Widerstand zu rechnen. Es würde ja auch nicht für die Motivation der unterrichtenden Lehrkräfte sprechen, wenn sie sich darüber freuen würden.
Und wer legt fest, was “nicht so wichtig” ist? Wenn es an den “anderen Fächern” liegen würde, hätten wir die Probleme schon seit Jahrzehnten.
Ich finde, dass hier in dieser Analyse endlich einmal klar gesagt wird, wo die Probleme liegen und was nötig ist.
Was ich nicht verstehe, ist Ihre sehr verkürzte Sichtweise, welche ja einfach alle sozialen, bildungspolitsichen ind finanziellen Fragen einfach mal als unwichtig abtut. Zudem würde ich gerne wissen, was Ihr Kunstkollege oder Ihre Chemiekollegin (ja genau, die von Ihrer Schule) dazu sagen.
Aber wir haben doch immer mehr 1er Abis! Da muss irgendwo ein Irrtum vorliegen! Nur wo?
Es gibt m.W. Bundesländer wo man kein Matheabi schreiben muss.
Früher bedeutete Abitur noch Allgemeine Hochschulreife. Lang, lang ist´s her!
Musste ich auch nicht. In den Achtzigern waren die Examensfächer sehr frei wählbar. Dennoch waren wir studierfähig. Seltsam…..nicht?
Oder es ist “die Schere” ?
Die auch!
Achwas?! Das hätte ich nicht gedacht. Da hilft jetzt nur mehr Kompetenzorientierung, mehr Medieneinsatz und mehr selbentdeckendes Lernen in MINT-Fächern ab Klasse 1. Mit alten Methoden oder gar dem Üben von Grundlagen kommen wir da nicht weiter. Erst wenn jede Mathe- oder Physikaufgabe zwei A4-Seiten umfasst und ihre Lösung einzeilig ist, sind wir auf dem richtigen Weg.
Vielleicht mal wieder mehr Mathe und weniger Textverständnis.
Könnte ja sein, dass damit zusammenhängt, dass sich die Schüler durch Seitenlange Aufgabenstellungen quälen müssen um nachher 7+3 zu rechnen.
Das wäre noch schlimmer, weil dann zwangsläufig die Aufgaben an sich schwieriger werden müssen. Für die Lehrer anderer Fächer wäre das auch doof, weil dort dann die Textaufgaben im Kontext des Faches gerechnet werden müssten.
Die “anderen Lehrer” können auch rechnen und denken.
Zumindest die, die Mathe im eigenen Abi nicht abgewählt haben. 🙂
Denken ja, rechnen na ja
Ich bin mit meinem GK in der Q1 mit Analysis durch und habe jetzt mit den SuS mal eine mündliche Prüfung simuliert und 2 alte Abi-Analysisaufgsben gerechnet. Ergebnis? Die SuS fanden das, was im Abi zu rechnen war, einfacher als meine Klausuren, hätten aber fast alle schlechtere Noten gehabt, weil sie z.T. nicht verstanden haben, was genau die von ihnen wollten bzw. sich nicht sicher waren, wo man rechnen musste und wie viel man mit dem GTR rechnen durfte und wo man völlig offensichtliche Dinge (z.B. einen Hochpunkt oder Randwerte) einfach aus der gegebenen Grafik ablesen durfte. Also: statt sinnvoll Mathe zu machen, noch einmal die tollen Operatoren durchgehen und Texte lesen und vor allem genau Texte lesen…
Mathematisch im GK: zusammengesetzte Funktionen nur in der absolut einfachsten Form, Stammfunktion nicht selber bestimmen, sondern ein Integral einfach vom GTR ausrechnen lassen, Nullstelle ist sofort aus dem Term ablesbar – jeder mittelmäßige Schüler ist damit überhaupt nicht mehr gefordert. Mein bester Schüler war total verunsichert, weil er dachte, so einfach könne das nicht sein…
So sieht das leider aus. Und auch bei mir kommen mittlerweile die Fragen: Ist das wirklich so einfach? Schüler suchen dann den Haken in den Aufgaben. Ist schon komisch.
Ja, die Verunsicherung, dass das so leicht nicht sein kann, führt dazu, dass plötzlich entweder zu viel gerechnet wird (bzw. überhaupt gerechnet wird, z.B. beim Operator “ermitteln”: einfach Funktion einspeisen und den Befehl polyroots nutzen – oder (wieder GTR-Absurdistan) bei zusammengesetzten Funktionen nsolve(f(x)=0) eintippen, denn da funktioniert der Befehl polyroots ja nicht – aber Vorsicht, dieser andere Befehl gibt ja nur einen Nullstelle aus, also danach noch einmal nsolve(f(x)=0,x, irgendein Wert, der ein bisschen größer als die gefundene Nullstelle ist und dann gleich noch einmal, vielleicht gibt es ja eine dritte Nullstelle…oder einfach im GTR den Graphen anzeigen lassen und die Nullstellen ablesen…reicht es dann einfach zu schreiben, GTR liefert, oder muss ein längerer Text dazu, wie der GTR die Nullstellen liefert. Wie weit muss ich an die Ränder scrollen bzw. muss ich noch begründen, warum ich nach 2 Nullstellen nicjt noch mehr gesucht habe? Ja nu, bei “geben Sie an” und bei “ermitteln” nicht, bei “bestimmen” muss zumindest der Ansatz f(x)=0 und “GTR liefert” dastehen – aber nicht der genaue GTR-Befehl, bei “bestimmen sie rechnerisch” reicht dann schon das ablesen nicht mehr für die volle Punktzahl und bei “berechnen” muss gleich ein Rechenweg aufgeschrieben werden und obwohl der GTR das eben auf Knopfdruck kann, muss man eben selber rechnen….ja im Aufgabenteil vorher nicht, da stand ja “bestimmen Sie” also da GTR nutzen und – ich denke, jeder kann sich in etwa die Stznde vorstellen, in der genau gar nichts für Mathe gelernt wurde).
Ein Tipp ist auch immer, zu schauen, ob es viele Punkte für eine Aufgabr gibt..achja und wenn das mit dem GTR geklärt ist, muss man noch Schreibweisen trainieren, die im eigenen Unterricht und auch im Buch nicht vorkommen, die könnten aber im Abi kommen, weil andere Bundes der das anders machen und es ja nicht Bundesland-spezifische Aufgaben gibt…
Hat mit mathematischen Fähigkeiten halt genau nichts zu tun und ja, in der Zeit hätte ich locker mit dem Kurs eine der gestrichenen Regeln (z.B. Quotientelregel beim Ableiten oder partielle Integration oder Substitution beim integrieren) einführen und einüben können…aber das ist ja nicht gefordert, Hauptsache die Eingabe in den GTR stimmt. Der kann zum Studium dann übrigens entsorgt werden, da darf er selbstverständlich nicht mehr genutzt werden!
„Ein Tipp ist auch immer, zu schauen, ob es viele Punkte für eine Aufgabr gibt..“
Oh, gefährlich, das musste in der letzten Mathearbeit eine Schülerin bitter erfahren. Durch etwas nachlässiges kopieren der Arbeit, verschwand die 4 hinter der 1 und auch 14 Punkten für 8 Aufgaben der schriftlichen Multiplikation wurde 1 Punkt. Daher hat sie die Aufgaben erst gar nicht bearbeitet und widmete sich liebevoll nur den anderen Aufgaben. 10 Minuten vor Ende habe ich mal über ihr Blatt geschaut und sie gefragt, warum sie die Aufgaben nicht bearbeitet hat. Sie antwortete, dass sie sich für einen lächerlichen Punkt nicht die Mühe machen würde. Als sie erfuhr, dass es aber 14 Punkte geben würde, war es schon fast zu spät…. (:
Touche’… das Leben ist zuweilen so ein mieser Verräter. 😉
Ist nicht nur in Mathematik so.
Wirklich gute SuS muss ich in E immer wieder erinnern: Nicht zu viel nachdenken, nicht eigene Textformate entwickeln, an EWH denken.
Ich versuche, durch freiwillige Projekte diesen SuS dann wenigstens im Unterricht Entwicklungsraum zu verschaffen.
Die Kompetenzorientierung auf Teufel komm’ raus ist das Problem.
Aber das wird nicht angegangen. Dieser tote Gaul wird weiter geritten und geschunden.
Sinnfrei.
Der heutige Zustand ist das Ergebnis jahrelanger Bemühungen. IQB lässt grüßen – für das Abitur. Beim Rest sieht es nicht besser aus.
1/2 + 2/3 = 3/5.
Ist halt mal so. Selbst in der Oberstufe. Da nutzt auch ein Kuchen-, Torten- oder Pizzamodell nichts.
sin(x) = 1/2 | : sin
x = 1/2
Ist halt mal so. Diese Woche erst erlebt bzw. überlebt.
Aber für so eine Art “Komptenzorientierung” gibt es halt überhaupt keinen Punkt mehr.
Ist es 1 und 1/3 Kuchen? Habe nicht gegoogelt. Realschule, 90er, Note befriedigend…
🙂
Alles auf einen Nenner bringen und addieren ergibt 7/6.
Nee, K*cke, da kommt irgendwas Krummes raus..
1 und 1/8 und ein… Happs! Jetzt hab ich’s!
Kann man aber schlecht malen. Ich hatte jetzt auch keine Lust, den Kuchen in 24 Stücke zu teilen,was wäre das ne Schmiererei!
Denken Sie sich doch sauberere Aufgaben aus.
Sonst würde ich sagen : 1 und 1/8 und 2/24.
Klar ist, nach 25 Jahren ohne Mathebedarf wüsste ich nicht einmal mehr, was man da üblicherweise als Rechenweg benutzt – also ohne Kuchen und Google.
Oder also auch 1 und 1/8 und 1/12…..
=1,35?
Ich würde ja keinen mit sowas nerven, aber Lehrer lieben das 🙂
1,35 kann nicht sein….
Oh nein! Jetzt kommt irgendwas mit :”Wenn 24 Hundert Prozent sind, was sind dann…”
Ey, das ist doch einfach! Da kommt sin(0,5)raus
Was ist denn sin?
Sin City = Las Vegas
(Medienkompetenz: Sehr gut!)
@Indra Rupp
Sinus.
https://www.youtube.com/watch?v=3lpcFY-FNec
Also ein ganzer Kuchen – ist klar, und dann noch 5 von 24 Kuchenstücken. Bei 1,3 als Ergebnis hätten es 8 Stücke sein müssen. Lehrer machen ja so gerne krumme Sachen…
Ich brauch noch nen Moment! Mir kribbelts unter den Nägeln, meinen 11Klässler-Sohn zu fragen… Hmmm…
1,33 = 8 Stücke
Ja, ja, Erbsenzähler!
Also, bei 24 nehmen wir mal 240 und teilen das durch 5…= 48
Und jetzt?
24 durch 5 sind also 4,8.
Und wie geht es jetzt weiter?
100 durch 4,8?
Das Endergebnis wird also irgendwas mit 1,2.. sein.
@Der Zauberlehrling
Das war jetzt aber viel zu viel Kuchen für mich alleine!
*bäuerchen*
Kriege ich jetzt noch ein 1er-Abi zu meinem Boomer-Abi dazu? 😉
Schüler in der Pizzeria:
Pizzamann fragt:
“Soll ich die Pizza in 4 oder in 8 Teile schneiden?”
Schüler antwortet:
“In 4 bitte, 8 schaffe ich nicht!”
Mathelehrer kommt erbost in die Klasse:
“So geht das nicht weiter …. 70% von euch haben eine 5 geschrieben!”
Ruf aus der letzten Reihe:
“Quatsch, so viele sind wir gar nicht!”
Reicht schon, oder?
@Hysterican
🙂
Und wenn mir …
“Matte zu schwäa wirt, dann ge isch Milschbaa.
Weil da kannisch kraas tschiln und discotieren, weil in so Schprasche binisch vollgut also meisten so fier odda so.”
Nö, das war jetzt kein Witz und Ironie muss auch niemand suchen; “gibts nich wegen isnich”. Das war im Bezug auf … aktiv gelebte … Kompetenznachweise im Bereich “Sprache: Schreiben und Sprechen” lediglich anekdotische Evidenz im Dauermodus. 🙁
Beim Wunschkonzert in Gedanken singen die Beatles “Help”, ebenfalls im Dauermodus.
https://de.wikipedia.org/wiki/Help!_(Lied)
Einfach lachen, den SuS Recht geben (ich weiß, ich weiß, aber sehen Sie es als Kundengespräch), gute SuS fördern.
Ich rechne jetzt mal 1000 durch 48,weil das schöner ist und komme auf 20 (da ist die 2),übrig bleiben 40,die man nicht durch 48 teilen kann…
Also doch keine 2?
19 mal 48 = macht keinen Sinn!
Also 40 durch 4,8 = da nehme ich 400 durch 48 = 8,da bleiben 16 übrig und wir befinden uns beim Ergebnis 1,28. Dann rechne ich 160 durch 48 und komme auf 3,da bleiben schon wieder 16, also wird das ab jetzt endlos und das Ergebnis lautet:
1/2 Kuchen plus 2/3 Kuchen = 1,283333… Kuchen = Keiner kann so genau essen und es wird automatisch ungerecht beim verteilen, vor allem, wenn noch Krümel daneben fallen! An so etwas denken Theoretiker ja nicht!
Der Lehrer ist schuld!
Und ich mag Mathe auch nicht. So!
Das hat übrigens gefühlt ne Stunde gedauert und nun streiten alle um den Kuchen. Nicht sehr kompetent für Pädagogen!
Pädagogen sollen doch immer kompetenz(t)orientiert unterrichten. Also ist doch alles okay 🙂
Wir streiten nicht … wir fachsimpeln am Problem entlang – oder vorbei …. 😉
Das ist kein Mathe, sondern Rechnen. Mathe und rechnen ist ungefähr wie Möbeltischlerei und schleifen. Arschlangweilig, aber man braucht es halt immer.
“Da nutzt auch ein Kuchen-, Torten- oder Pizzamodell nichts.”
Ich dachte, die Schule soll vermehrt “Alltagskompetenzen” vermitteln? Wurde doch vor kurzem noch von allen (Medien, Politik, Bildungs”experten”) gefordert!
Solange die Schüler also noch ihre Pizza mit einer leicht zu bedienenden App bestellen können, ist doch alle gut…
Und jetzt geh ich so zu meinem Sohn, der fläzt faul auf’m Sofa rum, und frag ihn, ob das richtig ist und der antwortet ohne mit der Wimper zu zucken :”1,16. Weil, 1/2 ist 50 % und 2/3 ist 66,666… %, macht 116,666%! Also 1,16 Kuchen!”
Und dann guckt der auf den Taschenrechner und hat auch noch Recht!
Die Jugend von heute macht es sich echt einfach!
🙁
Ich mach nicht mehr mit!
… und erklärt mir, was das Problem ist: Abgesehen davon, dass mein Ergebnis 1,20833.. wäre , nicht 1,2833..und das meine Gedankengänge extrem ” Indirisch” kompliziert sind : Ich kann den Kuchen bei so einem krummen Ergebnis nicht in 24 Teile teilen um heraus zu bekommen, wieviel davon ein Drittel ist, denn ich läge immer etwas daneben.
(Er erklärt übrigens voll gerne und wird evtl Lehrer…)
Hat Ihr Sohn jetzt etwa wunderschöne Brüche in hässliche Prozentzahlen umgewandelt?
Wir Mathelehrer lieben doch Brüche so sehr…und so gibt es noch einen bösen Rundungsfegler am Ende 2/3 sind doch 66,Periode 6 Prozent…
Möglichkeit a) (Standardmethode): gleichbamig machen:
1/2 = 3/6
2/3 = 4/6
3/6 + 4/6 = 7/6 also 1 ganzer und 1/6 Kuchen
Und siehe da: man könnte den (theoretisch) sogar total gerecht verteilen (Idee vom Erweitern): das halbe Stück dritteln und die Drittelstücke halbieren. (Natürlich muss der ganze “Grundkuchen” immer gleich groß sein und die Stückemüssen gleich groß sein, sonst:
https://pbs.twimg.com/media/F5cHiArWYAA9vUz.png
(Erinnert mich jetzt orgendwie an die Stunde bei gefühlt 30 Grad draußen, also locker 40 Grad im Raum, in der eine Referendarin die Kinder mit Schogetten gerechtes Teilen üben lassen wollte…)
Und jetzt – ich übernehme keine Haftung für entstehende Schäden – voila: die zweite Methode (darum antworte ich überhaupt), präsentiert von DorFuchs:
https://youtu.be/WS4esRS09iA?si=cQi5WBDrDiCUmSfX
Nee, der hat nur auf mein 1,2833..reagiert und von Periode 6 sprach er auch.
Ja, das mit 3/6 und 4/6 ist ja logisch einfach.
Ich würde sagen, Mathelehrer sind unkomplizierte Typen und nicht so emotional zerstreut, wie ich.
Er wird wohl auch, wenn dann, Mathe/Physiklehrer, hat er auch als P1 und 2 gewählt. Freut die Lehrer dort, die meisten Schüler haben es ja mehr mit Englisch.
Ja, das Problem in Mathe ist, dass Sie für Ihren ehrlich gesagt sehr komplizierten und auch falschen Lösungsweg ganz doll irgendwelche Kompetenzen erreicht hätten und am Ende wahrscheinlich mehr Pubkte bekommen als Ihr Sohn, wenn er im Ergebnis gerundet hätte, obwohl er offensichtlich sofort die richtige Lösung gehabt hatte…und das versteht irgendwann niemand mehr. Ich hab mir gerade mal meine Abi-Co-Korrekturen angeschaut, da sind wieder Bezeichnungen und Aufgabenstellungen aus der Hälle dabei, mehr darf ich hier wahrscheinlich nicht schreiben…
Aber jetzt mal ehrlich, nur auf Kuchen bezogen:
Wenn ich einen Kuchen in 24 Stücke teile, dann sind 8 Stücke ein Drittel. Ein halber Kuchen und zwei Drittel Kuchen wären also 1 Kuchen und 4 vierundzwanzigstel Stücke. Ich hatte mich vertan und 5/24 Stücke geschrieben, ansonsten ist das richtig.
Kann man vielleicht eher in Musik als in Mathe gebrauchen, die Kuchenrechnung.
Ja, Ihre 4/24 sind eben gekürzt mit 4 1/6 . Also 1 1/6 Kuchen.
In Musik kann ich meine Schüler immer gut verwirren, denn da gilt ja 3/4-Takt ist nicht gleich 6/8-Takt…aber gut…ganz andere Geschichte…
Zu den Aufgabenstellungen: im Zentralabi habe ich jetzt getade (ungelogen) gesehen: “Hier ist ein Gleichungssystem, denken Sie sich eine passende Aufgabe dazu aus”.
Einer meiner Schüler ist in der Stadtrunde der Matheolympiade “nur” den zweiten Platz belegt (bei gleicher Pubktzahl wie die Siegerin), weil er seine Lösungen nicht so schön aufgeschrieben hatte. Er war 30 Minuten früher fertig.
Aber in einem haben Sie natürlich Recht: (noch) gibt eine richtige Lösung ohne viel Geblubber mehr Punkte als viel Geblubber ohne richtige Lösung…wie gesagt, noch….gefühlt gleicht sich das an
Vielleicht wird die Problematik bei der Kompetenzorientierung aber auch überbewertet?
Ich hatte eine 3 auf der Real, er hat ca 12 Punkte in der Oberstufe, das passt dann doch im Verhältnis. Und Klassenkameraden, die, wie er sagt, so rechnen wie ich, wählen nächstes Jahr Mathe ab und sind da entsprechend nicht so gut. Mir kommen die Bewertungen schon realistisch vor.
Mein Sohn ist wiederum nicht so dolle in Englisch, hat aber ein viel höheres Allgemeinwissen als seine Mitschüler und ist Top in Geschichte. Er kann also in einem Englisch-Referat immer etwas rausholen damit und vielleicht die Note etwas verbessern,aber doch nicht so, dass nicht am Ende klar ist, dass er schwach in Englisch ist…
Und noch etwas:
Ich habe nach 25 Jahren also die notwendigen Formeln zum ausrechnen vergessen und das aus eigener Logik versucht, was dann verkrampft, kompliziert und unnötig aufwendig war, denn die Formel zum ausrechnen ist eigentlich simpel, wenn man sie kennt. Allerdings weiß ich dafür auch, was ich warum gerechnet habe und verstehe meine eigene Rechnung. Wenn ich jetzt noch die übliche Formel dazu nehme, würde ich sagen, dass ich durch meine eigene Rechnung die Formel be”greife” . Ich frage mich, ob das auch der Fall wäre, wenn ich von vornherein vom Lehrer die Rechenformel bekomme und diese dann einfach nur auswendig lerne und anwende. Ist dann doch ein bisschen, wie den Taschenrechner zu benutzen. Man muss halt nur wissen, was man eintippen muss.
Wahrheiten liegen oft in der Mitte. So ganz abwägig ist das mit den Kompetenzen nicht. Wann habe ich denn mehr Kompetenzen? Wenn ich ohne Input den Rechenweg finden muss, auf dem Weg nochmal an Prozentrechnung und Brüchen vorbei muss, entsprechend mich mit mehreren Bereichen auskennen muss – oder wenn ich auswendig lerne, dass 1/2 =3 /6 ist und 2/3 = 4/6 und das dann 7/6 macht… Das hat was vom typischen einfüllen und abspulen und kurz danach wieder vergessen, wenn man es sonst nicht braucht.
Wie gesagt, Wahrheiten liegen oft in der Mitte. Es sollte wohl der richtige Rechenweg und das richtige Ergebnis eine Rolle spielen, aber auch, wenn man etwas zB richtig verstanden, nur falsch ausgerechnet hat oder wenn man sich eben auf eigenem Weg zu helfen weiß, auch wenn das nicht der übliche Weg ist.
Ein Ausbildungsbetrieb, zB, fragt bei der Bewerbung :” Diese Tischfläche, an der wir sitzen, ist 1m breit und 2m lang, wie groß ist die Fläche?” – und die Bewerber wissen es nicht und kommen mit den Bezeichnungen durcheinander. Die haben das damals in der Schule eben nur auswendig gelernt und nun wieder vergessen. Der Praktiker hingegen, muss das be” greifen” und braucht dafür auch keine Rechenaufgaben. Vielleicht hat er vergessen, wie man Quadratmeter abkürzt – nur ein Beispiel. Der hat mehr Kompetenzen als ein auswendig lernender Schüler! In dem Punkt stimme ich ja mit Waldorf überein, die u a zum Feld ausmessen losstiefeln. Am besten eine Mischung aus Theorie und Praxis, damit man es wirklich verstanden hat, sich diesbezüglich aber auch mitteilen kann.
Aus unterschiedlichen Gründen, die keineswegs alle auf das Konto nicht leistungsbereiter Jugendlicher gehen, befinden sich Konzentrationsfähigkeit und schulische Anstrengungsbereitschaft im freien Fall. Diese Paste quetscht keiner mehr in die Tube zurück.
Richtig.
Für die gemeine Bildungsproduktionsdrohne stellt sich daher ganz pragmatisch die Frage nach dem ressourcenschonenden Umgang mit diesem Fakt.
Alles andere ist (fast) egal.
“Der Besitz eines eigenen Computers hat zumindest in Mathematik einen positiven Einfluss auf die Kompetenzen.”
Allein der Besitz eines Computers … Wie groß muss dann die Wirkung sein, wenn man ihn auch noch nutzt.
Aber Daddeln ist doof und macht dumm. Super.
Kommt immer darauf an, wie man den Computer nutzt. Die Nachbarsbuben haben Unsummen ausgegeben, damit die Spiele flott laufen. Habe ich damals auch, nur halt für viel weniger Pixel. Nebenbai habe ich programmiert (am Computer C128 und dann am 386’er von Vobis). In der Schule haben wir damals “auf dem Papier” programmiert. Die Computer standen da und wurden nur manchmal eingesetzt. Hat sich viel geändert? Ja. Kohl ist nicht mehr Kanzler. Aber dafür sein Enkel im CDU-Vorstand. Ich bin Lehrer.
“Der Median der Antworten der Unternehmen in dieser Skala liegt mit 96 besonders hoch bei der Forderung nach mehr Investitionen des Staates in das Bildungssystem.!
Sind doch gerade 5 Mrd. Euro verbraten worden.
“Besitz eines Computers” ist doch Quatsch. Wann haben diese “Experten” zuletzt einmal mit Jugendlichen gesprochen. Die haben ein Smartphone, eine Playstation (ok, auch ein “Computer”) und vielleicht ein Tablet (für die Schule).
Aber doch keinen klassischen “Computer” mehr…
Ahh, die Zocker schon. Die bauen den sogar selber. Und man muss immer noch etwas basteln um die Leistung zu optimieren, da lernt man schon was.
Und ehrlich – so hat das bei mir ja auch angefangen.
Aber das der “Besitz” eines Computers schon einen Einfluss auf die Kompetenzen hat, war echt ein Brüller.
Das ist ungefähr so, als würde behauptet werden, der Besitz eines Smartphones erhöhe die Medienkompetenz.
Und ich sehe das anders mit dem “Selberbauen und dabei was lernen”. Inzwischen ist der Komponentenmarkt viel zu genormt. Wir hatten damals ISA, PCI und AGP. Heutzutage nur noch PCIe. Der “ich habe vom PC mehr Ahnung als der Rest”-Schüler weiß nicht, was ein Bus ist oder wo der Unterschied zwischen DDR 4 und 5 liegt. Ebenfalls hat er keine Ahnung, warum ARM-Prozessoren z.B. nicht RAM-Aufrüstbar sind und warum eine RTX 4080TI besser als eine 4070TI ist. Durch die Normung hat sich die Bandbreite der Komponenten arg gestreamlined, technisch ist es aber anspruchsvoller geworden. Und nur um CS:GO in FHD mit 400FPS statt mit 390FPS zu zocken und dann deshalb Geld auf das Problem der “langsamen” Hardare zu werfen, zeigt genau den Zeitgeist des Konsumisten.
Ich vermute, du kannst sus dem FF eine Mathematische Funktion in ein Programm übersetzen. Das konntest du vermutlich auch in deinen jüngeren 10er-Jahren bereits. Ich übrigens auch. Heutige Schüler aber nicht (einzelne Ausnahmen mal abgesehen).
Beim Aufbau beschäftigen die sich schon mit der Technik und viele Dinge (wie die unterschiedlichen Bussysteme oder das Jumpern von IDE-Festplatten) haben sich zum Glück erledigt. Klar braucht man nicht mehr so viel Hintergrundwissen wie damals, aber besser als nichts. Und wenn man möglichst preisgünstig bauen will (was bei einem Großteil der Schüler bei uns zutrifft), dann muss man auch schon mal etwas tiefer gehen.
Zum Zweiten: Ich zwinge die 10er gerade wirklich die Perzeptron Regel (Lernalgorithmus bei neuronalen Netzen) in ein Python Programm zu überführen. Damit können sie nachvollziehen, wie eine KI lernt. Es interessiert die Schüler sogar, ist aber ein Aufgabe für mich, denen das nahe zu bringen.
Der Besitz eines Computers ist ein Indikator für das Einkommen der Eltern.
Der Besitz einer Lampe begünstigt übrigens die Fähigkeit zum Hellseher.
… und wer nen Schnürsenkel aufbekommt kann als “Neuer Houdini” auftreten.
Ich bemühe mich immer darum, die Wahrheit zu sagen – kann ich jetzt bei den Ehrlich-Brothers einsteigen – zumal deren Cousine -ohne Scheiß- eine Kollegin in unserer Anstalt ist?
Die Wirtschaft muss für Schüler und Studenten verständliche Mathe-, Physik- und Informatikbücher schreiben. Die Schulbuchverlage werden dies nie schaffen.
Die DDR-Schulbuchverlage hatten das voll drauf. Egal ob Lehrbücher für Geographie, Biologie, Chemie, Physik, Mathematik oder die gut strukturierten Lehrbücher in den Fremdsprachen – die SuS mit Motivation und Anspruch an die eigene Leistung arbeiteten gern und zielführend mit diesen Lehrbüchern. Die fachlichen Inhalte standen im Vordergrund.
Ich habe für den Unterricht in meinen MINT-Fächern die Lehrbücher der polytechnischen Oberschule* aufbewahrt und wundere mich, was man uns an fachlichen Inhalten damals zugetraut hat. Viele Gymnasiasten heute würden dieses Pensum und fachliche Niveau als unzumutbare Überforderung und nicht zu bewältigenden Kraftakt empfinden.
Helmut Lindner ist da ein Begriff, der positiv aufzufallen scheint.
Ach guck … ganz anders als der Christian gleichen Nachnamens. 🙂
Das ist aber fies, solch alten Kram aufzubewahren und dann noch mit dem neuen tollen Material zu vergleichen. Das sehen manche hier gar nicht gern, weil nämlich nicht sein kann, was nicht sein darf! 🙂
Ich weiß, dass manche dies hier gar nicht gern sehen.
Das tangiert mich aber nur peripher.
Auf den “Witz”, warum in der DDR 12 Jahre bis zum Abitur ausreichten und was im 13. Jahr im Westen an “Kompetenzen” noch vermittelt wurde, verzichte ich hier.
Sie, liebe Potschemutschka kennen diesen Witz sicher.
🙂
1 Die Schulbuchverlage sind die Wirtschaft
2 Bitte nicht noch Dummiebücher, die immer mehr Bilderbüchern als Lehrbüchern gleichen
3 Das Problem sind nicht zu unverständliche Bücher, sondern fehlende Fachlehrer (die in ihrem Fach auch ausgebildet sind und nicht die Deutsch-Geschichtslehrerin, die fachfremd Informatik übernimmt)
4 Manchmal gehört halt auch Durchhaltewille und Anstrengungsbereitschaft zum Lehr-Lernvorgang dazu.
Also nein, kein Dummiebücher, die mehr schaden als nutzen.
Punkt 3 und 4 liegt der Hase im Pfeffer:
ad 3: Erwünscht sind Betreuungsdidaktikclowns, nicht Lehrer. Bildung und Anspruch darf schon stattfinden, aber nur so weit, wie es die Notenvergabe und das Wohlbefinden der Könige Kunden nicht stört.
Fachlehrer? Geht garnicht.
ad 4: Ähhhm, hallo? Was sind das denn für patriarchal-kolonialistische Töne? Anstrengungsbereitschaft? Durchhaltewille? Das klingt mir aber sehr verdächtig! 😉
In NRW sind bei Ganztagsschulen die Hausaufgaben abgeschafft. Schüler beschäftigen sich nur noch in der Schule mit Mathematik. Das sind zB 3x45min pro Woche plus 45min Lernzeit. Früher gab es 4x45min plus Hausaufgaben. Der Stoffumfang hat nicht abgenommen, durch digitale Kompetenzen hat er sogar zugenommen. Wie bitte sollen die Schüler da gleichgut bleiben?!
Hinzu kommt. An manchen weiterführenden Schulen in NREwird dir Lernzeit abgesessen, d.h. auch in der Lernzeit wird oft nicht gelernt. Habe dazuschön mehrmals Gespräche mit den Lehrern gehabt. Die Antworten lauten: Die Kinder sollen ihre Aufgaben eigenständig abarbeiten. Wenn sie es nicht tun oder sagen, sie haben keine offenen Lernzeit Aufgaben mehr, kann der betreuende Lehrer auch nichts tun.
Und in Nebenfächern gibt es ja auch keine Hausaufgaben mehr. Ist ja theoretisch durch den Ganztag abgedeckt (aber nicht faktisch).
Meiner Meinung nach ist der Ganztag, so wie er an vielen weiterführenden Schulen in NRW gelebt wird, für die meisten Schüler von Nachteil
Ich werde gleich auch wieder so eine Stunde vertreten.
Handy raus zum Gebet, gut ist.
Ich muss ein halbes Jahr lang beim Schulträger BETTELN, wenn ich 20 Jahre altes, schrottreifes Material in der MINT-Sammlung austauschen möchte, damit wenigestens DIE HÄLFTE der Klasse Experimente nicht nur von Videos kennt.
Hat bestimmt nix damit zu tun, wollte ich aber mal gesagt haben… .
Vielleicht sollte man sämtliche Reformen im Matheunterricht der letzten Jahre (Stichwort Kompetenzorientierung) mal hinterfragen. Scheinbar haben diese das Gegenteil von dem bewirkt, was sie bewirken sollten. Vielleicht sollte man auch über die Stundenkürzungen in diesem Bereich reden. Vielleicht sollte im Mathematikunterricht wieder mehr Zeit fürs Üben eingeplant werden. Nur mit “Kompetenzen” können keine Aufgaben gelöst werden.
Der MINT-Unterricht ist seit mehr als 10 Jahren von einem völligem Mangel geprägt:
Das das nicht gut geht, ist jeder MINT-Lehrperson schon seit langem klar.
Ich versteh das nicht … Die Abi-Noten werden doch immer besser und zeigen, dass die Schüler immer besser gefördert werden … *hüstel
” .. Verglichen mit früheren PISA-Erhebungen hat die Ängstlichkeit der deutschen Schülerinnen und Schüler bezogen auf das Fach Mathematik zugenommen. .. ”
Deutschland, eine einzige Angststörung. Tja, im Überlebensmodus ist Mathe unwichtig. Sprechen wir doch mal darüber, was Ursachen dafür sind, dass die SuS offenbar in den Überlebensmodus versetzt werden. Oder geht das zu tief?
Es gibt in dieser Diskussion viel Wehklagen über die Politik, die Wirtschaft, die Eltern, die sozialen Medien etc. Sicher z.T. berechtigt.
Aber wir können auch selbst mehr tun:
Mehr Hausaufgaben, die auch wirklich durch strikte Kontrollen mit Konsequenzen eingefordert werden. Mehr an der Tafel vorrechnen und direkt danach von SuS üben lassen. Nicht immer alles selbst entdecken lassen und dann auch noch den Merksatz jeden selbst formulieren lassen.
Und bitte in den Naturwissenschaften wieder mehr Lehrerexperimente, die dann zusammen ordentlich ausgewertet werden. Die jungen KuK haben so eine Angst davor, mal etwas vorzumachen. Ja – Schülerexperimente machen Spaß aber meist kommt dabei doch wesentlich weniger an Erkenntnis bei heraus.
“Mehr Hausaufgaben, die auch wirklich durch strikte Kontrollen mit Konsequenzen eingefordert werden.”
Habe ich gemacht und die Inhalte der häuslichen Lern-und Übungsaufgaben im Fach Chemie in Form von schriftlichen unangekündigten (oh, welch Grauen) Leistungskontrollen abgeprüft.
Bei Durchschnitten zwischen 3,8 – 4,4 (Gymnasium Klassenstufe 9) standen dann sofort Schulleitung und Kampfhelikopterelternschaft bei mir in der Tür. Dann graute dem Morgen und zeitintensive Dokumentations- und Rechtfertigungsorgien schmälerten meine Lehrerfreizeit.
In einer Eltern-WhatsApp-Gruppe wurde ich “liebevoll” als Diktator verunglimpft. Bestimmt auch durch meinen pragmatischen Hang zum Lehrerdemonstrationsexperiment, dessen Auswertung (nach meiner ausführlichen erfolgten) ich SuS erneut (10 min später) in Form einer weiteren unangekündigten mündlichen Leistungskontrolle durchführen ließ – aber nix mit Partner, sondern solitär. Das war dann der nächste Rundumschlag und Basis einer ausgedehnten Lehrersprechstunde mit den weinerlich-knatschigen Eltern meiner “Hochleister”.
Macht also richtig Spaß das konsequente, strikte und pragmatische Fordern, Kontrollieren und realistische Bewerten von Leistungen unserer SuS in MINT-Fächern.
Und siehe, mit leisem Summen kleiner Rotoren stieg eine Drohne herab.
Aus ihrem kleinen, gar putzig-süßen Lautsprecher (ihn in Millimeter zu vermessen wäre kapita-lustisch!) erklang folgendes Gesumm:
“Oh Katze, Katze!
Kratze nicht am falschen Baum,
schau nur, der Sommer naht
fast wie ein Traum!
Stell Dir mal die Liege vor,
oder eine Bratsche,
falls Du nicht musikalisch bist,
tuts auch eine Ratsche!
Tests und auch Examina,
die sind bourgeois,
ist doch klar!
Zwinker mit den Augen,
sage “freiwillige Wiederholung”,
“Förderaufgabe”, “Bonuskultur”,
Stunde zu Ende,
ding-dong macht die Uhr!
Der Sommerwind im Haare weht,
wenn die Katze nach Hause geht!
Ob Cabrio oder SUV, Fenster runter, Sonne rein,
die Schule, die wird im Spiegel kleiner,
sollen die da mal sagen und machen,
von Gehalt und Rendite gehen auch schöne Sachen!
Wir sind gar dumm,
Eltern und KuMis sehr schlau,
da machen wir das nach modernster Methode, schau nur Katze, schau!
Nix gelernt in der Schule,
nicht unser Problem,
da muss Herr Student…
wohl zur Nachhilfe gehn!
Probezeit vermasselt,
wirklich sehr tragisch,
Grüße vom Schulstandort,
hier “alles wie immer”,
so macht man das
als neues Lehrerzimmer!
Boahhh, gruselig! Lehrerexperimente … ist doch klar, dass die KuK davor Angst haben. Schülerexperimente machen Spaß… ja, so sind die Menschen…
Na, die meisten Leute gucken aber lieber Fusball vor dem Bildschirm als ihn selbst zu spielen.
Lehrerexperimente kommen durchaus sowohl Schülern als auch dem zu vermittelnden Wissen entgegen. Allerdings leiden dabei leider die Versuchsanordnungsaufbaukompetenzen…
Wieso haben die jungen KuK Angst vor Lehrerexperimenten? Ich verstehe diese Aussage überhaupt nicht, also ich kann sie nicht verstehen.
Wieso werde ich Physik- oder Chemielehrer, wenn ich Angst vor Experimenten habe? Das ist so als würde ich Arzt werden wollen und könne kein Blut sehen.
Aus meiner Erfahrung scheitert es eher am zeitlichen Aufwand und am unvollständigem und kaputten Material.
Bevor es unter den Tisch fällt: “je höher der Indexwert für die Disziplin im Mathematikunterricht, je höher fallen auch die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler aus”
Heißt doch im Klartext: Ruhig sein und üben, üben, üben bis der Kopf raucht. Anderseits: Wie soll ein Kind, das gar kein Deutsch spricht und/ oder dem die Impulskontrolle fehlt, das schaffen?
Das war in den Neunzigern noch anders, da hatten wir auch viele Asylbewerberkinder und Flüchtlinge aus Jugoslawien an der Schule. Also nicht erst seit 2015. Die begabten Nichtmuttersprachler taten sich jedoch bei Mathematik hervor. War geradezu ein Indiz für die spätere Schullaufbahn.
Was ist also wirklich anders?
Mir fällt als springender Punkt nur die exzessive Mediennutzung sein, die gab es noch nicht.
In den Neunzigern wurde auch schon am PC oder Game Boy gespielt. Es hat sich nix wirklich seitdem verändert.
Also was ist es dann?
Zu lange Textaufgaben, zu wenige Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen, zu wenig Unterrichtsstunden, wenig verständliche Erklärung der mathematischen Theorie.
Vielleicht liegt es an der Art der Aufgabenstellung? Nicht Muttersprachler können sich dann hervortun, wenn reine Mathematik abgefragt wird. Sobald es aber um verklausulierte Textaufgaben geht, wird dies schwierig.
Wieder kann man lesen, wie wichtig Disziplin im Unterricht ist, um überhaupt sinnvoll arbeiten zu können. Sogar das lange Zeit verteufelte Wort Disziplin taucht erneut auf. Leider schaffen heutige Lehrer gerade das am wenigsten. Sie sollen besser motivieren, wenn Kinder stören. Mehr lernen sie nicht. Und das geht fast immer schief.
So ähnlich schätze ich es auch ein. Im Idealfall sollen die Kinder intrinsische motiviert sein.
Wenn die Schüler nicht motiviert sind, dann sollen diese aber verdammt nochmal wieder lernen, Ausdauer auch bei unangenehmen Aufgaben zeigen usw. (Disziplin und Übung) Dafür müssen die Lehrer aber auch die entsprechenden Druckmittel bekommen, und dies muss auch von Elternseite unterstützt werden.
Es kommt zunächst darauf an, den Kindern den Stellenwert von Disziplin zu vermitteln, denn letztendlich sind sie es, welche die Disziplin aufbringen müssen. Dabei bedarf auch die Frage nach dem Warum einer Antwort. Druck entsteht ggf. von alleine, z. B. wenn ein Lehrer selbst fühlbar diszipliniert ist, eigentlich aber schon durch Undisziplin. Der Druck muss dann auch nicht unbedingt „weggenommen“ werden. Motivation und Disziplin sind damit eng verknüpft.
Stimme Ihnen absolut zu. Man kann ja den Leistungssport als Beispiel nehmen. Es gibt keinen erfolgreichen Leistungssportler ohne eiserne Disziplin. Mal vom Fußball und co. abgesehen: Selbst erfolgreiche Dartsspieler üben jeden Tag stundenlang.
Und das müsste man den Kindern von Anfang an vermitteln, sowohl zu Hause als auch in der Schule.
Genauso ist es wichtig, dass die Schüler lernen mit Druck, mit unangenehmen Situationen und Rückschlägen umzugehen (natürlich Altersentsprechend). Denn am Ende möchte man ja einen Menschen haben, der sich selbständig im Leben zurückfindet und eine Resilienz entwickelt, diee ihm hilft auch schwierige Situationen und Phasen im Leben zu überwinden.
Aber wie ist es heute? Wettbewerb und Leistung werden oft negativ dargestellt. Wenn sich Schüler unangenehmen Situationen verweigern, lässt man sie halt. Dadurch ziehen sie sich tendenziell noch mehr zurück und Verlassen ihren Rückzugsraum kaum. Das verhindert aber die nötige Weiterentwicklung. Weiterentwicklung erfolgt dann, wenn man sich unangenehmen Situationen stellt und diese überwindet.
Richtig, schon allein, um sich um einen anderen Menschen zu kümmern, um seine Aufgaben im Beruf, Haus, Garten, Wohnung zur eigenen Zufriedenheit zu erledigen, seine Gesundheit zu erhalten oder auch sich umweltbewusst zu verhalten (im weitesten Sinne, also auch seiner menschlichen Umwelt gegenüber), bedarf es der Anstrengung und Konsequenz.
Es wird noch schlimmer werden.
Ich erinnere mich an “Bequemlichkeits”-experimente, wo man einen NAWI Kurs früher abwählen konnte, damit das Zeugnis am Ende besser wird usw. Lief auch nicht richtig. An schlechten Noten sind die Nawi-kuk schuld und nicht die Kids, die sich die Regeln nicht drauf schaffen wollen. Auch hier wieder der Hang zur Absenkung des Niveaus deutlich erkennbar. Und am Ende dann die Beschwerden. Mich wundert es einfach nicht mehr.
Die Wirtschaft fordert mehr Geldmittel für Bildung. Schön. Gleichzeitig verschieben internationale Konzerne massiv ihre Gewinne mit wachsendem Erfolg in Steueroasen und verhindern schon seit Jahrzehnten mit starker Lobby ein international gerechtes Steuersystem. Am 04.06.24, auf ARTE/der Steuerkrieg, wurde ein aktueller Schätzbetrag von ca. € 600 Mrd. p.a. Steuerhinterziehung weltweit genannt. Auf Deutschland bezogen sind das rund € 2000 pro Arbeitnehmer p.a., mit steigender Tendenz. Wer sollte sich nun bewegen und nicht nur fordern? Das ganz alte Spiel: Privatisierung der Gewinne, aber Sozialisierung der Kosten. Bin kein Kommunist, aber Diebstahl am Volk bleibt Diebstahl, den auch die Politik deckt. Und wer das aufdecken will will wird stark behindert. Wird in oben genannter Sendung genau beschrieben.
Und das natürlich auch bei der IT-Industrie sowie bei Google & Co.