DÜSSELDORF. Was läuft schief beim Schreibenlernen? In einem aufschlussreichen Austausch auf der Facebook-Seite von News4teachers diskutierten Grund- und Gymnasiallehrkräfte, was wirklich hinter der zunehmend schwachen Rechtschreibleistung vieler Schülerinnen und Schüler steckt – und wo die Verantwortung liegt. Es geht um überfrachtete Curricula, fehlende Zeit für Übung, fragwürdige Methoden und Missverständnisse zwischen Schulformen. Die Kommentare zeigen: Es wird beim Thema Rechtschreibförderung schnell grundsätzlich. Wir dokumentieren einen Auszug aus der Debatte im Wortlaut.
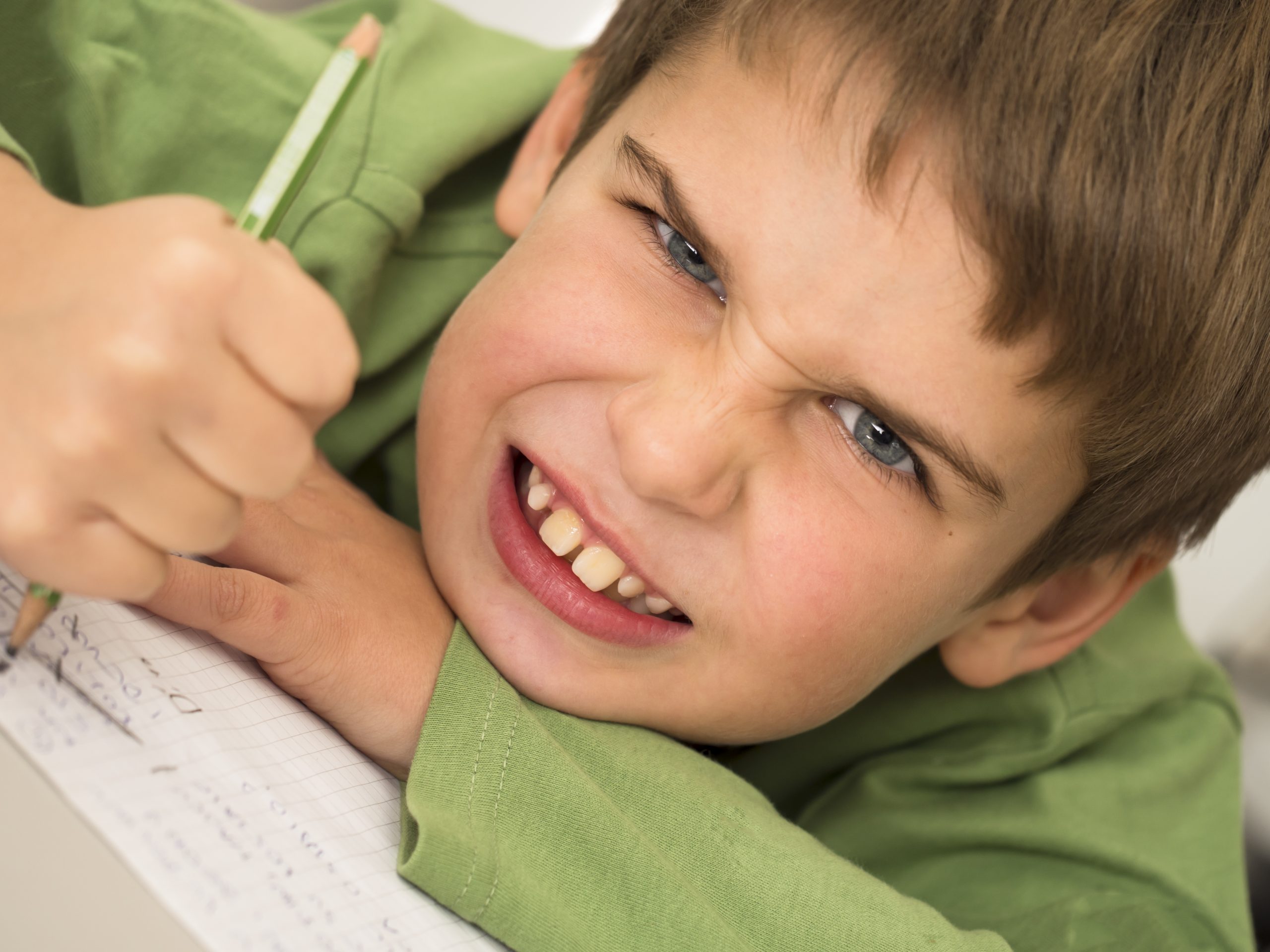
Gymnasiallehrerin: „Wir erhalten am Gymnasium halbe Analphabeten aus den Grundschulen. Das mangelhafte Curriculum, das Kompetenzen vor Fachwissen stellt, ist hierfür die eine Ursache. Es fehlt die Zeit für praktische Übungen. Überfüllte Klassen mit zahlreichen ,,verhaltensoriginellen” Kindern (dieses Wort wirkt schon von sich aus ironisch) leisten ebenfalls ihren Beitrag zu dieser Problematik. Selbstverständlich sind Schüler gelegentlich von einer LRS betroffen. Das ist jedoch nicht das von vielen Eltern erhoffte Massenphänomen, weil das eigene Kind noch nicht die Grundlagen des Schreibens erlernt hat. Die Testerei hierzu soll bitte an anderer Stelle vorgenommen werden. Noch mehr zusätzliche Arbeit halse ich mir mit Sicherheit nicht auf.“
Rechtschreibförderung – aber wie? Diese Frage stellt sich insbesondere an der weiterführenden Schule in den 5. und 6. Klassen immer wieder neu. Das Lernserver-Institut von Prof. Friedrich Schönweiss und seinem Team unterstützt Lehrkräfte mit einem wissenschaftlich fundierten, in der Praxis leicht einsetzbaren Konzept für die Rechtschreibförderung.
Das Prinzip: Auf eine einfach durchzuführende Testung (auf der Grundlage der Münsteraner Rechtschreibanalyse) folgen eine ausführliche Fehleranalyse und die Ermittlung des Förderbedarfs. Daraus erstellt das Tool, begleitet und überwacht von Sprachwissenschaftlern und Lerntherapeuten, individuelle Förderpläne mit konkreten Materialien; diese können dann von Lehr- und Förderkräften an der Schule, aber auch in der Nachhilfe oder zuhause gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen umgesetzt werden.
Mit den Lernserver-Materialien arbeiten Kinder ab der 1. Klasse bis hin zu Jugendlichen im Ausbildungsalter. Das Besondere: Die Materialien setzen genau dort an, wo der Schüler oder die Schülerin zuerst Unterstützung braucht – falls nötig noch vor dem orthographischen Bereich. Dadurch wird das notwendige Grundlagenwissen (auch für Kinder mit geringen Deutschkenntnissen oder Deutsch als Zweitsprache) sichergestellt.
Interessiert? Hier gibt es alle Informationen – schauen Sie vorbei: www.lernserver.de/deutsch.html
Eine Grundschullehrerin aus Niedersachsen antwortet: „Das hat weniger mit ‚Kompetenzen vor Fachwissen‘ zu tun, sondern damit, dass die Kerncurricula völlig überfrachtet sind. Die Kompetenzen (aka Lernziele) sind gar nicht alle erreichbar, wenn das Schuljahr normal lang ist, von kurzen Schuljahren ganz zu schweigen. Eine Kollegin sagte beim Erscheinen der letzten Curricula treffend ‚die Kinder präsentieren sich zu Tode‘. Alle diese wunderbaren Präsentations- und Sicherungsformen (Schattentheater, Hörspiel, Buchvorstellung im Karton/ mit Leserolle/ als Lapbook etc.) sind aber im Alltag Zeitfresser. Anstatt sich mit schwerpunktlichen Inhalten des Fachs zu beschäftigen, geht viel Zeit für Basteln oder Dauerstreit in einzelnen Gruppen drauf.
Ich sehe das als Nicht-Deutschlehrerin zwar nur aus ‚der Ferne‘, erlebe das aber durchaus auch in meinen Fächern. Und wir haben ein gutes Einzugsgebiet mit Topp-Lehrkräften, die auch in Uni, Studienseminar bzw. in Fachberatung arbeiten. Getestet wird übrigens auch bei uns regelmäßig (z. B. durch die Hamburger Schreibprobe) – aber die Zeit reicht halt für all das, was Deutsch an der GS leisten soll, nicht mehr. Als Ausgleich gibt‘s jetzt ‘ne Stunde ‚sichere Basis‘, in der irgendwas fächerübergreifend für Basiskompetenzen gemacht werden soll. Keine Richtlinien, keine Arbeitsgrundlagen, nur ein freundliches ‚macht mal!‘. Das ist so unorganisiert, dass die Fachberatungen bei ihren Treffen 4 Monate nach Schulbeginn auf den FK-Leitungstreffen erst mal gesammelt haben, was an den Schulen da überhaupt so gemacht wird…“
- Ein Lehrer a. D. aus der Schweiz reagiert auf den Post der Grundschullehrerin: „Ja, ein Trend, seit über 20 Jahren: Immer mehr ‚Kompetenz‘ muss in die Köpfe von Grundschülern / Volksschülern, immer mehr ‚Spezialisten‘ leiten Fächer. Seit mehr als 15 Jahren kenne ich Großbetriebe in der Schweiz, welche Schüler ‚übernehmen”, mit eigenen Programmen testen und darauf Lehre oder Karriereplan entwerfen und empfehlen. Zeugnisse? Lass es… Ich durfte zu einer Zeit unterrichten, in welcher das Erlernen der Grundfähigkeiten in Mathe-Sprache, Nahgeographischen Themen und Geschichte, Musisches sowie eine 2. Fremdsprache im Zentrum standen. Themen wie Gewalt, Mobbing usw. wurden durch die Lehrkraft direkt mit den Betreffenden/ Betroffenen oder gemeinsam mit Schulleitung und Eltern angegangen. Und dann ging es darum, gemeinsam mit der jeweiligen Klasse ein spannendes Schuljahr, gespickt mit attraktiven Projekten in- und außerhalb des Klassenzimmers zusammenzustöpseln.Ein wesentliches Element: Die Klasse immer wieder mit überraschenden Situationen konfrontieren, aus denen sie selbst herausfinden mussten, dies mit den Mitteln, die sie zum jeweiligen Zeitpunkt hatten… spannend für alle, auch für mich. Natürlich mussten da auch klare Wege der Lehrziel-Erreichung aufgezeigt und letztendlich ausgewiesen werden. … und die waren da, überdurchschnittlich. Der große Unterschied zu heute meiner Meinung nach: Es gab eine klare Verbindlichkeit zwischen Eltern und Lehrkraft, welche die optimale Förderung des Kindes zum Ziel hatte. Die halbjährlichen Lernzielvereinbarungen waren das wesentliche Fundament. Wir haben heute zu viele Köche, welche für sich in Anspruch nehmen, nur dank ihnen und ihren Anweisungen (auszuführen letztendlich durch die Lehrkräfte) werde aus Schule GUTE Schule. Folge: Unglaublich viel Ballast und immer weniger produktives Lernen… Messbar.“
Eine Grundschullehrerin aus Baden-Württemberg (antwortet auf Gymnasiallehrerin): „Das mag in manchen Fällen richtig sein. Meine Erfahrung sagt aber auch, dass Gymnasiallehrer im Prinzip fertige Rechtschreiber erwarten, die abgesehen von ein paar Sonderfällen fehlerfrei schreiben. Wenn man sich klarmacht, dass der Rechtschreibrahmen in BW bis zur 10. Klasse geht und diese Kinder insofern gerade mal 3 Jahre ihres Rechtschreibprozesses hinter sich und noch ca. 6 Jahre vor sich haben, frage ich mich manchmal schon: mit welchem Recht?
Genauso sind Gymnasiallehrer nicht bereit, endlich von dieser sinnlosen Diktatschreiberei Abstand zu nehmen. Was für eine Lebenskompetenz soll damit bitte trainiert werden? Eine Bewerbung oder Semesterarbeit zu schreiben und ohne Korrektur abgeben und bewerten zu lassen? – Es wäre wirklich schön, wenn Gymnasiallehrer endlich gemeinsam mit den Grundschullehrern auf die veränderte Lebenswirklichkeit (wie Sie ja schon schreiben) eingehen und ihren Unterricht anpassen würden, anstatt trotz der Einsicht in die Ursachen weiter auf GS-Lehrer und Schüler zu schimpfen!“
Die Gymnasiallehrerin antwortet: „Diktate überprüfen die Rechtschreibfähigkeiten. Wir suchen uns diese Art der Leistungskontrolle nicht aus, sondern befolgen curriculare Vorgaben. Interessant hierbei ist, dass die Schüler, die Diktate aus der Grundschule kennen, wesentlich weniger Probleme beim Schreiben haben als diejenigen, bei denen die Rechtschreibung in der Grundschule eine untergeordnete Rolle gespielt hat.“
Eine Mutter reagiert: „Dafür habe ich den Eindruck, dass man am Gymnasium meiner Tochter davon ausgeht, dass der Rechtschreiberwerb mit Klasse 4 abgeschlossen ist und keiner weiteren Übung bedarf. Sie ist nun in Jahrgangsstufe 9 und hatte seit der GS, wenn es hochkommt, zehn Stunden Rechtschreibunterricht.“ News4teachers
[“Rechtsschreibung” -> Überschrift. Wenn auch witzig … Vllt. ausbessern]
Klassiker :). Danke für den Hinweis – ist korrigiert. Herzliche Grüße Die Redaktion
An anderer Stellen hier hatten wir bereits schon eine Diskussion, bei der es unter anderen auch um die wissenschaftsferne Anwendung einer multiplen Methodenvielfalt, siehe Schneider Shiffrin, die Schüler mehr verwirrt als dass sie strukturiert eine Automatisierung beim Schreiben vermittelt. Außerdem thematisiert waren Anlauttabellen im Anfangsunterricht zum Schreiben lautgetreuer Wörter, von denen es im Deutschen nur 5 % gibt, oder die Methode des alphabetisches Schreiben nach “Gehör” bei Kindern mit stark dialektgeprägten Deutsch, z.B. Schwäbisch, Bayrisch etc., oder Kindern mit Migrationshintergrund und unzureichenden Deutschkenntnissen oder Kinder mit auditiven Wahrnehmungsstörungen. Es war ein recht anspruchsvoller gedanklicher Austausch, und zum Teil war dieser von Nettigkeiten getragen.
Hier ist noch einmal der Link zum wissenschaftlichen Teil des IntraAkt-Konzept.Neuauflage_2012.indb
Es geht generell darum, wie Fehler vermieden werden können, um die Schreib- und Leseautomatisierung schneller und nachhaltiger zu vermittelt. Übertragbar ist dieser wissenschaftliche Teil auch auf andere Kulturtechniken und andere Schulfächer.
Ähm, Sie unterschätzen die Anzahl der lautgetreuen Wörter um den Faktor 10. Es sind tatsächlich ca. 50% der Wörter, die im Deutschen lautgetreu geschrieben werden.
Zweisilbige deutschstämmige Wörter mit dem Schwalaut und dem Buchstaben < e > sind nicht. Lautgetreu wäre : Otto, Banane, Obst.also. lautgetreu.http://www.grundschulservice.de/Schreiben%20nach%20Geh%C3%B6r%20%28Lesen%20durch%20Schreiben%29%20-%20Kritik.html
http://www.grundschulservice.de/Schreiben%20nach%20Geh%C3%B6r%20%28Lesen%20durch%20Schreiben%29%20-%20Kritik.html
Einsilbige lautgetreue Wörter
Die Grenzen des lautorientierten Schreibens
“1) Jede Silbe hat einen Vokal – im Gesprochenen kann auch ein Konsonant die
Vokalposition einnehmen. Denken Sie an das Wort „Esel“, bei dem das zweite
/e/ meist gar nicht artikuliert wird.
2) Bei den gesprochenen Vokalen wird zwischen gespannt und ungespannt (fast
wie lang und kurz) unterschieden, im Geschriebenen gibt es diese
Unterscheidung nur beim <ie>).
3) 4) 5) 6) 7) Für einen Laut gibt es viele verschiedene Verschriftungsformen. Z.B.
Für einen Buchstaben gibt es verschiedene Lautformen
Es gibt Lautkombinationen, die bestimmte Verschriftungen nach sich führen
(/òp/ (sch p) à sp, (/òt/ (sch t) à st)
Großschreibung des nominalen Kerns einer Nominalgruppe, Großschreibung
am Satzanfang
Stimmhaftes und stimmloses s (/XXX/ und /xxx/) werden am
Silbenanfangsrand in der zweiten Silbe unterschiedlich verschriftet (Dose –
Füße).
8) 9) …
Folgt auf einen kurzen Vokal nur ein Konsonant, muss dieser verdoppelt werden…”
All diese oben genannten Dinge werden explizit schon direkt auch im Anfangsunterricht beim Erlernen der Laute besprochen und eingeübt. Allein das “ie” wird oft meiner Meinung nach zu spät thematisiert. Schon die Lehrwerke berücksichtigen all das. Ich kenne keinen Grundschullehrer, der das anders macht. Silben klatschen und den Vokal in jeder dieser Silben heraushören und ob dieser lang oder kurz klingt ist zB. eine Standardübung. Endungen, Großschreibung, etc. Es werden Rechtschreibgespräche geführt, Fehler analysiert usw. Ich wünsche mir manchmal, dass die Kollegen der weiterführenden Schule mal einige Tage im Anfangsunterricht hospitieren würden.
Das /e/ in der Endsilbe steht für den häufigsten Vokal in der deutschen Sprache, nämlich dem Schwa-Laut /e;/, der in jedem zweisilbigen Wort mit deutschsprachigen Wortstamm gesprochen wird.
Die Phoneme der deutschen Sprache lauten wie folgt : /a/ in Apfel, /a:/ in Schal, /e/in Geld, /e:/ in Esel, /e;/ in Hase, /e!/ in Mädchen, /i/ in Bild, /i:/ in Biene, /o/ in Kopf, /o:/ in Obst, /ö/ in Knöpfe, /ö:/ in Töne, /u/ in Hund, /u:/ in Hut, /y/ in Mütze, /y/ in Bücher, /ai/ in Eis, /au/ in Auto, /eu/ in Eule
Die Buchstaben unseres Alphabetes bilden n i c h t die Laute unserer Sprache ab. Besondere Bedeutung kommt der Differenzierung zwischen den Kurz- und Langvokalen zu.
Mit den Graphemen aber, u.a. auch Buchstabenkombinationen wie st, sch sp , i, ie, ieh, o, oh, ch, oo etc. bilden wir die Laute /Phoneme der deutschen Sprache ab.
Warum bringt man den Kindern denn nicht zuerst zweisilbige Wörter mit einem deutschen Sprachwortstamm mit den dazu gehörenden Graphemen bei und den Regeln in der Anwendung ?
Weil Kinder möglichst von Anfang an experimentierend selbständig etwas schreiben sollen ?
Es erfolgt erst sehr viel später eine gezielte Hinführung zum Wortstamm-Prinzip. Zunächst sollen die Kinder sich selbstständig eine Laut-Buchstabenzuordnung selbstständig mit bebilderten Anlauttabellen vermitteln und mit diesem rudimentären Wissen später selbstständig Wörter schreiben. Oben habe ich Listen mit “lautgetreuen”Wörter mit Langvokalen eingestellt. Danach wird es dann für die Kinder schwierig, um orthographisch korrekte Wörter selbstständig zu schreiben.
Ich empfehle Ihnen zum eigenen Linguistik-Studium der Deutschen Sprache und der davon abgeleiteten Schrift das Buch von Günther Thomé ABC und andere Irrtümer über Orthographie, Rechtschreiben, LRS, Legasthenie.
3., bearb. Aufl.
Gut dass Sie so verfahren. Aber trotzdem schreiben die Kinder gerade auch noch in den weiterführenden Schulen derart falsch, weil sie diese erlernte Schreibstrategie der lautorientierten Schreibung beibehalten. “Indem wir Kindern beibringen, dass sie so schreiben sollen, wie sie sprechen, führen wir sie auf eine falsche Fährte. Denn genau genommen, schreiben wir gerade anders, als wir sprechen. Es ist die Sicht eines Schriftkundigen, den Zusammenhang von gesprochener und geschriebener Sprache zu sehen. Schriftunkundige können diesen jedoch nicht in dieser Form herstellen.” Dieser Beurteilung kann sich eigentlich niemand verschließen. Es muss sich etwas ändern.
https://madoo.net/therapiemats/liste-lautgetreuer-woerter/
Mich wundert es im Angesicht der vorausgegangenen Diskussionen an anderer Stelle hier im Forum hier niemand der Fachkollegen und Kolleginnen aus dem Grundschulbereich der These von Sim Si widerspricht, dass 50 % der deutschen Wörter lautgetreu wären ! Das ist definitiv falsch, dient es mir aber als ein Erklärungsansatz für orthographische Probleme bei Risikokindern wie bei Kindern mit einem fremdsprachigen Hintergrund, Kindern mit stark dialektgeprägten Deutsch und Kindern mit auditiven Wahrnehmungsstörungen.
,dass fehlt in der 2. Zeile
Wenn Kinder mit fehlenden Basisfähigkeiten aus der Grundschule kommen, liegt dies nicht am Lehrplan. Regelmäßig stehe ich in der 5. Klasse einer Gesamtschule vor zig Kindern, die keine Punkte am Satzende setzen oder danach klein weiterschreiben. Dieses Prinzip versteht jedes Inklusionskind, wenn man ein wenig mit ihm/ihr übt und der Fehler verschwindet dann auch sehr schnell.
Der Fakt, dass derartige Grundfertigkeiten in 4 Jahren Grundschule dennoch nie sicher eingeübt wurde, lässt eigentlich nur vermuten, dass diese Kinder in irgendeiner Weise durchs Raster gefallen sind: Sei es als DaZ-SchülerIn ohne Förderung, sei es wegen des Unterrichtsausfalls, sei es wegen mangelhaften Classroom Managements, sei es, weil man schnell durch den Stoff durchhetzen wollte, damit die Leserolle genug Zeit bekommt. Was auch immer die Ursache ist: Es ist eine Katastrophe, die Kinder so offenkundig im Stich zu lassen.
Ich würde mir wünschen, dass man sich in der Grundschule auf ein realistisches (!) Basis-Curriculum in der Rechtschreibung einigen könnte, was wirklich JEDES Kind erreichen MUSS. Dann wären alle Beteiligten (inklusive des Ministeriums und der Eltern) automatisch gezwungen, die eigenen Ansätze zum Wohle des Kinds zu hinterfragen.
Solange die Grundschule zu viel auffangen muss, was an in Deutschland als Norm angesehene und vorausgesetzte Basisfähigkeiten nicht in der Familie vermittelt wurde, sind solche Ergebnisse nicht überraschend und werden sich noch verstärken. Leider.
“In Deutschland als Norm angesehene und vorausgesetzte Basisfähigkeiten…”
Wo finden wir die denn niedergeschrieben?
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Das wissen Sie ganz genau. Nehmen Sie einfach die Tugenden, die Produkte “Made in Germany” weltweit hoch angesehen machten.
Innovationskraft? Kreativität? Preis?
Lustig in diesem Zusammenhang ist die Anekdote, wie “Made in Germany” überhaupt in die Welt kam – als britisches Label für Billigprodukte. “‘Made in Germany’ sollte eine Warnung sein: ‘Achtung, dieses Produkt ist zwar billig, aber aus Deutschland und deshalb von schlechter Qualität'”. Quelle: https://www.ardalpha.de/wissen/geschichte/kulturgeschichte/made-in-germany-wie-aus-einem-warnzeichen-ein-qualitaetssiegel-wurde-100.html
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Da kann man mal sehen, wie gut die prognostischen Fähigkeiten der Briten sind. Alles was die Warnung vermitteln will, ist mittlerweile eingetreten. Deutsche Motorsteuerungen machen es möglich.
Man könnte argumentieren, (a) dass es insg. alterstypische Kompetenzen von z.B. 6-Jährigen gibt, über die diese i.d.R. verfügen können, sollten Sie erziehungstechnisch nicht entsprechend depriviert oder infolge physischer Probleme körperlich u./o. geistig beeinträchtigt sein, bspw. in den Bereichen Selbstkonzept und Motivation (Selbstreflexion; Umgang mit eienen Emotionen; Engagement; Leistungsmotivation; Ausdauer etc.), lernmethodische und soziale Kompetenzen (schlussforlgerndes Denken; Kooperationsfähigkeit und soziale Verantwortung; Empathie und Solidarität; konstrukitver Umgang mit Konflikten etc.), Körper und Bewegung (Körpergefühl; Koordfination; Grob- und Feinmotorik etc.), und (b) dass immer weniger Kinder dies am Ende der Kidnergartenzeit können, weil einseitige Erziehung ausschl. durch die Erzieher und nicht in hinreichendem Maße durch die Eltern nicht funktioniert und selsbt wenn es theoretisch funktionieren könnte, in den überfüllten Verwahranstallten, die kiTas heute sind, utopisch wäre.
Nun, niedergeschrieben sind diese vorausgesetzten Basisfähigkeiten = “Normen” nicht, aber:
zum Beispiel:
Die allgemein gültige und übliche soziale Erwiderung = DANKE !
Bzw. …soziale Formulierung bei Wünschen und Bedürfnissen =
BITTE!
Und so allerlei sonstige gängige Sozialformen des täglichen Miteinanders …
Auch Schuhe – binden, Ranzen packen, Hausis erledigen, pünktlich sein, …
Also ich weiß, was “Unfassbar” damit meint.
Die “Redaktion” nicht? Oooch!
@ Redaktion
Nachtrag:
Muss eigentlich alles, was als üblich, erwartbar, vernünftig, nach gesundem Menschenverstand einzuordnen ist, irgendwie und irgendwo niedergeschrieben sein?
Herzliche Grüße
mama51
“Der gesunde Menschenverstand, beziehungsweise auf Englisch ‘common sense’, ist mutmaßlich für jeden Menschen etwas anderes. Es handele sich um Ansichten und Überzeugungen, die für einen Einzelnen bedeutend sind und daher offensichtlich wirken. Daraus leiten Menschen ab, dass die meisten anderen das auch so sehen müssten oder gefälligst so sehen sollten. Das gelte unabhängig von Faktoren wie Alter, Geschlecht, Einkommen oder politischer Überzeugung. Der gesunde Menschenverstand wäre demnach so etwas wie die persönliche Wahrheit einzelner Personen, der sich doch bitteschön auch der Rest der Welt anschließen möge. (…)
Am Ende bleibt die Nachricht, dass jeder und jede das als gesunden Menschenverstand bezeichnet, was ins eigene Weltbild passt.”
Quelle: https://www.sueddeutsche.de/wissen/gesunder-menschenverstand-psychologie-politik-1.6333363
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Auf dem „gesunden Menschenverstand“ basieren letztlich auch solche Dinge wie Menschenrechte, auch wenn es lange dauert(e), bis sie „common sense“ sind (wurden).
Allerdings gebe ich Ihnen recht, dass das bei grundschulischen Voraussetzungen noch nicht so klar ist.
Sind die Menschenrechte denn common sense? Wagen wir zu bezweifeln.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Wollen Sie damit die Allgemeingültigkeit, da sie (mMn) dem gesunden Menschenverstand entspringen, anzweifeln oder nur die Realität, dass diese schon jeder akzeptiert hat?
Wir zweifeln die Existenz des sogenannten gesunden Menschenverstandes an. Und sind dabei in guter Gesellschaft: “Der gesunde Menschenverstand ist die am besten verteilte Sache in der ganzen Welt, denn ein jeder fühlt sich damit angemessen ausgestattet.” (Descartes)
Wir halten es da lieber mit der Wissenschaft.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Da hat Herr Decartes recht, deshalb bemühe ich mich auch, mir meine zugeteilte Portion gesunden Menschenverstand bei aller Wissenschaft (und deren Interpretation) noch zu erhalten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Common_Sense_(Pamphlet)
Naja, “Common sense” und Menschenrechte haben doch etwas miteinander zu tun. (Siehe link)
“Auf dem „gesunden Menschenverstand“ basieren letztlich auch solche Dinge wie Menschenrechte”
Ich bin erleichtert, dass wir dazu Gesetze haben 😉
Las erst heute, das der Innenminister darin bestärkt wird, Recht zu brechen …
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/migration-richter-haben-nicht-immer-recht-meinung-a-b22478b2-78e0-4966-baff-7e9dfe345249
Aber das Blömschen wird wohl nicht aufgrund des “gesunden Menschenverstands” beschäftigt 😉
„Ich bin erleichtert, dass wir dazu Gesetze haben “
Vermutlich aber nur solange es dabei nicht um Rechtschreibregeln geht.
Wenn es eine gerichtliche Anordnung gibt, dass Foren eine Bearbeitungsfunktion erlauben müssen, werde ich diese nutzen 🙂
Nein, ich hatte nicht den Rotstift in der Hand, ich habe nur plump auf‘s Gendern angespielt.
Wie gesagt bin ich gespannt, wie viele Gegner*innen des Genders klaglos umstellen werden, wenn der Rechtschreibrat dies in den Raum stellt und die Politik – selbstredend – verbindliche Regeln daraus schöpft 😉
https://uebermedien.de/96987/nein-der-rechtschreibrat-hat-kein-aus-fuer-den-genderstern-beschlossen/
SÄMTLICHE Bedenken werden ausnahmslos aus dem Weg geräumt, das Generische Maskulinum verboten, sobald der Rechtschreibrat dies erwähnt.
Schade, ich hofte, wie könnten mit Vielfalt umgehen und diese Schätzen, aber muss halt =/
btw meinen Sie, in anderen Bundesländern ohne Genderverbot gebe es derzeit keine Rechtschreibung? 😀
Stellen wir uns mal ganz dumm und vergessen, dass wir ein StGB haben….
Hm, in meinem Weltbild kommen Femizide und Vergewaltigungen nicht vor.
Bei diversen i.d.R. männlichen Mitgliedern unserer Gesellschaft schon.
Heißt das, die Delikte sind ok?
Müssen wir das StGB ändern?
Heutzutage schon, sonst hätten wir in Schule mehr Zeit für unsere Kernaufgaben…..
Die jüngste rosig schimmernde Verheißung, die durchs schulische Unterholz getrieben wird, ist die sogenannte Grundschrift. Diese aus Einzelbuchstaben sich zusammensetzende Druckschrift mit fiktiven “Luftverbindungen”, die laut Grundschulverband das Schreibenlernen enorm erleichtern soll, wurde von eben diesem aus der Taufe gehoben, der sie ohne vorausgegangene Feldstudien gern flächendeckend eingeführt sehen will. Auch das gelobte Bildungs-Finnland setzt künftig nur noch auf Druckschrift – und auf das Schreiben an Computertastaturen. Wird dadurch nun endlich alles besser, gerade für die schwächeren Schüler? Das weiß niemand so genau.
In den „Gute Kita“ Vorgaben und in den Konzepten jeder einzelnen Kita….und letztlich finden sich die Basisfähigkeiten auch in den Gutachten der Gesundheitsämter, wo die Fähigkeiten abgetestet werden und ganz letztendlich auch in den Diagnostiken jeder einzelnen Grundschule in Deutschland….
Wir wüssten nicht, dass Eltern “Gute Kita” Vorgaben oder die Vorgaben der Gesundheitsämter übermittelt würden. Wenn die Diagnostiken der Grundschulen flächendeckend und systematisch Entwicklungsprobleme erfassen würden, bräuchte es einen Modellversuch wie diesen ja nicht: https://www.news4teachers.de/2024/12/bildungschancen-verbessern-nrw-erprobt-das-screening-verfahren-edulog-an-130-grundschulen/
Scheint also erhebliche Lücken zu geben. Die Frage, was überhaupt mit erfassten Entwicklungsproblemen passiert (wer kümmert sich darum?), ist damit ja auch noch nicht beantwortet. Logopäd*innen oder Lerntherapeut*innen sind längst nicht für alle Eltern erreichbar.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
„Die Frage, was überhaupt mit erfassten Entwicklungsproblemen passiert (wer kümmert sich darum?), ist damit ja auch noch nicht beantwortet.“
Na, die Schule muss sich dann darum kümmern. Daher haben wir ja die ganzen Probleme……
Stimmt, Eltern müssen nichts von den Konzepten wissen….aber die allermeisten Kinder besuchen eine Kita und die Kitas haben die Aufgabe, die basalen Fähigkeiten zu fördern. Das tun sie auch, soweit es die Rahmenbedingungen zulassen.
Probleme haben die Kinder, die keine Kita besuchen und deren Eltern nicht in der Lage sind, grundlegende Fähigkeiten zu fördern. Aber das Thema hatten wir schon….dazu mag ich jetzt nichts mehr sagen…
Tatsache ist, dass wir eben vermehrt Kinder in die Schule bekommen, die noch nicht bereit sind zu dem, was wir als Kernaufgabe der Grundschule ansehen.
Hier brauchen wir gute Konzepte und Rahmenbedingungen, um diesen Kindern gerecht zu werden….
“Aber die allermeisten Kinder besuchen eine Kita und die Kitas haben die Aufgabe, die basalen Fähigkeiten zu fördern.”
Tatsächlich stimmt das für Migrantenfamilien nicht. Gerne hier nachlesen: https://www.news4teachers.de/2024/05/familienreport-migrantenfamilien-die-besonders-dringend-einen-kita-platz-brauchen-finden-haeufig-keinen/
Und: Haben Sie schon mal vom Fachkräftemangel in den Kitas gelesen? “Das Kita-System ist stark belastet und steht kurz vor dem Kollaps.” Gerne hier nachlesen: https://www.news4teachers.de/2024/09/kita-krise-wissenschaftler-schlagen-alarm-seit-corona-hat-die-arbeitsbelastung-von-paedagogischen-fachkraeften-stetig-zugenommen/
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Schrieb ich von Migranten? Nö….
Ich schrieb auch von „soweit es die Rahmenbedingungen zulassen“…..
Haben Sie meinen Thread gelesen?
Und ja, ich habe schon mal etwas von Fachkräftemangel in Kitas gehört, gerüchteweise gibt es auch Fachkräftemangel in der Schule….
Basiskompetenzen stehen im Lehrplan, und dafür gibt es in jedem Bundesland einen eigenen. (Ggf. Schuleingangsfähigkeiten in eine Suchmaschine eingegeben. Die von Berlin sind ganz brauchbar, wurden aber bei uns in NRW nur zum Teil vor der Schule getestet, weil Pflichtschulkinder selten zurück gestellt werden sollen)
Was die norm der Rechtschreibung betrifft, die findet man im Zweifelsfall im Duden. Es gibt mehr als 10 für die Grundschule zugelassene Wörterbücher. Die meisten dieser Bücher vermitteln neben Wortschatz und Grammatik auch Grundlagen zum Aufsatz schreiben. Seit einigen Jahren kommen in immer mehr dieser Wörterbücher Grundlagen der gängigen Fremdsprachen hinzu.
“Basiskompetenzen stehen im Lehrplan.”
Dummerweise sind Eltern keine Staatsbediensteten, für die ein Lehrplan verbindlich wäre. Wir wüssten auch nicht, dass Eltern ein Lehrplan von irgendwem zur Bearbeitung übermittelt würde.
Herzliche Grüße
1 Klick und
https://www.bildungsserver.de/schule/lehrplaene-fuer-die-grundschule-1660-de.html
……Leichter als bei Amazon bestellen
(Übrigens bietet sich für Kunder in der GS auch die U10 an, um Förderbedarf festzustellen)
Die Basiskompetenzen werden den Eltern an Elternabenden vermittelt. In der Kita und in der GS. Wenn man denn hingeht, erfährt man viel darüber. Das ist aber das Problem. Eltern glauben alles zu wissen und haben diese Infos nicht nötig.
“Die Basiskompetenzen werden den Eltern an Elternabenden vermittelt.”
Werden dort also nicht gut Deutsch sprechende Eltern in Deutsch unterrichtet?
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Was genau möchten Sie mit Ihren polemischen Einlassungen erreichen?
Das hilft nun wirklich nicht weiter.
Natürlich nehmen wir alle Kinder in die Schule auf. Auch selbstverständlich Kinder, die noch nie einen Stift oder eine Schere in Hand gehabt haben, die keine Silben nachsprechen können, die weder Formen noch Farben kennen und benennen können, die auch keine Ziffern bis 10 kennen oder bis 10 zählen können.
Die nehmen wir auf, weil sie in der Regel keine Kita besucht haben und demzufolge eine Rückstellung nichts bringt.
Wir nehmen sie auf und fördern ihre Fähigkeiten und Kompetenzen soweit das geht. Diese Kinder werden mit viel Glück die integrierte Eingangsstufe in drei Jahren schaffen. Das gelingt einigen, aber lange nicht allen….
Das ist keine Polemik – das ist das, worum es hier geht. Kernproblem in der Bildung in Deutschland sind die unzureichenden Deutschkenntnisse von Migrantenkindern. Statt aber über Lösungen zu sprechen, die allein im Bildungssystem liegen können (weil eingewanderte Eltern nunmal nicht gut genug Deutsch sprechen, um es ihren Kinder selbst beibringen zu können), wird die Verantwortung hin und her geschoben: von Lehrkräften auf Eltern und wieder zurück, von weiterführenden Schulen auf Grundschulen und von Grundschulen auf Kitas.
Wem soll das etwas bringen?
Herzliche Grüße
Die Redaktion
“Kernproblem in der Bildung in Deutschland sind die unzureichenden Deutschkenntnisse von Migrantenkindern.”
DAS sehe ich komplett anders.
Kernproblem ist die Faulheit vieler in der hundertsten Generation deutschstämmiger Schüler:innen, die einfach …. nichts tun.
Im Unterricht müssen sie schlafen, weil sie sich zu Hause beim Zocken verausgaben – und Schlaf ist ja bekanntlich wichtig.
Und ja – Klasse 8 kann keine Satzschlusszeichen setzen. Denn: Sie verweigern die Mitarbeit (zum Beispiel das Schreiben) im Unterricht (von zu Hause will ich gar nicht reden).
Auch Klasse 9 tut sich schwer – die “Sie können mich nicht zwingen”-Haltung ist ein derartiger Automatismus geworden, dass einem schlecht werden kann.
Sie können … sitzen. Sie bleiben NICHT sitzen.
Auch das ständige Aufsteigen ist nicht immer zielführend. Sie lernen nämlich auch daraus etwas! Sie müssen nichts tun und kommen weiter….
Aber was weiß ich schon? Bin ja erst seit 20 Jahren dabei….
Ich sehe das Problem auch bei vielen deutschen Kindern. Die Rechtschreibung ist katastrophal. Viele Eltern denken Schule und Bildung läuft von alleine. Früher kamen die meisten Eltern zum Elternabend und Hausaufgaben wurden von den Eltern nachgeschaut und Fehler korrigiert. Das findet kaum noch statt, weil man den Eltern erzählt das wäre nicht ihre Aufgabe. Demzufolge korrigiert man kaum noch und der Lerneffekt bleibt aus.
Da benötigt man aber angegliederte Sprachförderschulen, in denen gerade diese Kinder in kleineren Gruppen unter Hilfestellung von Logopäden gefördert werden können.
Sehe ich auch so, aber ist das noch die gewünschte Inklusion, oder doch schon wieder Exclusion? Da dafür ja wieder ein speziell ausgebildeter Sonderpädagoge/Logopäde für eine/ oder gar mehrere kleinere Sonder-Klasse(n) gebraucht würde, nennt man es Exclusion (ganz böse!) und spart Geld. Ganz abgesehen davon, dass Sopäds (und überhaupt Lehrer) ja immer mehr zur Mangelware werden. 🙂
Ich erlebe in den letzten Jahren immer häufiger, dass Kinder mit Migrationshintergrund die deutsche Rechtschreibung besser beherrschen als Kinder ohne Migrationshintergrund. Das hat mE wenig damit zu tun, ob die Eltern verstehen, was wir ihnen über die Basiskompetenzen sagen, sondern ob sie es verstehen wollen.
Frühere Elterngenerationen müssen enorm erziehungstüchtig und lebensklug gewesen sein. Sie brauchten keinen (schriftlichen) Lehrplan, für ihre Kinder und legten ohne Bevormundung durch Experten und sonstige Besserwisser anscheinend weitaus mehr Grundsteine für die Schule und fürs spätere Leben als heute. Und das auch noch bei erheblich höherer Kinderzahl pro Familie!!
Richtig!
Und komisch – aus uns ist was geworden! 😉
Es wäre ja schon geholfen, wenn sich Eltern auf ihre (so sollte es zumindest sein!) Kernkompetenz (spätestens nach dem dritten Kind!) ERZIEHUNG besinnen und diese umsetzen würden.
Dass Eltern ihre Verantwortung – hey, die gibt es tatsächlich! – abgeben, steht ebenfalls nirgends geschrieben und sie machen das ohne mit der Wimper zu zucken.
So könnte ja auch mal der Versuch gestartet werden: “Wir erziehen unser Kind und machen es auf diese Weise zu einem verantwortungsvollen Mitglied der Gesellschaft.”
… man wird ja noch träumen dürfen – wenigstens das!
In den Rahmenplänen Unterstufe der Länder der BRD
Da stehen die Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie Wissen und Können (Normen) geschrieben. Ich weiß, da muss man 16 verschiedene Pläne durcharbeiten, viel Arbeit. 😉
In den Rahmenplänen Unterstufe der Länder der BRD steht, was von Kindern und Eltern zur Einschulung erwartet wird? Selbst wenn: Welchem Elternteil in der “BRD” liegen die Rahmenpläne Unterstufe vor?
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Die stehen allen Menschen auf den Bildungsservern der Kultusminister der Länder der BRD frei zur Einsicht.
Wird auf Elternversammlungen meist bekanntgegeben. Bei Schulen mit einer guten Website gibt es dort häufig einen link.
So schwer ist das nun wirklich nicht.
Eltern, die auf die Bildungsserver der Kultusminister gehen, um dort Informationen über Basiskompetenzen zu bekommen, haben diese Informationen mit Sicherheit nicht nötig.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Soweit ich weiß ist es Eltern nicht untersagt, sich Gedanken darüber zu machen, was SYiE tun müssen, um ihrem Kind einen guten Start ins Leben zu geben, es zu erziehen und sich um das Kind zu kümmern.
Oft scheint mir, dass den Eltern (zunehmend immer mehr) die Basiskompetenzen für eine Elternschaft fehlen.
Deswegen plädiere ich für eine verbindliche Elternschule.
Die braucht man auch nicht explizit niederzuschreiben.
Also bei uns war die Norm, dass wir nicht nur die notwendigen Materialien, sondern auch etwas zu essen mithatten. Wir hatten im Winter festes Schuhwerk und eine Winterjacke an. … So komische Basics eben.
Wenn man sich mit GS-Lehrkräften, insbesondere in der Stadt unterhält, dann ist das manchmal sehr frustrierend, wenn man mitbekommt, worum die sich kümmern müssen.
Meine Theorie lautet deshalb seit einiger Zeit, dass die so viel Projekt- und Freiarbeit machen lassen müssen, weil sie sich um so viele Spezialfälle kümmern müssen. Da können viele Dinge eben nicht mehr angeleitet und unter Aufsicht mit Einhilfen geübt werden.
Eigentlich benötigen die allermeisten GS inzwischen mehrere Helfer*innen, die nicht nur morgens, sondern den gesamten Schultag über unterstützen, indem sie sich um alle nicht den Unterricht betreffenden Fälle kümmern.
Muss ja nirgends aufgeschrieben sein. Aber zu meiner Einschulung war zum Beispiel die Norm, selbst die Schuhe binden zu können, einen Stift ordentlich halten zu können oder auf einer Linie mit der Schere nachschneiden zu können. Darauf habe ich bei meinen eigenen Kindern dann selbstverständlich ebenso geachtet. Das sollten Selbstverständlichkeiten sein. Ich hab noch nie gern gebastelt- mit meinen Kindern zu basteln und ihnen die Freude daran anzusehen, war jedoch sehr schön und einfach meine Aufgabe als Mutter bzw. Vater.
“Muss ja nirgends aufgeschrieben sein.”
Es muss irgendwo festgelegt sein, wenn es Fähigkeiten sind, die den Bildungserfolg eines Kindes tangieren – aber von der Schule nicht vermittelt werden. Wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft. Wir leben ohnehin in einer Gesellschaft, in der die Sozialisation von Menschen höchst unterschiedlich erfolgt: Stadt/Land, West/Ost, Arm/Reich etc. – so zu tun, als müsste jedes Elternteil in Deutschland vom bayerischen Dorf bis Berlin-Marzahn wissen, dass Kinder bei der Einschulung Schuhe binden können sollen (obwohl es heute kaum mehr Schnürschuhe für Kinder gibt), ist vermessen. Und womöglich Teil des Problems. Weil Kompetenzen vorausgesetzt werden, die gar nicht alle Eltern vermitteln können – elaborierte Deutschkenntnisse zum Beispiel. Wenn die die Schule nicht vermittelt, muss es jemand anderes tun. Wer denn?
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Mir ist bewusst, dass es an der Realität vorbei geht, zu glauben, alle Kulturen müssen das gleiche Verständnis von Basisfähigkeiten haben. Leider erlebe ich aber in der Schule auch deutsche Kinder, denen es daran fehlt. Es sollte doch auch einem bildungsfernen Menschen klar sein, dass es günstig ist, wenn ein Kind eine Schleife binden kann. Das nennt sich Menschenverstand. Meine Eltern waren Teenies, als ich geboren wurde und mein Vater hat bis heute keinen Schulabschluss. Trotzdem haben mir meine Eltern die Welt gezeigt…
“Es sollte doch auch einem bildungsfernen Menschen klar sein, dass es günstig ist, wenn ein Kind eine Schleife binden kann.”
Es ist auch günstig, wenn Kinder Einradfahren können. Erscheint in einer Welt, in der es kaum mehr Schnürschuhe für Kinder gibt, aber womöglich ähnlich verzichtbar.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Vielleicht ist das Teil des Problems, wenn nicht priorisiert werden kann zwischen Schuhe binden und Einrad fahren.
Sie äußern mir zu viel rechtfertigendes Verständnis für rasant wachsene Defizite im Wissen und Können unseres Nachwuchses. Wo soll denn Besserung herkommen, wenn von den Kindern immer weniger erwartet und verlangt wird?
Ein Bildungsziel nach dem anderen als unnötig darzustellen, indem man es mit dem unnötigen Erlernen von Einradfahren vergleicht, ist unverständlich. Mir kommt das so vor, als wolle man behaupten, dass Basiskompetenzen und gute Bildung Schnee von gestern seien und die Zukunft unseres Landes auf einer Förderung von Unfähigkeit seiner Menschen beruhe.
“Wo soll denn Besserung herkommen, wenn von den Kindern immer weniger erwartet und verlangt wird?”
Durch Förderung – zum Beispiel in Deutsch als Fremdsprache?!
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Bei uns heißt das DaZ – Deutsch als Zweitsprache. Wir wollen uns ja nicht fremd bleiben, sondern uns annähern…..
Aber tofu – das wird tatsächlich unterrichtet und gemacht.
Es fehlt an: Konzentration, Anstrengungsbereitschaft, dem Willen zu lernen, Respekt, Sozialverhalten, das zum Lernen passt ….
Es fehlen: Stifte, Hefte, Mappen, Frühstück, …
Es fehlt an: Einheften von ABs – auch wenn Mappen da seien sollten, Ordnung, Struktur, Zuverlässigkeit, ….
Wenn’s schon mit der Sprache hapert, ist es vielleicht auch mit der übrigen Motivation nicht so weit her.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
… und wie kann man, Ihrer Meinung nach, die Motivation für Bildung bei Schülern und, vor allem, Eltern erhöhen/fördern? Ich bin mir sicher, die Lehrer geben ihr Bestes, um die Schüler fürs Lernen zu motivieren. Das nützt aber nicht viel, wenn der Wert von Bildung in der Familie nicht erkannt/unterstützt wird. Was können die Lehrer da ausrichten?
Schade, ein paar Ideen wären nicht schlech . Mir fallen leider keine mehr ein, nach 40 Dienstjahren.
Deutsch als Zielsprache, die Sprachschulen sollen ja auch ankommen.
Mehr Fördern statt Fordern ist doch das Rezept seit ca. 30 Jahren. Und was hat es gebracht?
Wie lange soll Fördern denn noch als alleiniges Allheilmittel verkauft werden, bevor sich wieder die Erkenntnis durchsetzt, dass bessere Bildung ohne mehr Fordern nicht geht.
Fördern und Fordern gilt auch für Zuwanderer und für “Deutsch als Fremdsprache”. Ohne die Voraussetzung und Erwartung von Anstrengungsbereitschaft sowohl bei Eltern als auch Kindern ist Fördern für die Katz.
“Mehr Fördern statt Fordern ist doch das Rezept seit ca. 30 Jahren. Und was hat es gebracht?”
Das angebliche “Rezept” hat leider nicht dazu geführt, die Schulen entsprechend auszustatten – weshalb die aktuelle schulische Praxis auch nicht dafür taugt, das Scheitern der Förderung zu postulieren.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Dass Schulen nicht gut genug ausgestattet seien für bessere Bildungsergebnisse, ist inzwischen die 0/8/15-Erklärung und Entschuldigung für alles, was seit Jahren und Jahrzehnten schief läuft.
Dass Fehlanalysen, lebensfremde Richtungsentscheidungen und Ideen aus pädagogischen Wolkenkuckucksheimen ganz wesentlich Mitverantwortung tragen für die Abwärtsspirale des deutschen Bildungswesens, wird tunlichst ausgeblendet oder mit dem Totschlagsargument “Mehr Geld für Schulen” im Keim erstickt.
Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten gibt Deutschland keineswegs zu wenig Geld für Bildung aus. Im Gegenteil, es steht gut da. Nüchterne Pro-Kopf-Zahlen belegen diese Tatsache.
Dann gerne mal die Bildungsausgaben im internationalen Vergleich betrachten.
“Der Anteil der öffentlichen Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag 2022 bei 4,6 Prozent. Deutschland gibt damit im Verhältnis deutlich weniger für Bildung aus als Estland (2020: 6,6 Prozent des BIP), das bei der aktuellen Pisa-Studie im europäischen Vergleich vorne liegt. Auch Schweden (7,2 Prozent), Belgien (6,7 Prozent), Dänemark (6,4 Prozent), Finnland (5,9 Prozent), Frankreich (5,5 Prozent), Großbritannien (5,5 Prozent) und die Niederlande (5,3 Prozent) investieren zum Teil deulich mehr in die Bildung. Spitzenreiter in Europa ist Island mit 7,7 Prozent des BIP, wie Destatis meldet.” Quelle:
https://www.news4teachers.de/2023/12/deutschland-bildungsausgaben-stagnieren-auf-relativ-niedrigem-niveau/
Herzliche Grüße
Die Redaktion
“wenn von den Kindern immer weniger erwartet und verlangt wird?”
Naja, beibehalten des Lehrplans trotz Pandemie, immensen Kita- und Lehrkräftenangel und schlechteren Ausgangslagen daheim (finanziell, sozial und bezüglich Bildung) würde ich jetzt nicht als geringe Erwartung darstellen :/
Die Frage ist halt, WARUM es kaum mehr Schnürschuhe für Kinder gibt…
Schnürschuhe zu binden ist nicht verzichtbar! Schult die Motorik und die Koordination von Auge und Hand. Funktioniert bei vielen Kindern nicht mehr und es wird daher auch nicht mehr geübt. Klettverschlüsse, yeah! Und dann wundert man sich, warum die Buchstaben nicht ordentlich geschrieben werden können.
Und wer sagt’s den Eltern? Offenbar niemand.
“Immer weniger Kinder können ihre Schuhe noch selbst binden.” Quelle: https://www.sueddeutsche.de/bayern/faehigkeiten-von-kindern-rettet-das-schuhbandl-1.1966488
Betrifft übrigens nicht nur Unterschicht-Familien:
“Ihre Kinder können manche Dinge nicht, die früher selbstverständlich waren, stellt unsere Autorin diese Woche in der Familienkolumne ‘Kinderkram’ fest. Schleifen binden zum Beispiel. Und jetzt?” Quelle: https://ga.de/ratgeber/familie/schuhe-binden-und-schreibschrift-was-kinder-heute-nicht-mehr-koennen-v1_aid-111264165
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Doch, wir sagen es den Eltern, wenn diese denn zum Elternabend kommen. Und genau das ist das Problem: sie kommen eben nicht und interessieren sich auch sonst für nix. Die geben die Kinder morgens ab und holen sie abends wieder ab und setzen sie dann vor Netflix. Das finden Sie in Ordnung und haben dafür Verständnis? Wenn man den Alltag in Schule und Kita und den Wahnsinn und das Desinteresse der Eltern tagtäglich erlebt, kann man das nicht mehr so einfach entschuldigen wie Sie, liebe Redaktion, es ständig tun. Welche Verantwortung haben denn Eltern?
“Das finden Sie in Ordnung und haben dafür Verständnis?”
Nein, das finden wir nicht in Ordnung. Wir sind allerdings der Meinung, dass wir hier über sehr viel grundlegendere Probleme reden als über läppisches “Desinteresse” – entsprechend kommen wir hier mit Elternbeschimpfung nicht weiter. Zum Beispiel: “Kinder psychisch kranker Eltern haben ein erhöhtes Risiko, selbst psychische Erkrankungen zu entwickeln. Geschätzt leben ca. 25% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland mit einem psychisch kranken Elternteil zusammen und sind daher gefährdet.” Quelle: https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/compare-risikobewertung-bei-kindern-psychisch-kranker-eltern-7281.php
Wollen Sie Kinder für ihre kranken Eltern bestrafen? Das ist die Konsequenz Ihrer Argumentation – ist ja deren Verantwortung. Das Dumme ist: Sie bestrafen die Gesellschaft gleich mit. Denn die muss am Ende mit den Folgen gescheiterter Bildungskarrieren umgehen.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Das was Sie als ‚läppisches‘ Desinteresse bezeichnen, sehe ich als einen Hauptgrund für die schulischen Probleme vieler Kinder. Klar, gibt es psychisch kranke Eltern und als Lehrer kennt man die Problemfälle und nimmt entsprechend Rücksicht. So professionell sind wir schon, keine Sorge. Wir sehen aber auch ganz viel Unlust sich zu kümmern, Hausaufgaben zu kontrollieren, Material zu besorgen, sich mit dem eigenen Kind zu beschäftigen. Sorry, die können ja nicht alle psychisch krank sein!
Sie haben womöglich Probleme, von denen Sie als Lehrerin nichts wissen: Krankheit, Überschuldung, berufliche Überlastung, Sucht, Traumata… “Unlust” halten wir als Erklärungsansatz jedenfalls für deutlich zu unterkomplex – und am Ende auch für diffamierend und deshalb destruktiv in der schulischen Praxis. Wozu soll das Etikett dienen – ein Feindbild zu pflegen?
Das aktuelle Bild quer durch Deutschland:
“Die Probleme in den Familien werden mehr und vielfältiger”, Quelle: https://www.sr.de/sr/sr3/themen/sr_3-land/die_arbeit_am_neunkircher_jugendamt_100.html
„Vom Alltag erschöpft“: Das sind die fünf größten Probleme von Familien in Berlin, Quelle: https://www.tagesspiegel.de/berlin/vom-alltag-erschopft-das-sind-die-funf-grossten-probleme-von-familien-in-berlin-13677715.html
“Soziale Probleme in Familien nehmen zu”, Quelle: https://www.wochenkurier.info/landkreis-bautzen/artikel/soziale-probleme-in-familien-nehmen-zu
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Das ist sicher alles richtig. Aber wer soll diese Probleme lösen? Die Lehrer der betroffenen Kinder? Ich kann maximal Beratungsstellen empfehlen, wenn ich weiß was für ein Problem die Eltern haben. Und dann? Ich kann weder mit den Eltern zum Therapeuten noch zur Sozialberatung gehen.
Es geht mir nicht um ein Feindbild. Es geht darum klarzumachen, wer die Verantwortung für die Kinder trägt. Und das sind die Eltern. Punkt. Nicht der Lehrer, nicht der Staat. Niemand sonst!
Das ist falsch.
Blick ins NRW-Schulgesetz (ähnlich in den Schulgesetzen der anderen Bundesländer, Hervorhebungen von uns): Paragraf 2, Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule
“Die Schule vermittelt die zur Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Werthaltungen und berücksichtigt dabei die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler. Sie fördert die Entfaltung der Person, die Selbstständigkeit ihrer Entscheidungen und Handlungen und das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl, die Natur und die Umwelt. Schülerinnen und Schüler werden befähigt, verantwortlich am sozialen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, beruflichen, kulturellen und politischen Leben teilzunehmen und ihr eigenes Leben zu gestalten. Sie erwerben Kompetenzen, um zukünftige Anforderungen und Chancen in einer digitalisierten Welt bewältigen und ergreifen zu können.” Quelle: https://bass.schule.nrw/6043.htm#1-1p2
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 19. November 2021: “Aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 GG folgt ein Recht der Kinder und Jugendlichen gegenüber dem Staat, ihre Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit auch in der Gemeinschaft durch schulische Bildung zu unterstützen und zu fördern (Recht auf schulische Bildung).” Quelle: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/11/rs20211119_1bvr097121.html
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Richtig, ich erfülle meine Bildungs-und Erziehungsauftrag… und das gewissenhaft seit 25 Jahren. Das ist meine Arbeit! Ich bin aber nicht persönlich verantwortlich für die Kinder und die Zukunft dieser Kinder. Die Eltern haben diese Verantwortung. Wenn der Nachwuchs dann irgendwann groß ist, müssen sich viele Eltern die Frage stellen lassen: ‚Warum hast du dich nicht mehr um mich gekümmert? Dann wäre ich jetzt … was auch immer….‘ Diese Frage muss ich nicht beantworten. Nicht meine Verantwortung!
Na, immerhin können Kinder kostenlos zur Schule gehen, mal eben 10000€ pro Jahr und Kind. Und eine Unterstützung und Förderung bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Staat eine Garantie zur Entwicklung einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit gleich mitliefert. Dies würde dem Kern der Eigenverantwortung wohl auch widersprechen.
Dementsprechend werden hier Voraussetzungen diskutiert, damit Schulen überhaupt einigermaßen erfolgreich arbeiten können. Und für gewisse Voraussetzungen sind Eltern verantwortlich, ob sie wollen oder nicht, sogar selbst, wenn ihnen suggeriert wird, dass die Vollzeitbeschäftigung sie von dieser Verantwortung entbinden würde.
Für 10.000 Euro pro Jahr und Kind lässt sich auch eine Privatschule finanzieren, die deutlich günstigere Bedingungen als das staatliche Schulsystem bietet.
Das legt schon die Frage nahe: Was macht der Staat eigentlich mit dem Geld – ist das staatliche Schulsystem wirklich effizient organisiert? Darf man durchaus bezweifeln.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Die Effizienz des deutschen Bildungssystems könnte man schon relativ einfach durch die Abschaffung des Föderalismus (in diesem Bereich) erhöhen.
Der größte Posten sind die Personalkosten. Ohne es genau zu wissen, meine ich, dass Lehrer an Privatschulen tendenziell weniger verdienen (,vielleicht bei geregelteren Arbeitszeiten, vielleicht nicht).
Tun sie tatsächlich oft. Privatschulen müssen allerdings (wie alle Unternehmen) auch darauf achten, Personal kosteneffizient einzusetzen – heißt: arbeitsteilig. Da muss dann keine Lehrkraft Pausenaufsicht übernehmen oder Pflaster kleben. Das übernehmen dann (billigere) Assistenzkräfte. Den Staat kümmert das weniger.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Also dann, nur noch solche tollen Privatschulen (wie Ihr Einzel-Beispiel und Arbeitsbedingungen für Lehrer, wie im letzten Kommentar von Ihnen) – dann sind die Bildungsprobleme in DE gelöst! Warum macht man das dann nicht gleich und sofort? Was spricht dagegen?
In den Niederlanden sind 70 Prozent aller Schulen Privatschulen – und bei PISA liegen die Niederlande seit 20 Jahren vor Deutschland. Könnte einen Zusammenhang geben.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
… und wer geht auf die restlichen 30% der Schulen und wie schneiden diese Schüler bei PISA ab? Kann man dann noch von Bildungsgerechtigkeit/Chancengleichheit sprechen?
Ja, weil alle Schulen – staatlich oder privat – unter staatlicher Aufsicht stehen und weitgehend vom Staat finanziert werden. Was mit dem Geld gemacht wird, ist dann aber eben Sache der Schulen. Gerne hier nachlesen: https://www.campus-schulmanagement.de/magazin/wissenschaft-und-schule-eng-verzahnt-impulse-aus-den-niederlanden-coly-friedrich
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Warum sind dann nicht 100% der Schüler auf Privat-Schulen bzw. alle Schulen Privatschulen? Wie hoch ist der finanzielle Beitrag der Eltern bei den Privat-Schulen? Wo ist da der Unterschied zu den staatlichen? Und wie schneiden die staatlichen Schulen bei PISA ab? Meine Frage, wie es mit Bildungsgerechtigkeit/Chancengleichheit für alle Schüler in den NL aussieht haben Sie noch nicht beantwortet.
Für mehr Autonomie der Schulen wäre ich schon, aber nicht für ein Zwei-Klassen-Schulsystem – Privatschulen vs. “Resteschulen”.
P.S.: Apropos 30% staatliche Schulen in den NL, in Berlin 25% der Schulen eine Brennpunktschule (jede 4.). Machen wir aus Dreiviertel der Schulen in Berlin einfach auch Privatschulen und 25% staatliche Schulen. Haben wir dann auch solche Erfolge bei PISA wie die NL? Soll das die Lösung sein? Viele Eltern (75%) wären sicher dafür und der “Rest” geht eben auf die staatlichen Schulen.
@Redaktion So ganz (außer bei Autonomie) kann ich Ihren Argumenten pro Privatschulen nicht folgen. Sie bemängeln doch sonst immer, dass sozial- benachteiligte Schüler in unserem Schulsystem benachteiligt werden und möchten, dass alle möglichst lange zusammen lernen und es keine Separierung gibt.
Ich habe versucht mehr über die staatlichen Schulen der NL zu erfahren. Leider fand ich auf die Schnelle nichts aussagekräftiges. Ich kann also nur vermuten:
Kann es sein, dass an den Privatschulen überwiegend Schüler aus einem “bürgerlichen Umfeld” mit “elaborierten Sprachkenntnissen” lernen? An den staatlichen Schulen dann eher Schüler aus dem Brennpunkt ohne “elaborierte” Sprachkenntnisse und aus prekären Verhältnissen?
Ich wählte bewusst diese (unterstrichenen) Begriffe aus dem Wortschatz der Redaktion. 🙂
@Redaktion – Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Vielleicht haben Sie eine Quelle dazu, denn Sie scheinen ja das Beispiel der NL gern auf DE übertragen zu wollen (meine Wahrnehmung Ihrer Kommentare).
Schade, auch hier keine Antworten! Also, nur “ideen”, die erst einmal “toll” klingen. Tut mir leid, dass ich so viel frage. Das wurde mir schon zu DDR-Zeiten vorgeworfen, dass ich zu viele Dinge “hinterfrage”. Scheint irgendwie in meiner “DNA zu stecken”, wie es so bescheuert auf neu-deutsch heißt. 🙂 Komisch, dass das auch heutzutage ein Problem ist. Mein Therapeut (ein Wessi) hat mich gewarnt – er hat leider recht.
Wir kennen eine Privatschule, die ohne staatliche Zuschüsse auskommt und für eine Jahresgebühr von rund 15.000 Euro einen Ganztagsbetrieb und Klassen mit acht bis höchstens 15 Schülerinnen und Schüler garantiert – das sind bessere Bedingungen als an einer staatlichen Schule.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
“Die Probleme in den Familien werden mehr und vielfältiger”
„Vom Alltag erschöpft“
“Soziale Probleme in Familien nehmen zu”
Genau das beobachten und benennen Lehrer seit vielen Jahren! Warum ist das so? Das wäre doch die eigentliche Frage.
Sicher gab es solche Familien auch schon früher, aber warum nimmt die Zahl zu und das obwohl immer weniger Kinder in DE geboren werden? Was läuft da falsch in unserer Gesellschaft?
Schleifen braucht man nicht nur für die Schuhe!
Der Begriff “Schulreife” wird jetzt eher als “Schulfähigkeit” bezeichnet. Er umfasst aber einige Voraussetzungen, die ein Kind zur Einschulung haben sollte:
https://www.bildungsserver.de/elementarbildung/schulfaehigkeit-was-ist-das-vorbereitung-der-einschulung-in-der-familie-2667-de.html
Erstens, welche Eltern bekommen diese Handreichung?
Zweitens, was sollten zum Beispiel Eltern mit Migrationshintergrund, die selbst kaum Deutsch sprechen und (wie viele Migrantenfamilien) keinen Kita-Platz bekommen, mit solchen Hinweisen anfangen: “Wichtig für einen erfolgreichen Schulstart sind insbesondere ein guter Wortschatz und ausreichende grammatikalische und kommunikative Kompetenzen. Alle genannten Kompetenzen sollte das Kind sowohl aktiv beherrschen als auch verstehen können”?
Sorry, das ist Blödsinn – es hilft niemandem. Wer das lesen und beherzigen kann, braucht es nicht.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Dann muss die Schulfähigkeit aller Kinder rechtzeitig vor der Einschulung überprüft werden und bei “Mängeln” muss dann verpflichtend die Vorschule besucht werden. (egal ob Migrationshintergrund oder nicht). Und die Kitas müssten verpflichted werden, auch an diesen Kompetenzen zu arbeiten, dann würden schon mal wenigstens alle, die eine Kita besucht haben, diese Fähigkeiten vor der Schule erwerben (was nicht jede Kita macht) und die GS könnten von Anfang an ihrer Kernaufgabe gerecht werden und müssten nicht mindestens ein Jahr “vertrödeln” um alle Kinder auf ein ausreichendes Niveau zu bringen.
Könnte man so machen. Herzliche Grüße Die Redaktion
Passiert aber nicht. Weil weder Geld noch Personal dafür da ist.
Ist zu teuer…..
Zu “teuer” gibt es nicht. Deutschland hat (ja, immer noch) eine riesige Wirtschaftskraft und Steuereinnahmen, die uns offenbar das Verprassen erlauben.
Geld für Bildung KANN ausgegeben werden. Der Preis ist da nicht das Problem 😉
Sagen Sie das den zuständigen Politikern.
Politiker und zuständig – selten so gelacht. Zeigt doch jeder PUA, eine Verantwortlichkeit für watt auch immer kann nicht eindeutig nachgewiesen werden. Die einen (Opposition) sagen so, die anderen (Parteifreunde) sagen so. Damit ist dann der gemeinsame Abschlussbericht hinfällig. Alternative, der PUA wird über die gesamte Legislatur verschleppt und ist mit der Eröffnung des neuen Parlaments obsolet.
Es wäre einfacher, wenn ich im Forum nicht beginnen müsste, erstmal mit denen zu schreiben, welche die Falschaussagen der Politik übernehmen.
Aber ein Haushalt ist nicht gottgegeben, sondern gewollt. Wenn “kein Geld” da ist, will der Staat keine Steuern erhöhen/ einführen, Subventionen kürzen/ streichen und/ oder keine Kredite aufnehmen.
Deutschland gibt Milliarden aus und doch, oh Wunder, kratzt die Mehrheit dann lieber am Existenzminimum anstelle wortwörtlich optionaler Ausgaben ^^
“…welche Eltern bekommen diese Handreichung?”
Frühere Generationen verschiedenster Kulturen wussten, und viele wissen es noch, was Kinder in welchem Alter selbständig können (sollten). Mag sein, dass es geringe Unterschiede in den Kulturen gibt, aber eine gewisse Selbständigkeit, motorische und sprachliche Fähigkeiten und Umgangsformen im sozialen Zusammenleben wurden von den Familien und Eltern den Kindern altersgerecht beigebracht und von der Gesellschaft erwartet. “Das Dorf” = die Gesellschaft achtete darauf und mischte sich gegebenenfalls auch mal ein. Warum ist das in unserer Gesellschaft immer weniger der Fall?
Einräder sind teuer……
Aber schon klar – Eltern machen ihr Ding, wir dann zum Glück das, was für die Kids wichtig und richtig ist.
Frühstück, Mittag, Abendbrot, Übernachtungen in der Schule – viele schlafen da bestimmt mehr als zu Hause….
Ich bin ja sowieso dafür, dass die Hälfte des Kindergeldes in die Institution geht, in der sich das Kind gerade befindet.
Dann könnten sich Fremde besser um die Kinder mit leiblichen Eltern kümmern.
Komische Welt, in der wir leben.
“Also soll es Ihrer Ansicht nach gesetzliche Vorgaben (für wen: die Eltern?) geben, welche Fähigkeiten ein Kind bis zum Grundschuleintritt haben sollte?”
Es kann keine gesetzliche Vorgaben für etwas geben, was manche Eltern gar nicht vermitteln können: Deutsch zum Beispiel. Da wäre eine Kita-Pflicht (die dann ja auch für den Staat gelten würde) schon zielführender.
Woher kommt eigentlich diese fixe Idee, dass sich Eltern von Lehrkräften “alles abnehmen” lassen wollen? Würde den meisten wohl schon reichen, wenn die Schule das vermittelt, was sie dann von den Kindern verlangt.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Es geht weder um alle noch um die Mehrheit der Eltern.
Diejenigen, die das erwarten sind insgesamt aber so viele, dass Lehrkräfte so viele ihrer Kapazitäten in deren Nachwuchs stecken müssen, dass alle Kids darunter leiden.
ES GEHT HIER DOCH NICHT NUR UM DEUTSCH!
Warum beißen Sie sich daran so fest?
Weil mangelnde Kompetenzen in der Bildungssprache (sic!) Deutsch das Kernproblem in der Bildung in Deutschland ist – wie sogar schon die Kultusminister erkannt haben. Gerne hier nachlesen: https://www.kmk.org/aktuelles/artikelansicht/oldenburg-swk-empfehlungen-zur-sprachlichen-bildung-fuer-neu-zugewanderte-kinder-und-jugendliche-bieten-wichtige-impulse-fuer-die-kuenftige-arbeit.html
Herzliche Grüße
Die Redaktion
“Oder verbindliche ‘Übergabestandards’ an den Schnittstellen Kita – Grundschule – weiterführende Schule festlegen?”
Wären wir dabei – wobei geklärt sein müsste, was passiert, wenn diese Standards nicht eingehalten werden: Förderung nämlich (und kein Blame Game).
Herzliche Grüße
Die Redaktion
… und wer legt diese “Übergangsstandards” fest, wer überprüft entsprechend die Kinder und wer ist verpflichtend für die notwendige Förderung zuständig?
Allerdings scheitert das derzeit doch schon beim Übergang von GS zu weiterführender Schule, wenn ich so an Artikel der letzten Wochen hier bei n4t denke 🙂 Warum sollte es dann beim Übergang Kita zur GS anders/besser sein?
Und wer fördert?
Eine Schule, die entsprechend personell aufgestellt ist. Herzliche Grüße Die Redaktion
Ach, so was gibt´s? Bis jetzt bin ich ja der Meinung, dass Lehrermangel bedeutet, dass die Kollegen und Kolleginnen am Ende des Unterrichtstages geplättet nach Hause wanken. Das ist doch die Aufgabe einer Mangel. Menno, die deutsche Sprache ist aber auch missverständlich.
Wir arbeiten daran 🙂 Herzliche Grüße Die Redaktion
Wir sind leider nicht entsprechend personell aufgestellt.
Eher betreuen wir zwei Klassen gleichzeitig.
Oder ein verpflichtende Vorschulkindergarten.
Da es das Personal aber nicht gibt, sind das nur Wünsche und Träume. Aber solange geben wir unser Bestes!
Schulen werden aber, absehbar, in den nächsten (in vielen?) Jahren nicht besser personell aufgestellt sein. Was ist mit den Schülern, die jetzt und in den nächsten Jahren zur Schule gehen? Was geben diese später an Bildungsmotivation und Erziehung an ihre Kinder weiter?
Ach, habe ich doch glatt vergessen – das brauchen die ja nicht, das machen, wie bisher auch schon, die Schulen, dann halt nur noch mehr!
Schulen werden schon von selbst (Geburtenknick!) bald besser personell aufgestellt sein, vor allem die Grundschulen. Es geht darum, politischen Druck zu entfalten – damit diese Situation dann nicht wieder genutzt wird, um das Personal zusammenzustreichen. Stichwort: “Demografische Rendite”. Hatten wir schon mal.
Gerne hier nachlesen: https://www.news4teachers.de/2025/06/lehrermangel-ade-geburtenrate-bricht-ein-den-kitas-und-grundschulen-gehen-absehbar-die-kinder-aus/
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Ich habe da leider wenig Hoffnung, denn schon jetzt wird Personal bis zur Schmerzgrenze eingespart, benötigte Stellen nicht ausgeschrieben. Auf die letzte Ausschreibung des Schulamtes haben sich immerhin 28 Vollerfüller beworben, eingestellt wurden 10….die anderen 18 stehen nun als Vertretungskräfte zur Verfügung, wie unserer Schulrat zynisch meinte….
Geburtenknick? – okay – kommt drauf an, wo und welche Statistiken man wie betrachtet. Folgender Artikel eignet sich vielleicht auch für eine Mathestunde zu Statistik: 🙂
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/baby-boom-in-spandau-warum-es-so-viele-neugeborene-im-berliner-westen-gibt-13646104.html
Das mit dem Rechtschreibtest bei der Polizei erzählte uns ein Quereinsteiger, der aus gesundheitlichen Gründen nicht in den Polizeidienst übernommen wurde, vor ca. 6 Jahren. Er konnte damals schon nicht glauben, wieviele Rs-Fehler erlaubt waren, um die Prüfung zu bestehen. 🙂
Ist doch nicht neu.
Polizei soll den Unfall vor dem Gymnasium aufnehmen, fragt der eine Beamte den anderen, wie denn Gymnasium geschrieben wird. Kurzes Nachdenken, dann die Erleuchtung. Sie tragen das Opfer zur gegenüber liegenden Post
🙂 Stimmt, der ist schon ziemlich Asbach—
Wie sagt der Volksmund daraufhin:
Wer nix ist und wer nix kann,
geht zur Post und Eisenbahnbahn.
Ehedem gab es im Polizeidienst alles vom einfachen Beamten im Wachdienst (Polizeiwachtmeister) über den mittleren Dienst (Polizeimeister), gehobenen Dienst (Polizeikommissar) bis zum höheren Dienst (Polizeirat). Genannt sind nur die Eingangsämter.
Den Wachdienst im einfachen Dienst (Arbeiter) gibt es nicht mehr. Die Ausbildung im mittleren Polizeidienst (blaue Rangabzeichen) gibt es in einigen Bundesländern und bei der Bundespolizei. In anderen Bundesländern – so z.B. NRW – gibt es bei der Landespolizei lediglich den gehobenen (silberne Sternchen) und den höheren Dienst (goldene Sternchen). Beide Laufbahngruppen setzen einen Studienabschluss voraus, es bedarf also beim Einstieg als Anwärter mindestens der FHR bzw. der AHR – und da sollte die Rechtschreibung einigermaßen sicher sein.
Für die Ausbildung im mittleren Dienst ist die Fachoberschulreife zwingende Voraussetzung. Und da sollte Rechtschreibung ebenfalls kein Problem sein – weder bei Polizisten noch bei Verwaltungsfachangestellten.
Richtig, der Kollege hatte sich aber für die “Sternchen” beworben und sprach von den Anforderungen in Rs in dieser Laufbahngruppe. 🙂 nicht von einfachen Wachtmeistern.
Sternchen haben auch die PM, POM, PHM und EPHM.
Wer die silbernen ergattern möchte sollte etwas von der Fauna, speziell dem Orthogravieh verstehen und von Interpunktieren. Und das selbst als bewaffneter Schülerlotse aka Feldjäger.
Essen, trinken, gesunde Ernährung, gesundes Umfeld zu Hause, nicht ständige Partnerwechsel (heute sind es Brüder, morgen nicht mehr…. ), gesunde Eltern, funktionale Familien/Lebensgemeinschaften, Unterstützung, trösten, genügend Schlaf, …..
Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht ganz so neu ist.
Ansonsten: ENDLICH ELTERNSCHULEN!
Kurz: Sie verlangen von Familien ein bürgerliches Umfeld – das aber gerade Familien in Brennpunkten nicht haben, weil sie sonst ja nicht im Brennpunkt leben würden.
Sorry, der Anspruch “funktionale Familien/Lebensgemeinschaften” ist geradezu absurd. Genauso gut könnten sie einen “Verzicht auf Unglück” oder einen “Verzicht auf Armut” postulieren.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Sorry, meine Großeltern waren das, was man heute als sehr arm bezeichnen würde. Sie haben aber dennoch ihre Kinder und Enkel gut versorgt, erzogen und eine Riesenportion Bildung angedeihen lassen. Und das, obwohl es damals keine Essenstafeln, Secondhandläden, kostenlosen Büchereien, Bildungsgutscheine etc gab.
Wenn man will, geht das!
Vor allem heutzutage!
Ich hab aber den Eindruck, dass so mancher darauf gar keinen Wert legt (z.B.Bildung an sich ist heute einfach nicht mehr wichtig, sondern der Schulabschluss, der es ermöglicht einen Job zu haben, der viel Geld einbringt).
Wir vermuten, dass Ihre Großeltern nicht im Hier und Jetzt ihre Kinder und Enkel zu versorgen haben – und auch nicht im Brennpunkt lebten. Wir wissen darüber hinaus, dass, selbst wenn es so war (die eigene Wahrnehmung muss ja nicht immer richtig sein), der Einzelfall nichts über alle anderen aussagt (Stichwort: anekdotische Evidenz).
“Wenn man will, geht das! Vor allem heutzutage!” – offensichtlich ja nicht, sonst hätten wir keine Bildungsprobleme in diesem Land. Anderen Menschen (schwächeren!) schlicht “Unwillen” zu unterstellen, ist natürlich die leichteste aller Übungen. Und lässt auch nicht auf geistigen Tiefgang schließen.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Also war es früher für viele Eltern, Großeltern und Kinder einfacher/besser als heute? Oder was wollen Sie sagen? Die Menschen hatten früher weniger Sorgen/Problme/Existenzängste? Dann wird es Zeit, mal die Ursachen der heutigen Probleme zu analysieren und diese zu beseitigen!
Nein, es war nicht besser als heute – es war anders. In Westdeutschland zum Beispiel waren wesentlich weniger Frauen als heute erwerbstätig. Wollen Sie das zurückdrehen – Frauen zurück an den Herd? Es war auch zum Teil einfacher, allein schon wegen der Sozialstrukturen: Welche Familie mit Kindern hat denn heute überhaupt noch Großeltern, die in erreichbarer Nähe leben und sich um die Erziehung mitkümmern? Auch das lässt sich kaum zurückdrehen: Modernes Leben verlangt Mobilität. Mobilität aber führt zwangsläufig zu Kleinfamilien.
Jeder einzelne kann für sich entscheiden: Mache ich den Wettlauf mit – oder geht’s auch eine Nummer kleiner und ruhiger? Muss man sich aber, erstens, auch leisten können. Und, zweitens, ist allein schon die Freiheit, sich für eine Lebensform entscheiden zu können, viel wert. Die hatten die meisten Menschen früher nicht.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Sie bestätigen mit Ihrem Kommentar, dass wir zumindest mehr Lehrerpersonal in den Schulen benötigen, um wichtige Grundkenntnisse zu vermitteln, damit die Kinder den Herausforderungen eines gewollt eigen initiativen Lernen gerecht werden können.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Theorie_der_kognitiven_Entwicklung_nach_Piaget oder U-Untersuchungen/ Ärzteblatt?
Welche Basisfähigkeiten erwarten Sie von Ihren Mitarbeitern?
Zuverlässigkeit, Beherrschung der RS, Pünktlichkeit, Kenntnisse in Grammatik,….. ?
Wir beschäftigen keine Erstklässler. Herzliche Grüße Die Redaktion
Ein schönes Argument für mehr Chancengerechtigkeit anstatt sich die nächsten Jahre fruchtlos über ausbleibende Eigenverantwortung aufzuregen
In Deutschland können immer noch rund 20 Prozent der 15-Jährigen nicht richtig lesen und schreiben. Hier hängt der Bildungserfolg immer noch viel mehr vom Elternhaus und von der Frage ab, wie oft dort mit Kindern gesprochen und ihnen vorgelesen wird, als vom fortschrittlichsten Unterrichtskonzept.
Viele Kinder kommen schon mit fehlenden Basisfähigkeiten (= fehlende Schulreife) in die Grundschulen.
Zustimmung!
Ich habe den Eindruck, dass die nicht selten weitergehen müssen.
Ähnliches sahen wir ja bei der Grundschule, wo es eine kleine Sensation war, wirklich alle Erstklässler*innen wiederholen zu lassen, um die Grundlagen zu erwerben.
Wir brauchen mehr Kapazitäten/ Plätze an Kitas und Primarstufen!
Ich wünsche mir darüber hinaus ein Vorschuljahr (siehe Niedersachsen) für alle Kinder, die die Basisfähigkeiten bis zur Einschulung nicht erlangt haben.
Ja, das wünsche ich mir auch und kann nicht verstehen, warum es nicht längst da ist.
Wieso wundert Sie das? Der sog. Schulkindergarten wurde doch erst 2003 in NRW zugunsten der integrierten Eingangsstufe abgeschafft. Die damals dort beschäftigten Sozialpädagogen sind unsere heutigen SoFas.
Genau wie bei der Inklusion ging man davon aus, dass es doch super ist, wenn die nicht schulreifen Kinder im Klassenverband gefördert werden und dafür ein Jahr länger Zeit bekommen. Als dann viele Schulen zuviele Kinder das erste Schuljahr wiederholen ließen, wurde es kurzerhand untersagt, dass Kinder nach dem ersten Schuljahr zurückgehen durften. Auch das Zurückstellen von Kindern von der Einschulung durfte nur bei schwersten Erkrankungen erfolgen und man musste als Eltern Gutachten beibringen. Eine einfache Entwicklungsverzögerung reichte da nicht aus. Gleichzeitig wurde das Einschulungsalter immer weiter nach vorne gezogen. Der Plan war den Stichtag langfristig auf den 31.12 vorzuziehen…..davon sah man glücklicherweise dann ab….und das ganze in Korrelation mit G 8……Man stelle sich das mal vor….
Und warum das Ganze? Man spart Kosten…..Es geht wie immer nur ums Geld…..jedes Extrajahr, was Kinder in Schule verbringen kostet immens Geld.
Übrigens auch Förderschulen kosten sehr viel mehr Geld als Regelschulen, inclusive Beschulen ist für einen Bruchteil zuhaben…..Stuhl dazu eben….glauben Sie allen Ernstes, dass da das Menschenrecht Stein des Anstoßes wäre. Wenn dem nämlich so wäre, dann hätte man die GL Schulen weitaus besser ausgestattet….zu der Zeit gab es nämlich noch genug Personal….
Sorry, ich kam noch Höckchen auf Stöckchen…..
Manchmal bin ich noch so naiv zu glauben, dass es nicht nur ums Geld geht.
Hamburg Z.B. hat das Hamburger Modell, was beinhaltet, dass Kinder, die nicht über die benötigten Basiskompetenzen verfügen, verpflichtend ein Vorschuljahr machen müssen. Die aktuelle Forderung ist, dass sich dem auch andere Bundesländer anschließen mögen. Das vorgeschobene Argument dagegen ist, dass Hamburg ein Stadtstaat sei und dies dort einfacher umsetzbar sei, dies sei in anderen Bundesländern ein riesiges strukturelles Problem….komisch, dass Niedersachsen (ziemliches großes Bundesland mit großen Städten und kleinen Dörfern) es auch schafft, einen Schulkindergarten vorzuhalten. Auch haben die Eltern die Wahl, ihre in einem bestimmten Zeitraum geborenen Kinder, in die Schule zu schicken oder nicht….
Es ginge also…..es wäre nichtmal besonders aufwändig, denn fast jede Schule hat ja SoFas und es müsste auch nicht jede Schule soetwas anbieten….der Bedarf könnte das Angebot regeln.
Merken Sie was? Es würde Geld kosten, die Vorschule oder den Schulkindergarten wieder einzurichten, daher argumentiert man so.
Es liegt sehr wohl AUCH an der Überfrachtung des Lehrplans.
Naja, da wird ja auch noch davon ausgegangen, dass Unterricht in der Unterrichtsstunde machbar ist – Tatsache: Oft müssen Streitereien, Ausflüge, …. geplant und besprochen werden, es dauert lange, bis angefangen werden kann, Konzentrationsprobleme, Orga vorweg, weil die Hälfte ihre Materialien nicht findet, Stifte fehlen, Geld wird über Wochen eingesammelt, ….
Und es wird i.d.R. davon ausgegangen, dass SuS Hausaufgaben machen.
Das ist zumindest bei uns schon lange nicht mehr der Fall. Wir freuen uns, wenn sie ihre aktuellen Schulsachen möglichst vollständig dabei haben – JUBEL!
In 150 U-Stunden kann man tatsächlich viel schaffen – auch mit Spaß und Freude, sogar nachhaltig.
Das geht aber nur, wenn … und damit geht es nicht und die LPs erscheinen dick und voll.
Die Überfrachtung des Lehrplans in Deutsch in der Grundschule ist seit Jahrzehnten ein offenes Geheimnis. Für einen großen Teil der Schüler reichen die Übungszeiten nicht.
Das sehe ich anders. Der LP Deutsch ist eigentlich nicht überfrachtet. Da geht es um grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten des Sprechens, Lesens und Schreibens. Ich wüsste nicht, was wir weglassen könnten.
Also in unserem Bundesland fiel mir das schon sehr lange auf. Als Lehrerin, dann als Mutter von vier Kindern. Außerdem bin ich mit meiner Ansicht nicht alleine.
Hätte ich akribisch den Lehrplan abgearbeitet, hätte ich überhaupt nicht genug Zeit für Rechtschreibung gehabt. Mir waren alle Schüler wichtig, nicht nur diejenigen, denen das sowieso leicht fällt. Ich hätte keine Zeit gehabt für die Aufgaben, die Potschemutschka nennt. Oder für systematisches Üben der Rechtschreibung, oder regelmäßige Übungsdiktate.
Um diese Aussage zu belegen, müsste wohl eine wissenschaftliche Studie die Lehrpläne verschiedener Jahr(zehnt)e und Bundesländer vergleichen. Das Ergebnis würde mich wirklich interessieren.Warum wurde das eigentlich noch nicht gemacht?
https://bbf.dipf.de/de/sammeln-entdecken/besondere-bestaende-sammlungen/lehrplaene
Persönlich konnte ich bisher nur die D-Lehrbücher/Arbeitshefte DDR und Berlin (seit 1990) für die GS vergleichen. Ich hatte dabei nicht das Gefühl, dass die überfrachtet sind. Mit der fehlenden Übungszeit gehe ich aber mit. An Lückentexten und Ausmalbildern, bzw. dem Verbinden (Striche ziehen) von Wort zu Bild u. ä. Spielerchen kann man die Rechtschreibung nicht üben. Das Abschreiben von Sätzen, oder gar ganzen Texten, kommt so gut wie nicht mehr vor. Wird nicht mehr gebraucht, gibt ja Rs-Korrekturprogramme. Also wozu Rechtschreibung überhaupt noch lernen und üben?
(Sarkasmus)
Eben, gerade Abschreib- und Aufschreibübungen sind sehr wichtig und kommen zu kurz.
Überfrachtung des Lehrplans bedeutet: Masse statt Klasse. Mit mangelhafter Schulbildung in den Kernbereichen Lesen, Schreiben und Rechnen verlassen die jungen Menschen dann die Schulen und gehen gehandicapt ins weitere Leben.
Wie werden denn Lerninhalte den Kindern in Grundschulen vermittelt ?
Erfolgt die Vermittlung bei Kindern mit einer wenig in Richtung eigenständigen Arbeiten entwickelten Persönlichkeitsstruktur, die auch noch Konzentrationsstörungen aufweisen, strukturiert ? Unstrukturierte Kinder benötigen sehr vielmehr Aufmerksamkeit und diese haben auch einen sehr viel größeren Unterstützungsbedarf als strukturierte Kinder. Kann man unselbständigen Kindern mit Lernmaterialen zum selbstständigen Lernen gut weiter helfen ? Wohl nicht. Und wie machen sich Kindern mit auditiven Wahrnehmungsstörungen beim lautorientierten Schreiben ? Das funktioniert doch nur marginal. Da erfolgt dann kein systematisches einüben. Es bedarf an mehr Personal.
Am besten wieder der Kommentar dieser Mutter. Diese war natürlich an allen Tagen von Klasse 5-9 dabei und kann das natürlich beurteilen, wie oft irgendwas gemacht wurde.
Der Kommentar kam von mir, selbst Deutschlehrerin.
Ich habe sehr wohl Kenntnis dessen, was meine Tochter im Deutschunterricht durchnimmt, denn ich sehe die Hefteinträge und die Arbeitsblätter. Außerdem spreche ich mit meiner Tochter und habe den direkten Vergleich, was meine andere Tochter an der Realschule in Deutsch macht – hier gibt es tatsächlich regelmäßig Unterrichtssequenzen zum Lernbereich Rechtschreibung.
Ich hatte extra nicht pauschal geurteilt, sondern erwähnt, dass das an der Schule meines Kindes so ist.
Es geht doch gar nicht um den Inhalt, sondern um Eltern-Bashing.
Sorry, aber offensichtlich haben Sie nicht richtig hingeguckt. In der Erprobungsstufe (NRW) gibt es mindestens eine Unterrichtsreihe zum Thema Rechtschreibung, die an den meisten Schulen einen Umfang zwischen 12 und 16 Stunden haben wird. In anderen Bundesländern wird es ähnlich sein.
Damit sind die angeblich nur 10 Schulstunden zum Thema Rechtschreibung in 5 Jahren schon in der Erprobungsstufe übertroffen.
Wenn man sich anschaut, mit welchen Rechtschreibkenntnissen Schüler:innen die Grundschule verlassen, kann man sicher nicht davon sprechen, dass die Grundschulen in der Vermittlung der Rechtschreibung erfolgreich sind.
Wenn bis zur 3.Klasse die Vermittlung des Lesen nicht automatisiert erfolgt ist, so erlernen die Kinder diese Fähigkeit mit sehr großer Wahrscheinlichkeit später auch nicht mehr, und die Fähigkeit sich Wissen durch lesen anzueignen ist deutlich geringer ausgeprägt bei schwachen Lesern als bei automatisiert lesenden Schülern. Das ergaben zumindest Studien von Keith Stanovich & Anne Cunningham, siehe Matheus-Effekt.Hier ist ein Zitat von Stanovich:
“Langsames Lesen hat kognitive, verhaltensbezogene und motivationale Konsequenzen, die die Entwicklung anderer kognitiver Fähigkeiten verlangsamen und die Leistung bei vielen akademischen Aufgaben beeinträchtigen. Einfacher ausgedrückt – und traurigerweise – in den Worten eines tränenreichen Neunjährigen, der bereits fällt frustrierend hinter seinen Kollegen beim Lesen Fortschritt: “Lesen beeinflusst alles, was Sie tun.” (Adams, 1990, S. 59–60) (Von der Wrightslaw.com-Website.)”Der Matthew-Effekt und warum Lesen für Kinder entscheidend ist
Was wir als eine Möglichkeit in Betracht ziehen sollten, das sind Lesepaten, die Kindern ab der ersten Klasse helfen, das automatisierte Lesen zu erlernen. Kinder mit auditiven Wahrnehmungsstörungen benötigen zusätzlich eine logopädische Therapie.
Woher nehmen wir die vielen benötigten Lesepaten?
Eine andere Möglichkeit wären noch “Schulhunde”.
https://www.stiftunglesen.de/informieren/unsere-themen/hundgestuetztes-lesen
Aber auch das ist kompliziert. Vor ein paar Jahren wollte eine Kollegin ihren Hund als Schulhund ausbilden lassen. Aber die Bürokratie und vor allem die Kosten für die Ausbildung (die hätte sie nämlich komplett alleine tragen dürfen), und auch die komplizierten Versicherungsregeln, haben sie dann davon abgehalten. Sie hatte den Hund hauptsächlich für unsere ESE-Schül.zur Beruhigung gedacht, aber auch zum Lesen üben u. a.
https://praxistipps.focus.de/schulhund-wissenswertes-ueber-das-paedagogische-konzept_177665#:
Wie so oft: gute Ideen und Eigeninitiative werden durch Bürokratie und wegen der fehlenden Finanzierung ausgebremst.
Denselben Fall hatten wir auch. Wirklich schade.
Ja, wirklich schade! Ein Schulhund würde sicher viele Schüleraugen zum Leuchten bringen.
Stimmt! Wir werden dem nicht gerecht! Schon lange nicht mehr.
Wir brauchen mehr Zeit für die grundlegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten und neben dem Lesen (Stichwort „3×20 Minuten lesen) muss der Fokus auch wieder auf die Rechtschreibung gelegt werden. In den letzten Jahren wurde dies sträflich vernachlässigt…..Es dürfen (in NRW) keine Diktate mehr geschrieben werden, alles soll nur regelbasiert geübt werden. Die Rechtschreibnote generiert sich aus freien Texten….das ist Luschi……und bringt es auch nicht…..bitte wieder her mit Dosendiktaten, Laufdiktaten, Knickdiktaten, mit geübten Wörtern…..so wird ein Schuh draus….heute werden Abschreibleistungen als Rechtschreibung gewertet, obwohl dies nichts mit Rechtschreibung zutun hat…..*Haarerauf*
Sie sind aus der Zeit gefallen. Bei Ihnen scheint nicht angekommen zu sein, dass sie Kompetenzen zu vermitteln haben. Fähigkeiten und Fertigkeiten, das ist ja sowas von altmodisch und seit mehreren MSB-Vorständinnen hinfällig. OMG so kann datt mit die Bildung ja nix werden:)
Ja! Aber noch in diesem Jahrtausend wurde auf Fähigkeiten und Fertigkeiten Wert gelegt…..so ganz oldschool ist das dann auch nicht….
Bei mir lernen die Kinder übrigens auch das gesamte 1×1 auswendig und nicht nur die Kernaufgaben….scheiß auf Kompetenzen….
Bei meiner Klassenkollegin lernen die Kinder ein Gedicht im Monat auswendig…..auch so eine längst vergessene Fähigkeit….
… so wird datt aber nix mit die kompetenzorientierten Curicula, wenn datt unser Doro hört bzw. liest – datt gibt aber Haue:)
Dafür können die Kids lesen und schreiben, trainieren durch das Auswendig lernen ihr Gehirn und haben Erfolge.
Aber datt erzähln wa unser Doro ma lieber net.
Wenn doch jetzt alle 3×20 min Lesen üben, bleibt an diesen Tagen noch 3×20 min für alle anderen Bereiche des Deutschunterrichts, also Rechtschreibung und Texte verfassen, Sprachbetrachtung/Grammatik und Literatur, Sprechen, Zuhören.
Während einige BL eine umfassende Stundentafel haben, gewähren andere BL weit weniger Stunden, dazu Lehrkräftemangel, Hilfskräfte zur Aufsicht.
Bildung ist uns teuer, sie darf nur nichts kosten.
Wir haben verbindlich die “rollende Lesezeit” eingeführt.
Zahlt sich aus – für die Rechner und Skeptiker zum Trotz.
Da stimme ich vollumfänglich zu.
Dass die GS SuS in großer Zahl entlässt, die der Rechtschreibung kaum mächtig sind, hat viele Gründe – s.o.
Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Ich gebe seit knapp 30 Jahren (!) wirklich alles in Bezug auf Rechtschreibung und vor allem auch auf formtreues (leserliches) Schreiben (korreliert laut div. Studien) etc. Mehr kann ich nicht tun. Ich habe aber das Gefühl, dass ich inzwischen zu einer exotischen, aussterbenden Art gehöre.
Da haben Sie absolut Recht. Aber 1.) liegt die Ursache nicht darin, dass die Lehrer zu blöd sind. Und 2.) müssen sich die Lehrer aller Schularten an eine veränderte Lebenswirklichkeit anpassen. Und dann müssen eben auch die Gymnasiallehrer mehr basalen Rechtschreibunterricht machen, so dass der Rechtschreibunterricht tatsächlich, wie eigentlich vorgesehen, bis Klasse 10 geht. Ich erlebe es nämlich bei meinen Kindern am Gymi genauso: “Und dann machen wir halt noch 10 Stunden Rechtschreibunterricht und schreiben dann ein Diktat.”
Erstens habe ich nicht behauptet, dass die Grundschullehrkräfte zu blöd sind.
Und zweitens kann die Vermittlung basaler Rechtschreibung nicht die Sache weiterführender Schulen sein.
Ich stimme Fräulein Rottenmeier in ihren Ausführungen zu, dass Rechtschreibung in Grundschulen wieder mehr im Mittelpunkt stehen muss und dass dafür auch mehr Übungsstunden zu Verfügung stehen müssen.
Aber bei den Vorurteilen, die den allseits als “Primimäuschen” verunglimpft Grundschullehrkräften entgegen gebracht werden, muss man doch schon recht blöd sein, um diesen Beruf zu ergreifen bzw auf Grundschullehramt zu studieren. Dann doch lieber Lehramt für SekI+II, damit man sich in die Reihen derPhilologen einreihen und auf die GS-Lehrkräfte herab schauen kann. Schließlich nehmen die nicht einmal ein simples Abitur ab und das nur, weil die Prüflinge gerade einmal 10 Jahre alt sind
Tja, so ist das und dann kommen noch seltsame Meinungen wie von @ Tigerente hinzu „ Und dass viele Lehrer nur noch machen möchten, was Spaß macht. Was Spaß macht, lenkt jedoch oft ab vom Wesentlichen. Es sollte eher sparsam und zur Auflockerung eingesetzt werden, nicht ständig.“
Was glauben diese Lehrer eigentlich? Man macht den ganzen Tag Killefit und Ringelpietz und haben dabei ganz ganz viel Spaß?
Ach nee, heute verzichten wir mal auf Mathe, macht ja auch gar keinen Spaß und auf so lästige Übungen in Deutsch auch…..
Vielen lieben Dank, Frau Kollegin……
Wollen Sie mir irgendwas in den Mund legen oder einfach nur ein bisschen stänkern?
Nehmen Sie sich mal nicht so wichtig. Ich habe doch lediglich begründet, warum GS-Lehrkräfte blöde sein müssen, vor allem angehende “Primimäuschen”.
Die strukturierte Vermittlung des Schreibens und der Rechtschreibung wird ja auch komplett überbewertet. Besser wäre natürlich, wenn die Kids selbst entscheiden könnten, wann sie was lernen wollen. Das wissen wir doch alle, schließen wissen die doch selbst viel besser, was sie brauchen.//
……Ironie off.
Und ganz ehrlich – nach Beenden der Sek I ist es zu oft auch nicht besser geworden.
Lernzuwachs tendiert gegen Null.
Liegt auch daran, dass RS so gut wie nicht bewertet wird.
Wird schon irgendeinen kruden Sinn haben – oder auch nicht.
Wenn es um den Erwerb geht, könnte man nächstes Mal zusätzlich eine Erzieherin fragen, zumal dort ja künftig groß getestet (und gefördert?) werden soll
In Klasse 10 ist neben ‘Spracherwerb abgeschlossen’ auch die Kleinigkeit ZAP angesiedelt. Die Menge an Rechtschreibfehlern, durchgehender Kleinschreibung, komplett fehlenden Satzzeichen und unbekanntem Alltagsvokabular in den Prüfungen ist teilweise unglaublich. Für die 25% engagierten Schülerinnen gilt das nicht, sie formulieren meist gut und schreiben sicher, verbessern sich seit Klasse 5 kontinuierlich und sind eigentlich absurd unterfordert mit dem Prüfungsniveau. Viele andere haben nicht nur seit der Grundschule wenig dazugelernt, sie haben oft Dinge wieder verlernt. Vielleicht haben wir versagt, möglich. Vielleicht ist es auch die bekannte Grundeinstellung zu Schule: solange die Noten reichen, ist alles egal, sonst frage ich die KI. Ich weiß, dass die Deutschkollegen ohne Ausnahme diskutieren, warum Schüler überhaupt nicht mehr erreichbar sind. Alle, egal welche Methoden von wem angewandt werden. Kann ein Kollegium nur aus Nieten bestehen, an einer Gesamtschule mit sehr gutem Ruf?
‘Wieder mehr Rechtschreibung’ erscheint mir nicht wie ein sinnvolles Programm dagegen. Die Grundschulen können ihre heterogenen Klassen nicht alle ausreichend vorbereiten, aber wir schaffen das später auch nicht mehr: 25% zurecht gelangweilt, 50% ‘vier reicht’, 25% ‘wen interessiert Schule’, was soll da gefördert werden?
Seit Jahrzehnten sollen Schulen ‘mal eben noch’ zusätzlich dieses und jenes leisten, jedesmal mit zusätzlichen Ressourcen, die deutlich unter dem Bedarf liegen. Es nützt nichts, den ‘Schwarzen Peter’ im GS- oder Sek-Bereich zu suchen, überlastet und überfordert mit ihren Aufgaben sind beide. Was wir auch tun, kosmetische Veränderungen in der Methodik und Didaktik schaffen keine tragfähige Basis. Darüber reden Politiker aber lieber nicht.
Ich bin Deutschlehrer an einer IGs in RLP und habe eine Tochter in der 4. Klasse, die nach den Ferien aufs Gymnasium wechseln wird mit entsprechender Empfehlung der Grundschule. Meiner Ansicht nach klafft zwischen dem Lehrplan der Grundschule und dem der weiterführenden Schule in Deutsch eine riesige Lücke. Das liegt auch zum Zeil daran, dass der Lehrplan der Grundschule sehr schwammig formuliert ist. Die einzigen Regenl, die meine Tochter in 4 Schuljahren gelernt hat, lauten: Nomen und Satzanfänge schreibe ich groß und sie weiß, wie man nach einigen Satzgliedern fragt. Das war’s!!!!!! Wie man ein Nomen erkennt im Satz (Nomenendungen oder Nomensignalwörter), wurde nie thematisiert! Nomen sind Gegenstände. Das war alles, was gelehrt wurde. Sie hat zwar Satzglieder gelernt, weiß aber nicht, wann ein Satz zu Ende ist, da das Thema ” Haupt- und Nebensätze” völlig ausgeklammert wurde. Wortarten kannt sie drei: Nomen, Adjektive und Verben. Präpositionen, Konjunktionen, Pronomen? Fehlanzeige! Daher kann sie auch nicht auf die Idee kommen, ein Komma zu setzen, wenn sie eine Konjunktion sieht. Es wurden die Zeitformen des Verbs behandelt, aber nur einige wenige. Und die SuS haben die Verben nur durch Analogiebildung konjugiert Dass es für die Zeitenbildung Regeln gibt, wie z.B. das Perfekt wird aus einer Präsensform von “haben” oder “sein” gebildet plus dem Partizip Ii, wissen die Kinder leider nicht. Dass es Aktiv und Passiv gibt, leider auch nicht. Seltsamerweise lernen die Kinder das auf der weiterführenden Schule zuerst im Englischunterricht, dann erst in Deutsch. Es wurde nicht einmal der Unterschied zwischen starken und schwachen Verben deutlich gemacht, nicht einmal, als das Präteritum themstisiert worden ist. Wie kann man ohne diese Unterscheidung Kindern das Präteritium beibringen? Ein Rätsel, dessen Lösung mir wohl nur Grundschullehrer verraten können.Die Grundschule hat also kaum verbindliche Regeln vermittelt. Was wurde stattdessen gemacht? Meine Tochter musste jahrelang seitenweise Arbeitsblätter ausfüllen mit “Wörter mit a/aa/ah”, “Wörter mit v, Wörter mit w”,etc. Diese Wörter wurden aber nie als Lernwörter im Diktat abgefragt. Sie mussten nie auswendig gelernt werden als Deutschvokabeln. Folglich haben die Kinder sie schnell wieder vergessen. Der Lehrplan in RLP an den weiterführenden Schulen ist so ausgelegt, dass man die wichtigsten Grammatikthemen in der 5. und 6. Klasse wiederholt (nicht zum ersten Mal lernt!) und danach kommen nur noch sehr spezielle Themen wie die Schreibzng von Fremdwörtern, Kommasetzung in Partizipgruppen, etc. D.h die Kinder schaffen es entweder, die komplette Grammatik im Schnelldurchlauf in Klasse 5 und 6 zu lernen oder sie lernen sie eben nicht. Meistens ist das Letztere der Fall.
Ich habe die gleiche Erfahrung in einem anderen Bundesland gemacht.
“Meiner Ansicht nach klafft zwischen dem Lehrplan der Grundschule und dem der weiterführenden Schule in Deutsch eine riesige Lücke.”
Ich kann das zumindest in dem Fach Englisch ebenfalls bestätigen. Mein Kind ist ebenfalls mit Empfehlung auf das Gym gewechselt und hatte in Englisch immer nur einzelne Worte in Englisch gelernt und rudimentär ganze Sätze (Tiere, Körperteile, ein paar Verben, Mein Name ist…, Meine Lieblingsfarbe ist…). Auf dem Gymnasium sollte sie dann sofort kurze Texte a 5 Sätze schreiben, der Unterricht war komplett auf Englisch und fast kein Kind hat was verstanden. Das war wirklich ein sehr harter Übergang.
In Deutsch hatte sie (NRW) das Problem gar nicht. Sie hatte viel Grammatik in der Grundschule (Satzteile inkl. nicht nur Objekte erkennen, sondern auch welches z.B. Dativ-Objekt). Da war dann sogar die Deutsch-LK auf dem Gym überrascht.
Ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht an den Prioritäten der jeweiligen Grundschule oder der LuL-Ausstattung liegt….
Hinzu kommt, dass meiner Erfahrung nach die Deutschlehrkräfte (grundständig ausgebildet und nicht ausgebildet) auch schlechter in der Rechtschreibung werden. Die deutsche Rechtschreibung ist nicht ganz einfach. Man muss sie also erst einmal selbst beherrschen, bevor man sie vermitteln kann. Und nur, weil ich etwas intuitiv richtig schreibe, heißt es nicht, dass ich das begründen/vermitteln kann. Ich unterrichte Deutsch auch in der Oberstufe und mache zwischendurch Rechtschreibeinheiten zu das/dass, Groß- und Kleinschreibung, Kommasetzung. Viele Schüler schreiben intuitiv richtig, können die Schreibweise aber nicht begründen. Wenn die Intuition sie trügt, dann passiert der Fehler.
Ja, solche Lücken zwischen Lehrplänen gibt es häufiger, auch innerhalb einer Schulform.
Auch gewinnt man den Eindruck, dass diejenigen, die diese Pläne erstellen, entweder in bevorzugten Gebieten arbeiten, wo Schüler:innen basale Fähigkeiten mitbringen, oder dass sie die Bodenhaftung längst verloren haben und nicht bemerken, wie viel Zeit und Übung man benötigt, um Inhalte nicht nur anzureißen, sondern mit Ruhe zu vermitteln und zu festigen.
Der Deutschunterricht bräuchte doppelt so viele Stunden, um alles abdecken zu können.
Viele von Ihnen aufgeführte Inhalte waren noch nie im GS-Curriculum. Es bleibt Aufgabe der weiterführenden Schule, Grundständiges weiterzuführen.
Komischerweise konnten meine Kinder in BW das alles und ich unterrichte es auch in Klasse 4 – weil es im Lehrplan steht.
“Es geht um überfrachtete Curricula, fehlende Zeit für Übung, fragwürdige Methoden und Missverständnisse zwischen Schulformen.”
Genau das ist es! Vollkommen richtig! Und dass viele Lehrer nur noch machen möchten, was Spaß macht. Was Spaß macht, lenkt jedoch oft ab vom Wesentlichen. Es sollte eher sparsam und zur Auflockerung eingesetzt werden, nicht ständig.
// Scheitert die Grundschule beim Vermitteln der Rechtschreibung? //
Ketzerisch: wie soll man an etwas scheitern, das man offensichtlich gar nicht zum Ziel erhoben hat?! Schreiben lernen mit Anlauttabelle und Druckbuchstaben, kein systematisches Erlernen von Schreibschrift, keine Diktate, kaum Schreibübungen, keine Benotung von Rechtschreibung. Dafür Lapbooks und Wochenplanaufgaben.
Wenn so der Deutschunterricht von Junglehrern nach dem Studium aussieht, weil man es ihnen so beibringt, dann scheint richtig Schreiben schlicht keine Priorität zu haben.
Hauptsache einige Buzzwords in die Runde gestreut, aber doch so wenig Ahnung vom Schriftspracherwerb. Haben Sie jemals eine Grundschulklasse von innen gesehen? Wer behauptet, Diktate würden der Einübung von Rechtschreibung dienen und Anlauttabellen seien automatisch schlecht, zeigt, dass er nicht fachlich kompetent ist.
Meine Erfahrung als Vater ist, dass die Kinder, die ZU HAUSE lesen und schreiben es auch in der Schule können. Bei meinem Ältesten (3. Klasse) korrigiere ich hin und wieder Fehler, wenn er schreibt, mehr nicht.
Meiner Beobachtung nach ist die Schule eher zweitrangig, was solche grundsätzlichen Fähigkeiten angeht und auch überfordert, weil viele Kinder völlig disziplinlos sind und es offenbar auch kein Mittel gibt eine Lernatmosphäre in der Schule zu schaffen.
Ähnliches Thema wieder beim rbb:
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2025/06/kita-modellprojekt-sprache-foerderung-verbesserung.html
Auch die Leser-Kommentare dazu sind wieder sehr interessant.