WIESBADEN. Schüler, die bei einem Holocaust-Film klatschen, eine volksverhetzende Tiktok-Challenge, rassistische Gesänge in einer Ausbildungsstätte für Beamte – aktuell laufen zahlreiche Ermittlungen wegen Vorfällen unter jungen Menschen dieser Art. Was sind die Gründe und was muss geschehen? Eine Wissenschaftlerin rät, dort anzusetzen, wo ein Teil des Problems liegt: in den sozialen Medien. Allerdings kann das auch nach hinten losgehen.
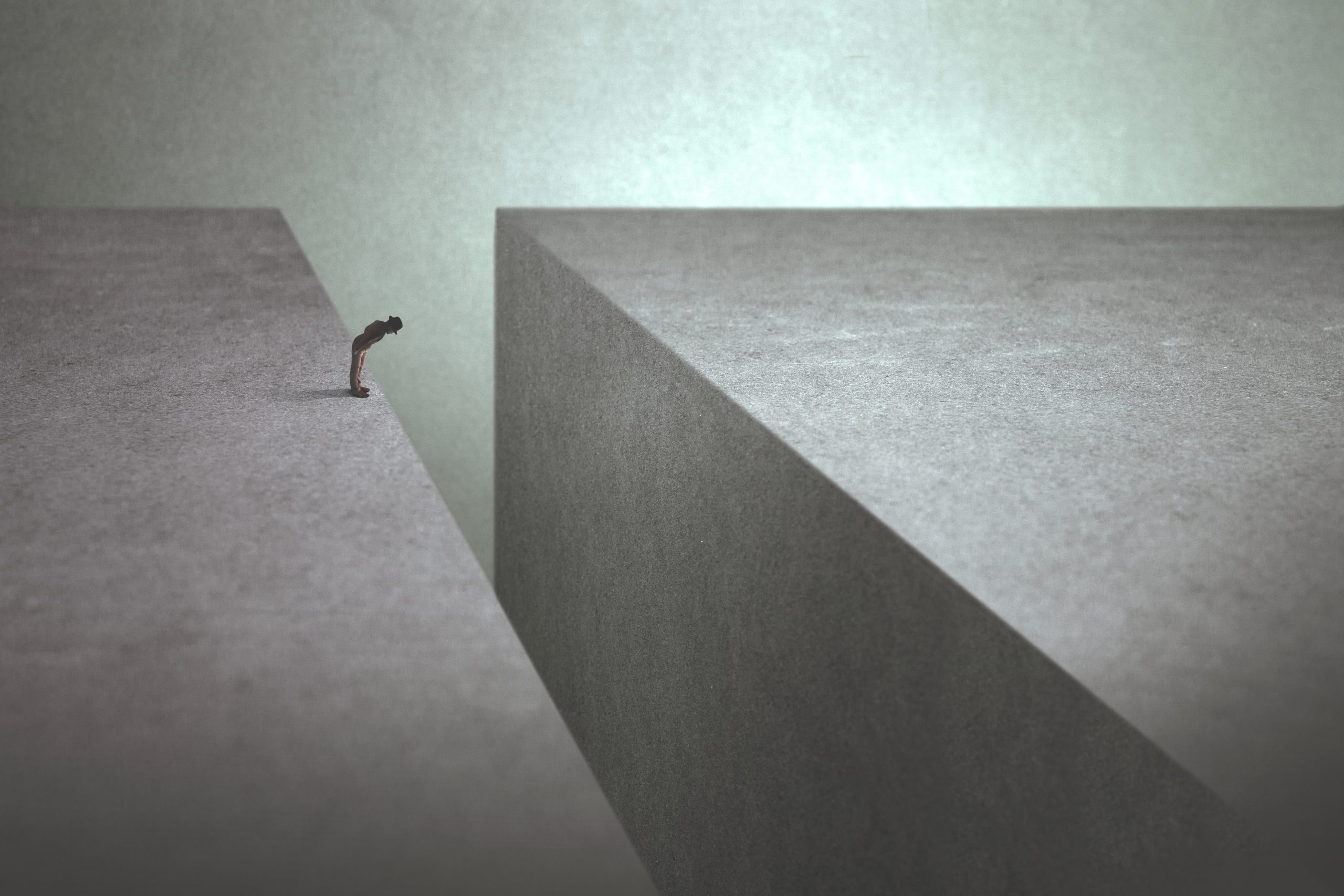
Aus verschiedenen Quellen wurde in den vergangenen Wochen über Vorfälle in Hessen berichtet, die in eine ähnliche Richtung gehen. Fall eins: Sechs hessische Berufsschüler sollen bei dem Film «Die Wannseekonferenz» die Ermordung der Juden im Nationalsozialismus beklatscht haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen mutmaßlicher Volksverhetzung.
Fall zwei: Der Staatsschutz ermittelt gegen zwei Jugendliche wegen des Verdachts auf Volksverhetzung. Die 16-Jährigen sollen an einer Schule im Lahn-Dill-Kreis rassistische Parolen durchs Schulhaus und im Musikunterricht gerufen haben. Das Landeskriminalamt (LKA) sieht einen Zusammenhang mit einem Trend in sozialen Medien, einer sogenannten Tiktok-Challenge.
Fall drei spielt im Studienzentrum der Finanzverwaltung in Rotenburg. Bei einer Feier Ende Januar sollen auf dem Gelände der Bildungseinrichtung rassistische Gesänge angestimmt worden sein. Ermittelt wurde zunächst gegen Unbekannt. Später weitete sich der Fall aus. Gegen einen 33 Jahre alten Justizsekretär-Anwärter wird konkret wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt.
Im vergangenen Jahr hatte es zahlreiche solcher Fälle in ganz Deutschland gegeben, die für Schlagzeilen sorgten. Drei Beispiele:
- Zwei Lehrkräfte verfassten einen Brandbrief, in dem sie die Zustände an einer Grund- und Oberschule im brandenburgischen Burg beschrieben. «Wir wenden uns an die Öffentlichkeit, da wir in unserem Arbeitsalltag als Schulpersonal an einer Schule im Spree-Neiße-Kreis täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert werden und nicht mehr länger den Mund halten wollen», hieß es in dem Schreiben (News4teachers berichtete).
- Kurz darauf wurde der Fall von Oberstufenschülern eines nordrhein-westfälischen Privatgymnasiums bekannt, die im Internet Seiten öffneten, die den Nationalsozialismus verherrlichten. Es sei zu gesungenen Geburtstagsgrüßen für Adolf Hitler gekommen und die Schüler sollen den Hitlergruß gezeigt haben (News4teachers berichtete).
- Nur wenige Tage später zeigten zwei Schüler einer Oberschule im sächsischen Leisnig den Hitlergruß in der Gedenkstätte Auschwitz und teilten ein Foto davon in sozialen Netzwerken (News4teachers berichtete ebenfalls).
«Es ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft sensibler geworden ist hinsichtlich rassistischer, antisemitischer oder rechtsextremer Äußerungen und Handlungen», sagt Tina Dürr vom Demokratiezentrum Hessen in Marburg. In Bildungseinrichtungen werde bei Vorfällen öfter interveniert, sie würden nicht mehr so einfach übersehen oder «unter den Tisch gekehrt».
«Allerdings zeigen Einstellungsstudien, dass rechtsextreme Einstellungen in der Bevölkerungen zugenommen haben», so Dürr. Forschende sprächen sogar von einer Trendumkehr: Lange Zeit sei die Zustimmung in der jungen Bevölkerung niedrig gewesen und am höchsten in älteren Generationen. «Das verschiebt sich aktuell und mag ein Grund sein, warum sich solche Fälle in Schulen und Ausbildungseinrichtungen häufen.»
Auch Meron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank sieht die Vorfälle im Kontext eines gesamtgesellschaftlichen Rechtsrucks: «Diese Jugendlichen halten der Gesellschaft den Spiegel vor», sagt Mendel.
«Das wichtigste Instrument im Kampf gegen Rechtsextremismus sind die Lehrkräfte», glaubt Mendel. Sie hätten die Aufgabe, nicht nur ihre Fächer, sondern auch «Werte und Haltung» zu vermitteln. Dafür bräuchten sie den Rückhalt aus der Gesellschaft und so viel fachliche und pädagogische Unterstützung wie möglich. Denn sie führten einen ungleichen Kampf: Auf Plattformen wie Tiktok würden Jugendliche mit Halbwahrheiten, Falschinformationen und Propaganda konfrontiert. «Bei den vielen Stunden, die Jugendliche mit dem Smartphone verbringen, kann man sich nur vorstellen, was das für ihre politische Sozialisation bedeutet.»
Das gilt umso mehr, weil Werte- und Demokratiebildung beim aktuellen Lehrkräftemangel in den Schulen schlicht kaum möglich erscheint, wie die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV) Simone Fleischmann im News4teachers-Interview schon vor einem Jahr erklärt hatte. «Denn wenn die Kolleginnen und Kollegen in drei Klassen gleichzeitig unterrichten müssen, die Kinder große Defizite haben, kein Förderlehrer da ist, die Kinder nicht mehr in die Schule gehen wollen, weil es keine AGs oder anderes gibt – und ich male jetzt nicht schwarz, das sind Dinge, die attestiert wurden –, wenn also das ganze Gerüst zusammenbricht, dann können wir nicht noch ein zweites Stockwerk drauf bauen», sagte sie (hier geht es zu dem vollständigen Interview).
Auch das hessische Landeskriminalamt (LKA) warnt: «Gerade rechtsextremistische Gruppierungen nutzen die sozialen Medien, um ihre rassistischen oder fremdenfeindlichen Ideologien mit hoher Reichweite unter jungen Menschen zu verbreiten.» Soziale Medien könnten die Tür zu Gewalt und menschenverachtenden Inhalten bis hin zur Pornografie öffnen, so das LKA.
Mit der Rolle der sozialen Medien hat sich Luise Wolff beschäftigt. Ihre Bachelorarbeit «Bildungsarbeit gegen Antisemitismus auf TikTok» im Fachbereich Soziale Arbeit der University of Applied Sciences Frankfurt wurde Anfang Februar mit dem Johanna-Kirchner-Preis der Arbeiterwohlfahrt ausgezeichnet. «Tiktok wird als Tanz- und Spaßplattform wahrgenommen. Damit wird die Relevanz der Plattform und ihr Einfluss unterschätzt», sagt die 26-Jährige. Jugendliche informierten sich dort zunehmend auch über das Tagesgeschehen. Klassische Medien oder Bildungseinrichtungen seien aber kaum vertreten.
Tiktok funktioniert anders als etwa Instagram oder Facebook, wo Inhalte von Konten angezeigt werden, denen man bewusst folgt. Bei Tiktok hingegen wählt ein Algorithmus aus, was man zu sehen bekommt. Das ist zum einen abhängig vom persönlichen Nutzungsverhalten – aber auch davon, was gerade generell erfolgreich ist.
«Dieser Mechanismus kann begünstigen, dass extremistische oder antisemitische Inhalte sich verbreiten, ohne dass sie von Nutzenden als solche erkannt werden», sagt Luise Wolff. Rechte Influencer verknüpfen zum Beispiel Videoschnipsel von beliebten Songs mit rechten Parolen, die mit dem Lied weitertransportiert werden. Erfolgreich ist dabei vor allem, was emotional wirkt.
Daher reiche es auch nicht aus, Falschinformationen zu korrigieren, meint Wolff. «Tiktok-Nutzende wollen nicht belehrt werden.» Der Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus funktioniere «nicht von oben herab, sondern nur auf Augenhöhe». «Wichtig ist, das in Tiktok selbst viel Potenzial steckt, dem entgegenzuwirken. Die Plattform bietet Möglichkeiten, eigene Bildungsformate zu entwickeln und besonders junge Menschen darüber zu erreichen.» Nur: Wer fängt damit an? News4teachers / mit Material der dpa
Ob Nutzende von sozialen interaktiven Medien, die Fake News verbreiten, alle nicht “belehrt” geschweige denn informiert werden möchten, halte ich für ein generelles Gerücht.
Selbstverständlich sollte auf Augenhöhe zu kommuniziert werden, falls dabei kein Zacken aus der Krone bricht.
Kürzlich wurde ich mit “NIUS”, einer mir bis dato unbekannten, einschlägig rechtspopulistisch agierenden Plattform konfrontiert. Entsprechende Recherchen zu dieser mehr als unseriösen Quelle veranlassten den naiven Nutzer auf seiner Seite zur unmittelbaren Löschung derselben, geht also.
Warum eigentlich sind die Leute so “geil” auf diese “sozialen Medien”? Was haben die denn davon? Steckt dahinter vielleicht ein psychologisches Problem?
Vielleicht sind “Tiktok” etc. verschwistert mit vergleichbar, gefeierten Medien wie “Bravo”. Haben Sie auch gelesen oder ?
Wäre somit ein gesamtgesellschaftliches, “psycholgisches Problem”, welches sich kaum auf “die Leute” eingrenzen ließe.
Sorry, aber “Bravo” mit “Tiktok” zu vergleichen, ist komplett daneben, denn “Bravo” hatte eine Redaktion, die bestimmte Inhalte von vornherein ausgeschlossen hat. Um es einfach auszudrücken: Der H-Gruß und ähnliche Ekelhaftigkeiten haben es nie in diese Jugendzeitschrift geschafft.
Solche Tiktok Challenges mitzumachen, hat etwas mit Aufmerksamkeitsdefiziten zu tun und ist dadurch sehr wohl ein “psychologisches Problem”.
Nordisches sorry ist hier echt unnötig, da Algorithmen vs. Redaktion hoffentlich unvergleichbar bleiben.
Also “kompett daneben” getippt, passiert wohl.
Erfreulicherweise ist die Antwort von Ragnar D. sehr zutreffend.
Weil sie in diesen Medien genau mit jenen Nachrichten versorgt werden und von jenen Personen bestätigt werden, die ihre eigene Weltanschauung bestätigen und bekräftigen.
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-toene-texte-bilder-beitraege/audio-digitalisierung-daenemark-rudert-zurueck-102.html
“… alle in der Pflicht …”
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-toene-texte-bilder-beitraege/audio-daenemark-dumbphone-statt-smartphone-100.html
Lieber Pit,
…mit dem Verweis auf diese Entwicklungen und Entscheidungen unsere Nachbarländer (DK, NL, Swed…) erzeugt man zum Teil hanebüchene Entgegnungen, warum wir weiterhin mit der Volldigitalisierung und der heiligen Kuh für die Schulen genau auf dem richtigen Weg sind.
Wir machen das ja gaaaanz anders und damit viel besser als unsere dummen Nachbarn…wir haben die Folgen vollem Blick und natürlich auch im Griff … berechtigte Kritik und Bedenken werden weggefegt….man ist der technikfeindliche Maschinenstürmer, der noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen ist…
….fast so, wie einen Wasserfall nach oben zu schwimmen.
Ich gebˋ s auf, hier die Apostel überzeugen zu wollen.
@Hysterican
“….fast so, wie einen Wasserfall nach oben zu schwimmen.
Ich gebˋ s auf, hier die Apostel überzeugen zu wollen.”
Hallo Andre,
wir “können ja nur Angebote machen” … 😉
Nichts anderes habe ich getan, nichts anderes würde ich wagen – und im Übrigen: Lifelong learning – wer könnte sich diesem Zauber entziehen? … Wir beide 😉 schon mal nicht!
GUT, wenn Sie es aufgeben. Was haben Schulbücher mit dem privaten Medienkonsum zu tun? Freue mich über die Rückkehr zum Buch – hatte zuletzt in der Klasse wahnsinnig inspirierende Erfahrungen – aber das zieht an dieser Stelle nicht den Karren aus dem Dreck
Naja, wenn man die letzte heilige Kuh schlachtet, dann ist der Stall lehrer.
Heiii, Pit! Was ist da faul im Staate Dänemark? Kann eigtl. nur an zu geringer Bandbreite liegen … 😉 Danke für die Links. Es gibt also noch den realistischen Blick, volle anderswo halt.
@Dil Uhlenspiegel
“Es gibt also noch den realistischen Blick, volle anderswo halt.”
Dil, alter Schwede!
Und wenn wir hier erst merken, dass volle anderswo sogar das “Gras” grüner ist … Aber zurück zum Ausgangsthema, denn Gras ist (noch) nicht so das Thema.
Ist ja bald legal, dann hat sich das Gras-Thema auch erledigt. 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=K3O_-Mjls_Q
Zu den Themen “Jugend” und “Erreichbarkeit”.
Die Altparteien schaffen das zusammen nicht. Wenn Frau Wagenknecht und Herr Maaßen ihre Parteien gegründet haben, gehört die AfD auch zu den Altparteien.
Ich bin dafür als Schule jede Form von Extremismus zu bekämpfen. Extreme Ansichten sind nie förderlich. Schwierig ist der Kampf an alle Fronten.
Wir wüssten nicht, dass Linksextremismus derzeit an Schulen eine Rolle spielt. Herzliche Grüße Die Redaktion
Auf “Arte” wurde kürzlich der aufwendig produzierte Film ” Der Baader Meinhoff Komplex” von Bernd Eichinger anno 2008 gezeigt, er ist bis 29.2.24 einsehbar in hiesiger Mediathek.
Dokumentarisch orientiert am Sachbuch von Stefan Aust gilt er als entsprechend wertvoll und empfiehlt sich fächerübergreifend für die Oberstufe.
Deutlich wird im Nachhinein, wie extremistischer Staatsterror sich inzwischen perfekt um 180 Grad gedreht hat.
https://www.arte.tv/de/videos/115097-000-A/der-baader-meinhof-komplex/
Danke! Ich habe wahnsinnige Angst vor dem Baader Meknhoff Komplex! Kann nicht vor das Haus treten, ohne mich nach Linksextremist*innen umzuschauen
Das könnte ein Zeichen sein für eine andere Art von Komplex.
(Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. )
https://www.verfassungsschutz.de/DE/verfassungsschutz/der-bericht/vsb-auslandsbezogener-extremismus/vsb-auslaenderextremismus_node.html
Es gibt mehrere Formen des Extremismus, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden.
Hat die Redaktion nie infrage gestellt. Derzeit kleben sich die radikalen Ökos am Straßen fest – selbst das nicht mehr. Da habe ich doch ein wenig mehr Sorge vor der Jungen Rechtsextremen..
Ich habe mit keiner Silbe den Linksextremismus erwähnt – und dennoch gibt es ihn. Bislang hat keine extrimistische Einstellung gesellschaftlich irgendwelche Vorteile zu Tage gefördert. Daher ist es wichtig, absolut jede Form von Extremismus zu bekämpfen, denn keine davon steht auf dem Boden des Grundgesetzes. Ich meine damit nicht, dass man nun links gegen rechts ausspielt, sondern dass Lehrkräfte im Blick behalten, dass es auch andere Ausprägungen extrimistischen Denkens gibt.
“(wieso sie aber kaum eine Chance haben)””Allerdings kann das auch nach hinten losgehen.”
Irgendwie fehlen mir diese Zwei Aspekte im Beitrag.
Vor einer Weile wurde auf TikTok ein Bildungsprojekt zur Shoa initiiert.
Wieso werden solche Dinge hier gar nicht erwähnt?
Wenn jemand fordert “eigene Bildungsformate zu entwickeln”, dann drängt sich mir immer der Verdacht auf, eben jene Person will zunächst mal Fördergelder um das eigne Dasein zu finanzieren…
Sorry – aber heutzutage muss man wohl in allem auch die egoistischen Facetten sehen…
Pim Fortuyn, Jörg Haider, Famile Le Pen – man braucht nur mal in die unmittelbare Nachbarschaft zu schauen, wo diese gesellschaftlichen Entwicklungen schon seit langem stattfinden. In Deutschland ist das ein vergleichsweise Neues Phänomen.
Man könnte also von den Nachbarn lernen – was lief dort schief und führte zu den Zuständen von heute?
Und auch hier hatte man mehr als 10 Jahre Zeit.
Bevor man darüber nachdenkt, wie man via Inta, TikTok oder sonstwas irgendwen “erreicht”, sollten unsere gewählten Volksvertreter evtl. mal überlegen, wie man transparente Politik im Interesse der Bevölkerungsmehrheit macht?
Stattdessen beraten irgendwelche Spin-Doctoren die PR-Abteilungen wann was wie gesagt werden muss, damit es die öffentliche Meinung im gewünschten Sinn steuert.
Ein bisschen fühle ich mich an die 80er Jahre in der DDR erinnert – sinnentleerte politische Rituale, eine Politik, die noch stattfindet, aber jegliche Glaubwürdigkeit verloren hat, Staatsbürgerkunde als Mittel um hohle Floskeln zu lernen, die nach der Schule im Familiären Umfeld keinerlei Relevanz mehr hatten.
Wenn ich mal meine Schüler*innen danach befrage, dann höre ich fast immer, dass die zwar sowas geschickt bekommen, sich teilweise auch ansehen, den Inhalten aber i.d.R. keine Relevanz zukommen lassen.
Sicher – irgendwas bleibt immer hängen. Und nach dem tausendsten Mal auch ein bisschen mehr. Aber vielleicht sollte man aufhören hier Panik zu schieben.
DANK für link zum Bildungsprojekt ! Möge es mehr Beachtung finden.
Von meinem gestrigen Ersteindruck inkl. Empfehlung distanziere ich mich.
Verspäteten Doppeldank an die Redaktion, dass vermeintliche “Bildungsprojekte”, auf dieser Seite unerwähnt bleiben. Ebenso kapiere ich leider auch erst jetzt, warum absurde Kommentare zu Montessori im Kontext mit Trisomie21 glücklicherweise herausgefiltert werden.
Der Staat selbst müsste bei den sozialen Medien einsteigen und dort massivere Kampagnen fahren als es die AfD tut. Wieso tut man das nicht schon längst?
Das Netzwerk FUNK betreibt ca 200 Kanäle auf YouTube, Twitch, Tictoc, Instagram und diverse Podcasts. Teilweise sind sie sehr reichweitenstark.
Diesen Kanälen kann man nicht vorwerfen, konservativ oder gar rechts zu sein.
Insgesamt kann man dem ÖRR das bestimmt nicht vorwerfen. ARD und ZDF laden ja auch Inhalte auf z.B. YouTube hoch, z.B das Y-Kollektiv.
Es gibt auch viele private Creator die linken Content machen, teils auch mit großer Reichweite, wie Dekarldent.
Und eher gemäßigte Linke wie der Parabelritter oder Imp.
Es stimmt also nicht, dass den Konservativen oder Rechten das Feld überlassen wird.
“[…] oder Imp.”
Der ja damals skandalöserweise (auch weil komplett fälschlich) von J. Böhmermann im ZDF Magazin Royal als rechtsextremer Holocaustleugner verunglimpft wurde (der Fall ist ein Paradebeispiel für Dekontextualisierung, Machtmissbrauch, Medienmanipulation und Hermetisierung/Dichotomisierung des öffentlichen Diskurses). Er hatte (iirc) wohl auch mit massiven (persönlichen) Konsequenzen zu leben. Hat nur irgendwi kaum jmd. gekümmert. Wie gesagt, m.E. ein Skandal.
Und ein Dekarldent, eine Shurjoka und Co. sind dermaßen in ihrer hermetischen, ideologisch-radikalen bis extremistischen Filterblase aus copy & paste-Satzbaustein/-Phrasen versunken (und haben trotz ihrer Unbildung etc. dennoch eine derart provokant-despektierliche Attitüde), dass ihnen auch Der Dunkle Parabelritter, ein Imp, Holger Kreymeier und Co. alle Rechtsradikale/-extremisten sind. Abschreckende Beispiele für Antiintellektualismus, fehlende Selbstreflexion, Bias, Ideologie und Co. (wie übrigens auch ein Teil des Angebots von FUNK).
Da gibt es im linken Spektrum doch deutlich vorzeigbarere Vertreter.
Personalmangel. Und die meisten staatlichen Kampagnen in Social Media sind eher cringe, wie meine Schüler sagen würden, also schlecht gemacht, ja kitschig.
Erwarten Sie dahingehend nur nicht zuviel vom konjungtiven “man”…
Wirken auch Sie weiterhin bitte direkt in Ihren Möglichkeiten, wir sind immer noch alle zusammen der Staat oder missverstehen ich Ihre Frage?
Wer zur Hölle ist der Staat? XD
Aber ja, ALLE demokratischen Parteien müssen sich besser zu präsentieren lernen.
Leider lassen aufmerksamkeitsgesteuerte “Sozial”medien derzeit nicht zu, dass sich Verfassungsschutz, Zoll oder Impfkommission (langfristig) präsentieren können
“Dafür bräuchten sie den Rückhalt aus der Gesellschaft und so viel fachliche und pädagogische Unterstützung wie möglich.” Und finanzielle Unterstützung. Ein Sondervermögen Bildung. Es tut mir sehr Leid, doch wenn ich gerade Nachrichten sehe, geht es ein Viertel der Zeit nur um tolle Waffensysteme mit Tiernamen. ( Nein, das ist keine AFD – Propaganda. Diese hat gerade zugestimmt) Wo sind die Ausgaben für Bildung, Pflege und Wohnraum?
“… Und es gibt gewiss für Fachleute keine ärgere Qual als die, lächelnden Gesichts einem vernünftigen Vorschlage zu lauschen. Denn die Vernunft, das weiß jeder, vereinfacht das Schwierige in einer Weise, die den Männern vom Fach nicht geheuer und somit ungeheuerlich erscheinen muss. Sie empfinden dergleichen zu Recht als einen unerlaubten Eingriff in ihre mühsam erworbenen und verteidigten Befugnisse. Was fragt man sich mit ihnen, sollten die Ärmsten wirklich tun, wenn nicht sie herrschten, sondern statt ihrer die Vernunft regierte! Nun also. …” (Erich Kästner in “Das Märchen von der Vernunft” – ein eindringlicher Appell für den Frieden)
Klingt wie eine Beschreibung der Freien Liberalen.
Man sollte nicht die Unterstützung der Ukraine anführen, sondern lieber das Dienstwagenprivileg oder die noch immer fehlende “Reichensteuer” oder die Besteuerung von Geldern, die man durch Geldgeschäfte usw. statt mit Arbeit verdient.
Also lauter Möglichkeiten, die irgendwie von zwei bestimmten Parteien auf Landes- oder Bundesebene blockiert werden.
Für welches Waffensystem (zum Schutz GEGEN Russland) hat die AfD ZUgestimmt? °_°
Aus dem gleichen Grund, warum Lehrkräfte auch sonst (ausser Unbildung 😉 ) nix “bekämpfen”:
Weil Lehrer schlicht mittlerweile keinerlei wirksame Macht über SuS/Eltern mehr haben.
Ist auch ok, gesellschaftlicher Wandel halt.
ABER DANN:
Zu verlangen, dass Lehrer irgendwas “bekämpfen” ist an Zynismus kaum zu überbieten.
Wir können nur REDEN, Angebote machen, Alternativen bieten
Den miesesten Extremisten, Radikalen, Mobber, Drogendealer müssen wir noch “fair” (=wirkungslis) behandeln – sonst verstossen wir gegen Gesetze.
Also Klappe zu, Gesellschaft – geliefert wie bestellt.
Ihr wolltet diese Schule – nun wird sie so.
Ich verstehe Ihre Frustration, aber das ist Geschäft:
Polizei kämpft gegen (z.T. vorsätzliche) Kriminalität,
Ärzt*innen gegen (z.T. vorsätzliche) Krankheiten,
Lehrkräfte gegen (z.T. vorsätzliche) Unwissenheit
Ich bin eigentlich garnicht (mehr) frustriert – ich muss halt die Realität zur Kenntnis nehmen und mich daran anpassen.
Das funktioniert schon ganz gut, jetzt wird noch der Arbeitszeitverbrauch optimiert und dann ist das “Oberthema Lehramt/Berufsbild” schlicht abgehakt.
Es gibt viele schöne Dinge im Leben.
Ich geb halt gerne im Internet meinen Senf dazu.