HEILBRONN. Wie kindgerecht ist Deutschland wirklich? Laut Politikwissenschaftler Prof. Sebastian Kurtenbach: kaum. Bei der Biko 2025 schlug er Alarm – und zeigte auf, wie eine alternde Gesellschaft die Interessen von Kindern und Jugendlichen zunehmend ignoriert. Statt Investitionen in Bildung landen Milliarden im Rentensystem, während jedes Jahr Zehntausende Jugendliche ohne Abschluss zurückbleiben. Doch Kurtenbach und andere Experten hatten nicht nur düstere Diagnosen im Gepäck – sondern auch Lösungen.
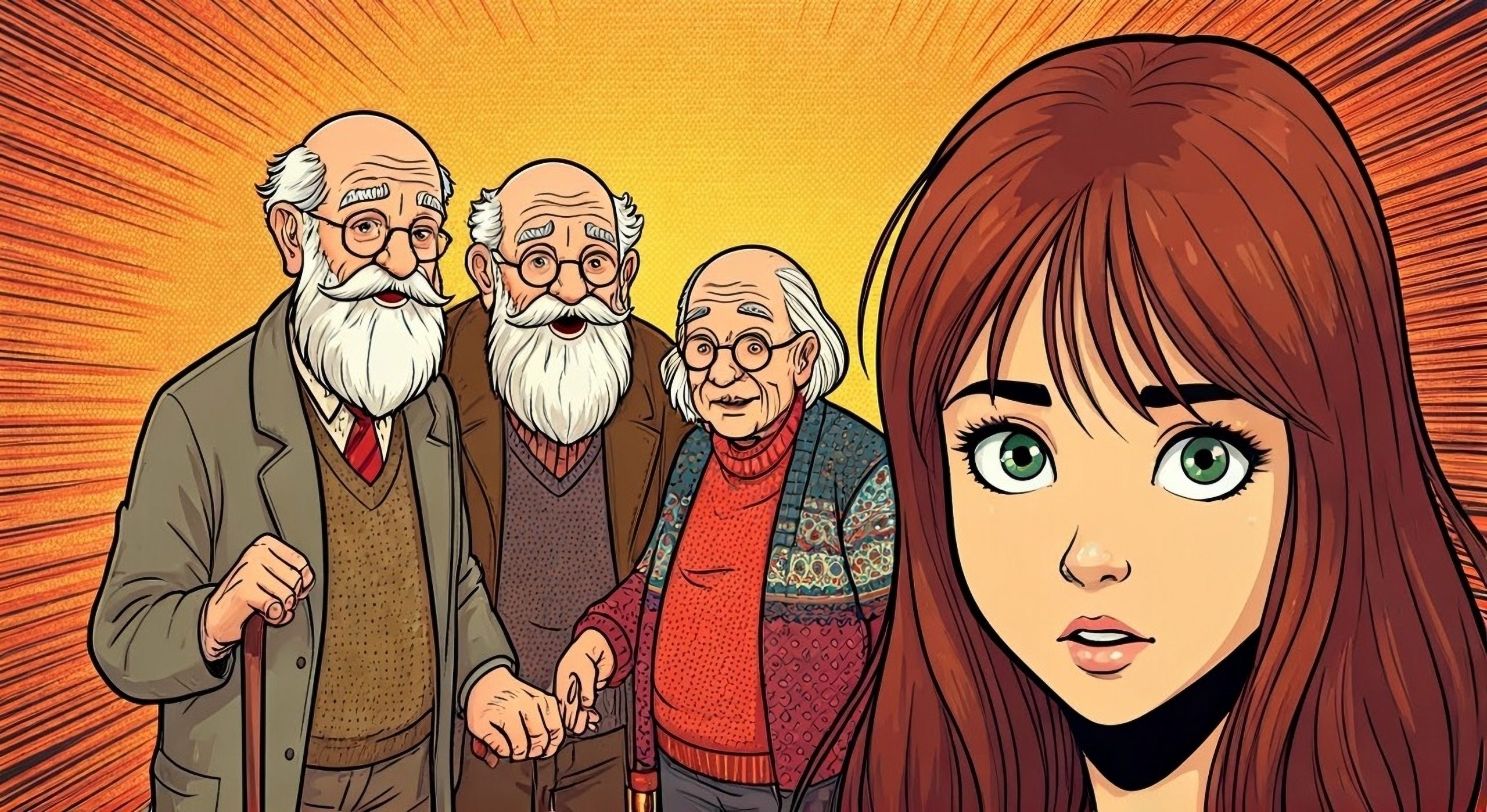
Eine Warnung vorab: Es sei kein „Gute-Laune-Thema“, das er hier vorzubringen habe, so erklärte Prof. Sebastian Kurtenbach, Politikwissenschaftler von der FH Münster. Tatsächlich geht es ans Eingemachte einer um ihre Zukunftsfähigkeit ringenden Gesellschaft, was er (in Vertretung des erkrankten Star-Soziologen Prof. Aladin El-Mafaalani) dem Publikum präsentierte.
Kurtenbach, El-Mafaalani und der Bochumer Soziologe Prof. Klaus-Peter Strohmeier haben gemeinsam eine Analyse verfasst (Buchtitel: „Kinder – Minderheit ohne Schutz“), die seit Wochen für Schlagzeilen hierzulande sorgt. Kernthese: In einer drastisch alternden Bürgerschaft rücken die Interessen von Kindern und Jugendlichen – und damit die Bildung – zunehmend an den Rand. „Deutschland ist weder kindgerecht noch gerecht zu Kindern“, postulierte Kurtenbach. Um, Achtung: Spoiler, am Ende seines Vortrages doch nicht so trostlos zu landen wie angekündigt.
Kurtenbach war einer von insgesamt knapp 100 Referentinnen und Referenten, die bei der Biko 2025, der Bildungskonferenz der gemeinnützigen, vor allem in der Schulleitungsfortbildung engagierten Akademie für Innovative Bildung und Management (aim) in Heilbronn auftraten – ein Kongress, der sich mit gut 1000 Teilnehmenden gegenüber der letzten Ausgabe 2023 mehr als verdoppelt hat und aufgrund seiner prominenten Besetzung aus Wissenschaft, Verwaltung und Praxis mit an der Spitze der Bildungsveranstaltungen in Deutschland anzusiedeln ist.
Entsprechend vielfältig waren die Themen der dargebotenen Vorträge und Workshops: Der Schulleiter und Preisträger des Deutschen Lehrkräftepreises Micha Palesche gab Einblicke in seine Reformagenda („Die Welt außerhalb der Schule ist auch nicht in Fächer unterteilt“), die renommierte Bildungsforscherin Prof. Uta Hauk-Thum sprach über „Schultransformation in Zeiten disruptiver Veränderung“, der Mathe- und Physik-Lehrer Patrick Bronner (ebenfalls früherer Träger des Deutschen Lehrkräftepreises) berichtete über seine Erfahrungen mit „Projektbasiertem Arbeiten mit KI“ und Alexandra Braun von der gemeinnützigen Pacemaker Initiative verriet, wie sich der Gemeinschaftssinn in Kollegien stärken lässt – um nur einige Beispiele zu nennen.
Hinter der veranstaltenden aim steckt die Dieter Schwarz Stiftung, die in Heilbronn einen imposanten Bildungscampus aufgebaut hat (auf dem sich 16 Institutionen – von einer Erzieherakademie über das Science Center experimenta bis zu einer Dependace der TU München – tummeln). Dort, auf dem Bildungscampus, fand denn auch die Biko statt. Ein imposanter Ort, der durchaus als Symbol dafür stehen kann, dass sich für Bildung in Deutschland doch noch einiges bewegen lässt.
„Der heute 18-Jährige hat ein funktionierendes und verlässliches Deutschland nie kennengelernt“
Zurück zur Keynote. Was hat ein heute 18-Jähriger denn bislang erlebt, wollte Kurtenbach wissen, um die Frage selbst zu beantworten: Erst die Flüchtlingskrise 2015, die viele Schulen an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit brachte, dann Corona mit den Schulschließungen, anschließend der Krieg in der Ukraine (samt erneuter in den Schulen anbrandender Flüchtlingswelle) – und jetzt die Debatte über Wehrpflicht, bei der junge Menschen nicht zu Wort kämen. Vom jahrzehntelang geltenden Versprechen „Aufstieg durch Bildung“ sei wenig übriggeblieben. Kurz: „Der heute 18-Jährige hat ein funktionierendes und verlässliches Deutschland nie kennengelernt.“
Die deutsche Gesellschaft stecke in drei Schieflagen: einer demografischen („Es gibt doppelt so viele 60-Jährige wie Sechsjährige“), einer demokratischen („Bis Ende des Jahrzehnts ist die Mehrheit der Wahlberechtigten im Rentenalter“) und einer sozialstaatlichen – immer mehr Steuergeld müsse aufgewendet werden, um das Rentenniveau aufrecht zu erhalten. In dieser Situation leiste es sich Deutschland, jedes Jahr rund 50.000 Jugendliche ohne Abschluss in die Perspektivlosigkeit zu entlassen. Kurtenbach: „Das ist eine Katastrophe in der alternden Gesellschaft.“
Zusätzlich fatal: Solche Bildungsprobleme fallen kaum jemandem mehr auf. Als die erste PISA-Studie im Jahr 2000 erschien, löste sie einen breiten „Schock“ aus. Die jüngste PISA-Studie, noch desaströser, war nach drei Tagen aus den Schlagzeilen verschwunden. Kein Wunder, so Kurtenbach: Vor 25 Jahren waren Eltern noch die größte gesellschaftliche Gruppe. Heute sind sie eine Minderheit. „Bildungsprobleme werden behandelt wie Minderheitenprobleme“ – also im Zweifel ignoriert.
Dabei seien die Herausforderungen für die Bildungseinrichtungen enorm. Die Gesellschaft habe sich drastisch verändert – nicht allein durch Migration. „Es gibt heute nicht eine Kindheit, es gibt viele“, erklärte Kurtenbach. Familie, Lebensumfeld, Zugang zu Kultur und Sprache: Die jeweiligen Perspektiven der Jüngsten seien so unterschiedlich, dass mit dem Modell der Schule alter Prägung, die für alle die gleichen (mageren) Ressourcen vorsehe, nichts mehr zu gewinnen sei. Sie bringe nicht die Struktur mit, um den individuellen Bedürfnissen gerecht werden zu können. „Wir brauchen eine andere Haltung“, forderte der Politikwissenschaftler – nämlich eine, die vom Kind aus denke.
Doch wie soll das gehen, wenn Lehrkräfte schon jetzt damit überfordert sind, die Mindeststandards zu vermitteln? Die Lösung der Wissenschaftler: Schule sozialräumlich zu öffnen, sie zum „Mittelpunktsort“ einer Nachbarschaft zu machen, die sich nach Kräften um ihre Kinder kümmert. Vereine, Initiativen, sogar Arbeitsplätze für Elternteile, die im Homeoffice arbeiten, ließen sich dort ansiedeln. Dabei seinen „Großeltern ein unglaubliches Potenzial“. Denen sei nämlich nicht egal, wie es ihren Enkeln gehe. Und sie seien, Boomer eben, viele. Kurtenbach: „Wenn wir nur zehn Prozent von ihnen dazu bringen, sich ehrenamtlich für Schulen zu engagieren, dann sind das mehr Menschen als alles pädagogische Personal zusammen.“
Fast nahtlos fügte sich ein Vortrag von Prof. Anne Sliwka an, die darin gleichfalls das gesamte System in den Blick nahm. Der nicht minder ambitionierte Titel: „Paradigmenwechsel in der Bildung“. Spannend daran vor allem: die überzeugende Analyse, dass alle Bemühungen um bessere Bildungsleistungen Flickschusterei bleiben müssen, solange das große Ganze in der Betrachtung außen vor bleibt: das Schulsystem eben. Dieses müsse sich grundsätzlich wandeln – von einem verwaltenden hin zu einem lernenden. Wie das? Die Bildungsforscherin verwies darauf, dass alle Staaten, die bei PISA vor Deutschland lägen, vor allem datengestützt arbeiteten, um Probleme im Bildungssystem zu erkennen – und dann auch lösen zu können.
„Das Geld muss dahin fließen, wo das Problem ist“
PISA, IQB-Studie, Vera, IGLU: Auch in Deutschland würden zwar Leistungsdaten in Schulen erhoben. Sogar viele. Allerdings weitgehend sinnlos. Denn die Daten würden erhoben, ohne daraus Ziele abzuleiten – weshalb sich außer dem immer wiederkehrenden Befund „schlimm, schlimm“ praktisch nichts ändert. Maßnahmen würden von der Politik in Kraft gesetzt (Beispiel Sprach-Kitas) und dann wieder gestrichen, ohne dass das Ursprungsproblem einer Lösung nähergekommen sei. Von Strategie keine Spur.
Dabei gehe es vor allem darum, Ressourcen dorthin zu lenken, wo sie tatsächlich benötigt werden („Das Geld muss dahin fließen, wo das Problem ist“). Mitunter helfe es schon, Hindernisse anhand von Daten überhaupt erst einmal wahrzunehmen – und dann mit Betroffenen zu sprechen. Sliwkas Beispiel: Dass Jungen im Schnitt eine schlechtere Lesekompetenz in der Grundschule aufweisen als Mädchen, sei ein Befund, der vielfach durch Studien belegt sei. Wer dann Schüler befrage, warum sie nicht so gerne lesen, komme schnell darauf, dass ihnen offenbar zu selten in der Schule geeignete Inhalte angeboten würden („Was uns interessiert, kommt halt nicht.“). Hier liegt die Lösung auf der Hand.
Bei anderen Themen – etwa Schulabbruch – sind die Probleme deutlich komplexer und eben nicht durch den persönlichen Einsatz einzelner Lehrkräfte lösbar. Stünden den Kollegien (bestehend aus multiprofessionellen Teams) allerdings umfassende Daten ihrer Schülerinnen und Schüler zur Verfügung und würden diese Daten durch professionelle Software nutzerfreundlich aufbereitet, ließen sich individuelle Warnzeichen leicht erkennen: Leistungseinbrüche in mehreren Fächern, familiäre Probleme, sozial auffälliges Verhalten. Dann ließe sich durch Intervention einer Vertrauensperson gegensteuern. „Das kann Schulabbruch verhindern. Wir müssen halt früh merken, wenn Handlungsbedarf besteht“, betonte Sliwka.
Und war damit sehr nah an Kurtenbachs Forderung, die Schule vom Kind aus zu denken. Andrej Priboschek
„Unfassbar große Lücken”: Was die Frauenerwerbsquote mit dem Bildungsnotstand zu tun hat
Ich finde solche Aussagen unglaublich undankbar und außerdem wirklichkeitsfremd, weil alles, was unser Land für Kinder tut, dabei wieder einmal total ignoriert wird. Man nimmt es, “füllt sich die Taschen”, und jammert munter weiter. Man vergleiche doch einfach mal Deutschland mit Ländern der sogenannten Dritten Welt.
Hier gibt es, die genaue Zahl weiß ich nicht mehr, 150 (?) sozialpolitische Maßnahmen für Kinder. Es gibt Kindergeld, es gibt den Kinderfreibetrag, es gibt den Erziehungsfreibetrag, die gesamte Schulbildung ist kostenlos, manchmal auch schon die Kindergärten oder einzelne Jahre, auch die Berufsausbildung ist weitgehend kostenlos, teilweise bekommt man Geld dafür, dass man sich ausbilden lässt (neuerdings Lehrer in einem Bundesland, Sachsen-Anhalt???). Es gibt jede Menge Ermäßigungen für Kinder bei allen möglichen Veranstaltungen. Es gibt teilweise kostenfreies Mittagessen (Berlin); es gibt den kostenfreien Nahverkehr (Berlin), kostenlose Zahnprohylaxe jedes Schuljahr, kostenlose Verkehrserziehung, kostenloser Schwimmunterricht, es gibt Kostenerstattungen für Kinder aus “Hartz-IV-Familien”; es gibt die Mitversicherung (kostenfrei) der Kinder in den gesetzlichen Krankenversicherungen der Eltern und und und … man möge selbst ergänzen.
Das alles, ich sage es noch einmal, wird genommen und dann wird wieder neu gejammert. Was sind das nun für Leute!?!
Und dass mit Milliarden die Renten gestützt werden, ist nur recht und billig. Die alten Leute haben dieses Land aufgebaut. Sie haben mit ihren Steuern all das oben Genannte mitfinanziert und nicht wenige leben jetzt von einer Rente, die so gering ist, dass sie sich wenig leisten können und nebenbei Flaschen sammeln müssen.
Ich finde, Politikwissenschaftler Prof. Sebastian Kurtenbach sollte sich schämen!!!
Pflege wird immer teurer, Pflegeheime sowieso, nicht weniger Rentner, die ihr Leben lang schwer gearbeitet und gespart haben, sind gezwungen, Grundsicherung zu beantragen, wenn sie ins Pflegeheim kommen. Die Zuzahlungen werden immer höher, da gibt es Posten, die auch Privatkassen nicht übernehmen wollen.
Wie Recht Sie haben. Die Liste könnte lange fortgesetzt werden. Es gibt das Elterngeld, ein Jahr lang, bis zu 1800 Euro monatlich vom Staat, damit man zuhause bleiben und seine Kinder betreuen kann. Deutschland tut nichts für seine Kinder? Und wie Sie so schön sagen, die gesamte Krankenversicherung über die Eltern, die gesamte Schul- und Berufsausbildung bis hin zum Uniabschluss mit 31… Wer finanziert das alles denn? Woher nimmt man das Geld dafür? Das zahlen alle, die Steuern zahlen und das waren auch immer “die jetzt Alten”!
Danke, so in der Art wollte ich auch schreiben. Man hat diese Jamertiraden nur noch satt!
Wer sowas schreibt, sollte sich schämen.
Da hätte ich ja gerne mal Argumente. Was davon ist falsch, was “Nanu” schreibt? Es stimmt alles. Das Millionen und Milliarden für die Kinder und alles ist bereits abgehakt und vergessen. Kostenlose Schul- und Berufsbildung, da war mal ein Traum. Kostenlose Mitversicherung bei den Eltern. Davon träumt man in anderen Ländern der Welt. Elterngeld ein ganzes Jahr lang und dann noch für den Vater extra, wenn der auch mit macht. Wo gibt es das noch auf der Welt?
Und jetzt Ihre Argumente!
… und Rentner in anderen Ländern der Welt, zu früheren Zeiten und in Zukunft sind weit von dem entfernt, was den heutigen deutschen Rentnern selbstverständlich zu sein scheint : Große Singlewohnung, Reisen, Unternehmungen, Auto trotz Sehschwäche noch fahren – hauptsache mobil, keine verbindlichen Aufgaben für Kinder und Enkel.
Zum Glück WOLLEN viele für die Enkel da sein und ehrenamtlich tätig sein, sonst sähe es übel aus.
Alle Rentner leben so, wie Sie das beschreiben? Interessant…
“Und dass mit Milliarden die Renten gestützt werden, ist nur recht und billig. Die alten Leute haben dieses Land aufgebaut. Sie haben mit ihren Steuern all das oben Genannte mitfinanziert und nicht wenige leben jetzt von einer Rente, die so gering ist, dass sie sich wenig leisten können und nebenbei Flaschen sammeln müssen.
Ich finde, Politikwissenschaftler Prof. Sebastian Kurtenbach sollte sich schämen!!!”
Wir haben halt ein Umlageverfahren in den Sozialsystemen. Die Rücklagen reichen jeweils keine 6 Monate.
Erste “Bürgerpflicht” daher:
Nachwuchs in die Welt setzen!
Und die “alten Leute, die dieses Land aufgebaut haben”, waren da etwas zurückhaltend.
Und jetzt ist man halt auf eine Fachkräfteeinwanderung angewiesen. Die Einwanderung findet allerdings eher in die Sozialsyssteme statt…
Mit 1,38 Kindern je Frau ist die aktuelle Elterngeneration aber m.M. auch nicht gerade in der Position da große Kritik zu üben. Ohne die zugewanderten Frauen wäre deren Quote sogar noch niedriger.
Wir haben 4 Kinder großzuziehen, einer ist bereits erwachsen und berufstätig, und wir werden hier wegen der Anzahl der Kinder schäl angesehen.
Wenn man dann in der Arbeit noch als bester Stecher verhöhnt wird,
dann wird einem übel zum fremdschämen.
Stimmt.
Letztlich muss jede Generation mit den Konsequenzen leben.
Oder akzeptieren, dass die eigenen Kinder eine höhere Belastung tragen.
Das ist nicht in Stein gemeißelt. Das kann man ändern. Ich sage, “Basisrente” für alle und wer mehr haben will, muss selbst dafür sorgen.
Das wäre richtig.
Wer ist “alle”? Aucfh die, die nie gearbeitet haben? Das soll gerecht sein? Und die Pensionäre mal wieder ausgenommen?
Sie sollten sich umfassender informieren.
An welcher Stelle widersprechen Sie mir?
Diese “Alten” haben mehr und länger einbezahlt, als es die jetzigen Generationen je tun werden, außer die Beiträge gehen exponentiell in die Höhe. Natürlich ist es ein Umlagesystem, aber z.Zt. der jetzigen Alten wurde die prall gefüllte Rentenkasse extrem zweckentfremdet, und dieses Geld wird auch mit den Zuschüssen bei weitem nicht ausgeglichen. Die heutigen “Alten” haben sehr wohl Kinder gehabt, die Familie war da noch ein Begriff. Und sie haben diese Kinder selbst erzogen, da es keine Kitas gab, meistens haben die Mütter ihre Karriere dafür eingschränkt und schauen jetzt bei der Rente in die Röhre, haben dem Staat aber oft 2-3 gute Steuerzahler präsentiert, da man noch den Leistungsgedanken vermittelt hat.
Und die jetzigen Rentner sollen wohl dafür verantwortlich gemacht werden, dass das Sozialgefüge total aus dem Gleichgewicht gekommen ist, da wir immer weniger Einzahler haben? Und das liegt wahrhaftig nicht nur am Fachkräftemangel bei 3 Millionen gemeldeten Arbeitslosen, von denen sicher nicht mal die Hälfte berechtigt arbeitsunfähig ist (meine Schätzung). Dazu kommt, dass die verbleibenen Arbeitskräfte immer mehr belastet werden und dann von sich aus auf Teilzeit gehen, da sie das Pensum nchht mehr schaffen und es auch noch ein Leben neben der Arbeit gibt.
Und dafür sollen nun die Rentner bestraft werden? Sicher kann man nicht pauschal sagen, dass die Situation auf alle zutrifft, aber die Entwicklung ist sichtbar.
Das Gejammere und Geschimpfe vieler jungen Leute geht mir gehörig auf die Nerven, die meisten von ihnen sollten erstmal wirklich etwas leisten, bevor sie über die (erfahrenen und abgearbeiteten) “Alten” urteilen.
Da passt was zeitlich nicht zusammen.
Die Geburtenrate liegt bereits 1970 bei ca. 1,5 Kindern pro Frau.
https://www.dw.com/de/geburtenrate-sinkt-deutschland-%C3%BCberaltert/a-54389384
Heißt:
Dass die letzte Generation, die “ausreichend” Kinder in die Welt gesetzt hat, um 1950 herum oder früher geboren wurde. Sprich heute mindestens 75 Jahre alt sind. Hier gelten Ihre Ausführungen zur “eingeschränkten Karriere” der Mütter.
Die Boomergeneration zählt definitiv nicht dazu und hat diesbezüglich einen “miesen” Job gemacht – ohne sich einschränken zu müssen. Und alle nachfolgenden Generationen ebenfalls – bis heute.
Insofern ist genau hier ein Anhaltspunkt für das ungleiche Verhältnis von Einzahlern zu Rentnern.
Ist einfache Mathematik: (“Volkshochschule Sauerland reicht da” / Franz Müntefering). So lässt sich das System nicht finanzieren.
Im Moment werden die kommenden Generationen hierfür die Rechnung zahlen und das System wohl am Laufen halten.
Aber wie ich Ihrem letzten Absatz entnehmen kann, sind Ihre Sympathien für diese Gruppe ja begrenzt.
Und Ihren ersten Absatz hätte ich gerne einmal mit Zahlen hinterlegt. Sehe dafür keinen Anhaltspunkt. Eher das Gegenteil.
Es ist Ihre Methode, berechtigte Argumente zu ignorieren und nur die wenigen Schwachstellen herauszusuchen, auf denen Sie dann herumreiten. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass dieses ständige Eindreschen auf die Rentner komplett daneben ist, Sie werden sicher auch mal Rentner.
Nein, da liege ich falsch, Sie werden eine üppige Pension beziehen. Na dann ……
Es ist schon mehr als bezeichnend, wie die künftigen Pensionisten, die mal mit üppigen Zahlungen sorgenfrei ihren Ruhestand genießen dürfen, hier über Rentner urteilen, die in diskriminierender Weise (ich vergleiche hier angestellte mit verbeamteten Lehrkräften) wesentlich weniger Ansprüche haben. Würden Sie mal Rente beziehen, wäre Ihre Argumentation mit Sicherheit anders gelagert.
Stromdoktor ist kein Lehrer und Pensionäre dürfen sich selbstverständlich mitgemeint fühlen.
Da ich kein Beamter und kein Lehrer bin, sammele ich fleißig Entgeltpunkte in der Rentenversicherung.
Ich habe zudem völlige Transparenz darüber, was ich zu erwarten habe und sorge entsprechend vor.
Ändert aber alles nichts an der Tatsache, dass es nichts zu verteilen gibt und dass es vor allem keine historisch erworbenen Ansprüche gibt.
Und ich habe deutlich und verständlich erklärt, warum es nichts mehr zu verteilen gibt.
Aber, aber!
Kinder bekommen ist doch unfeministisch und klimaschä…oh, oh, Mist, hab mich um 5 Jahre vertan, mein Fehler. 😀
Das sind die “Leute”, die dabei entstehen, wenn nix Konsequenzen hat…
“Man vergleiche doch einfach mal Deutschland mit Ländern der sogenannten Dritten Welt.”
Sie meinen die Situation der kids dort ?
Schön: wenn sie nicht gerade hungern, korrupte Machthaber Medikamente an andere verkaufen, sie als Kindersoldaten missbraucht werden, verkauft, versklavt werden, Ebola oder eine andere Seuche um die Ecke kommt……lebten ! viele in der Großfamilie sehr gut, erhielten durch die Unterstützung aus zB EUländern Grundbildung, wurden Handwerker, studierten…….
Dummerweise kamen aber auch die Zivilisationsmalaisen mit, Korruption, Geldgier, Neid – Situationen wie wir sie hier erleben nur etwa zB auf kongolesisch, mit ordentlich mehr Schmackes, bis hin zum Gemeucheltwerden.
Gut, dass es das hier nich gibt !?
Es gibt es, – zivilisierter? Wenn viele nach 40 Jahren von ihrer Rente nicht mehr leben können, mehr als ein halbes Jahr auf einen dringenden Facharzttermin warten müssen…… und auf der anderen jüngeren Seite Kinder vernachlässigt werden, hungern!, einseitig ernährt und bis zu Adipositas mediensediert werden.
“Wir müssen halt früh merken, wenn Handlungsbedarf besteht“, betonte Sliwka.
Und war damit sehr nah an Kurtenbachs Forderung, die Schule vom Kind aus zu denken.”
Der Handlungsbedarf beginnt schon lange vor der Reparaturwerkstatt Schule. Würde die Gesellschaft ” vom Kind aus denken” wären die Ersatzteilschrauber = Lehrer, Erzieher…. auch zufriedener, gesünder, jobglücklicher und Jüngere kämen nach.
Die (vlt wirklich teils zu jungen) Politiker (die Mischung passt wohl nicht) haben den Blaumann zu selten angehabt, wie sollen sie so ” den Handlungsbedarf früh merken “.
Ach so, den Handlungsbedarf früh merken sollen ja Lehrkräfte. 🙂
Lest doch mal n4t – auch für Whirlpoolianer und Dozenten geeignet
Die von Ihnen angeführten sozialpolitischen Maßnahmen,
genannt wurde von Ihnen u.a. das Kindergeld, der Kinderfreibetrag,
die z.T. kostenlosen Kita etc., stellen keinen Beitrag etwa
zur Verbesserung der Lesekompetenz von Jungen.
Es sind lebensverbessernde Grundlagen, die keinen Einfluss auf
die Lernleistungen der Schüler haben.
Warum sollte Herr Prof.S.Kurtenbach für seinen Vortrag entschuldigen ?
Sie haben sich da aber auch etwas herausgepickt. Sie nennen die sozialpolitischen Maßnahmen und ignorieren die anderen, die genannt wurden. Kommt es nicht den Kindern bildungspolitisch zugute, wenn Schule und (Erst-)Ausbildung in Deutschland kostenlos sind, mancherorts auch die Kita oder das letzte Kita-Jahr? Es hieß, Deutschland vergesse (bildungspolitisch) seine Kinder. Was glauben Sie, wer das alles bezahlt?
Bildung ist ein Grundrecht, und in einem hochentwickelten Sozialstaat
ist ein kostenloser Schulbesuch ein Grundrecht eines jeden Kindes.
Wir leben in Europa im 21.Jahrhundert.
Was glauben Sie denn ?
Dass wir keine Kitabeiträge bezahlt haben?
Es war immer der Höchstsatz.
Sie lenken ab. Ob etwas ein Grundrecht ist, ist Ansichtssache. Es ist bestenfalls zum Grundrecht erklärt worden. Es ist es nicht von selbst.
Sie machten Nanu den Vorwurf, nur sozialpolitische Maßnahmen genannt zu haben, die nichts mit Bildung zu tun haben. Das stimmte nicht. Was soll da jetzt der Einwurf, dass die Kita bei Ihnen nicht kostenlos ist?
Übrigens, sagte nicht Brecht, erst kommt der Hunger, dann die Moral.
Es handelt sich um einen Schulpflicht und hier steht mehr dazu:”Schulpflicht seit etwa 200 JahrenJedes Kind im Alter von sechs Jahren hat die Pflicht, in die Schule zu gehen. Genauer gesagt: Die Eltern müssen dafür sorgen, dass ihr Kind in die Schule geht. Diese allgemeine Schulpflicht, wie sie genannt wird, gibt es in Deutschland erst seit ungefähr 200 Jahren. Vorher hatten meist nur die Kinder reicher Eltern die Möglichkeit, von Privatlehrern oder in Kloster- oder Fürstenschulen das Rechnen und Schreiben zu lernen.”https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/das-junge-politik-lexikon/321098/schulpflicht/
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_7.html
“Bildung ist ein Grundrecht, und in einem hochentwickelten Sozialstaat
ist ein kostenloser Schulbesuch ein Grundrecht eines jeden Kindes. … Was glauben Sie denn?”
Und Sie meinen, man muss das nur sagen, dann ist es auch so?!? Sprich, Worte erschaffen die Realität?
Für gute Bildung und Erziehung in erster Linie finanzielle Gründe verantwortlich zu machen, ist viel zu bequem und kurz gesprungen.
Unselige Verschiebungen im pädagogischen Konzept- und Wertebereich zum angeblichen Kinds- und Jugendwohl sind m.E. ausschlaggebender.
Jahrelange Verteufelung von Anforderungen an sich selbst wie Selbstdisziplin, Anstrengungsbereitschaft oder auch Unterordnung hatte mit Geld nichts zu tun, sondern ausschließlich mit falscher Erziehungsideologie.
Vor allem Wunscherfüllung und geringe Anforderungen wurden von sogenannten Experten als Grundlage guter Entwicklung und fabelhaften Kompetenzerwerbs dargestellt. Alles andere galt nur als Drill, der die Eigeninitiative und Lernlust zerstörte. Lehrer sollten darum nur noch anregende, aber nicht fordernde Begleiter eines selbstorientierten Lernens sein.
Diese unrealistische, lebensfremde und keineswegs kindgerechte Bildungsideologie war und ist noch immer eine einzige Katatrophe. Leider hört sie sich kinderfreundlich und fabelhaft bildungsfördernd an – vor allem, wenn “Experten” das “wissenschaftlich begründet” sagen.
Der ständige Verweis auf mangelndes Geld für Bildung lenkt leider von anderen Ursachen des pädagogischen Desasters ab, die mit Geld herzlich wenig zu tun haben.
Wohl war, dass die sozialpolitischen Maßnahmen keinen Einfluss auf die Lernleistungen haben. Die Idee, ordentlich Geld in die Bildung zu bringen und dann steigen automatisch die Lernleistungen ist ein Trugschluss, ebenso wie die Idee, es müssten alle älteren ehrenamtlich im Schulbereich helfen, um die Karre aus dem Dreck zu ziehen.
Wir sind momentan in einem Schulsystem, welches völlig ineffizient arbeitet. Den meisten Beamten in den Schulbehörden geht es nicht in erster Linie um die Kinder, sondern um die eigene Bequemlichkeit, den Erhalt der Position und die Macht, die damit verbunden ist. Solange das so ist, wird die Schulsituation sich nicht wirklich bessern, -egal wie viele Millionen dort hereingepumpt werden.
Die Idee von Professor Kurtenbach, dass ehrenamtliche “Boomer” sich in der Schule engagieren sollen, um das System zu retten, ist kompletter Unsinn. Warum gehen denn Lehrer/innen vorzeitig aus dem Schulsystem? Weil sie sehen, dass selbst mit massiver Anstrengung in diesem Schulsystem nichts besser wird und dies Frust ohne Ende erzeugt. Eine ehrenamtliche Mitarbeit kann man unter den Bedingungen nur als Zumutung bezeichnen.
Solange in der Schulverwaltung die Kinder keine Rolle spielen und dort Beamte sitzen, die kein Interesse an Änderungen haben, kann man nur schreiend weglaufen.
Wir brauchen nicht mehr Engagement, wir brauchen eine komplett andere Art von Schulbehörden, die bereit sind, mit Lehrer/innen auf Augenhöhe zum Wohle der Kinder zusammenzuarbeiten. Davon sind wir im Moment Lichtjahre entfernt!
Ein wenig übertreiben Sie im Schlusssatz schon.
Und was ist mit den Lernmethoden, dem negativen
Einfluss des eigen initiativen Lernen in den ersten
zwei Schuljahren, dem strukturierten Vermittlung der
automatisierten Lese-und Schreibfähigkeit ?
Sie benötigen für gezielte Förderung auch mehr Personal.
Und das kostet deutlich mehr als jetzt ausgegeben wird.
50.000 Schüler-und Schülerinnen pro Jahr ohne einen
Schulabschluss stellen schon eine bedeutende Herausforderung dar,
um diese Zahl zu vermindern.
Der Vergleich mit den Bundeszuschüssen zur Rentenversicherung erscheint mir auch eher abstrus, da wegen der Zuständigkeit der Bundesländer m.M. keine Konkurrenz zu Bildungsausgaben für Schulen besteht. Dass die jährlichen Bildungsausgaben pro Schüler*in auch inflationsbereinigt aktuell deutlich höher liegen als noch zu Zeiten als die jetzige Rentnergeneration noch zur Schule ging, lässt sich wohl auch kaum leugnen.
Es hilft nur nichts, wenn diese Maßnahmen ins Leere laufen, lediglich Mitnahmeeffekte erzeugen oder gar Fehlanreize schaffen.
Niemand bekommt ein Kind mehr oder weniger, weil das Mittagessen in der Schule kostenfrei ist. Für Gutverdienende ist es ein Mitnahmeeffekt. Für Geringverdienende oder Nichtverdienende ist es aufgrund von BuT nicht relevant.
Das sehe ich auch so. Es bekommt auch niemand 1 Kind (mehr), um damit das gegenwärtige Rentensystem zu sichern.
Der Politikwissenschaftler Prof, Sebastian Kurtenbach hat
lediglich seine Meinung geäußert, mehr nicht.
“Vor 25 Jahren waren Eltern noch die größte gesellschaftliche Gruppe.
Heute sind sie eine Minderheit. „Bildungsprobleme werden behandelt wie Minderheitenprobleme“ – also im Zweifel ignoriert,” und weiter
“Die deutsche Gesellschaft stecke in drei Schieflagen: einer demografischen („Es gibt doppelt so viele 60-Jährige wie Sechsjährige“), einer demokratischen („Bis Ende des Jahrzehnts ist die Mehrheit der Wahlberechtigten im Rentenalter“) und einer sozialstaatlichen – immer mehr Steuergeld müsse aufgewendet werden, um das Rentenniveau aufrecht zu erhalten.”
Das sind Fakten, und diese wirken sich auf die Verteilung der sozialpolitischen Ressourcen aus.
Hier der Rentner Lobby voll im Einsatz! All was sue erläutern ist súper für geringverdiener, Hartz IV, usw, aber für Familien die gut in einer teuren Stadt wohnen ist es Leider zu wenig. Alles ist zu teuer geworden. Vor allem die Mieten sind unbezahlbar. Bei uns hat nur mein Vater gearbeitet und wir waren vier Kinder, wir hatten alles, er hatte einen normalen Job. Jetzt arbeiten wir beide, Führungskräfte, und es reicht nicht um ein ähnliches Leben zu führen.
Meiner Meinung nach ein ziemlich unsinniger Vergleich, den Bundeszuschuss zur Stützung der Rentenversicherung gegen die Bildungsausgaben für Schulen auszuspielen, die ja Sache der Bundesländer sind. Und dass die Bildungsausgaben pro Schüler*in den Bundesländern ganz erheblich voneinander abweichen, so wie die Quoten an Schüler*innen ohne Abschluss oder jungen Menschen ohne Berufsabschluss auch , wäre eigentlich auch kein Geheimnis. Da gibt es zwischen den BL mit den niedrigsten und höchsten Quoten z.T. mehr als 100% Abweichung.
Ist halt ungerecht für die “jungen Leute”…
Vor 2015 haben wir uns über den demografischen Wandel fast abgeschafft und tendierten auf eine Bevölkerungsanzahl von unter 80 Millilonen.
Bereits da gab es zu wenig Einzahler in die Sozialsysteme aufgrund des stetigen Geburtenrückgangs.
Seit 2015 haben wir die Gesellschaft im Zuge der Migration verjüngt und die Bevölkerungsanzahl in Richtung 85 Millionen bewegt.
Damit verbunden die Hoffnung, den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel zu beseitigen.
In der Realität gab es vor allem eine Einwanderung in die Sozialsysteme mit einem entsprechenden Qualifizierungsbedarf.
Diesen hat man auf die Schulen abgeladen und die Einrichtungen komplett überfahren. Dabei sinkt das allgemeine Niveau und der Fachkräftemangel verschärft sich.
Die wenigen Leistungsträger, die den Laden am Laufen halten sollen, verdienen generationenübergreifend unsere Unterstützung.
Für die politischen Entscheidungen der Merkel-Ära können diese noch am wenigsten. Z.T. durften die da noch nicht einmal wählen.
Meine Meinung.
Aber wo sehen die Konkurrenz von Rentenzuschüssen und Bildungsausgaben? Glauben Sie , dass z.B. in NRW die Bildungsausgaben für Schulen steigen würden, wenn der Bund weniger Geld in die Rentenkasse einzahlen würde? Übrigens lagen die Tarifbeiträge zur RV früher lange Jahre über 19% bis zu 20,3% .
Die Zusammenhänge sind natürlich komplex und auch ein wenig undurchsichtig. Ich antworte dabei auch auf Ihren Beitrag unten.
In erster Linie wird Politik für die größte Wählergruppe gemacht – “die Rentner”. Auf Bundes- und Landesebene.
Das führte dazu, dass sich die Bildungs- und Betreuungsangebote eher stagnierten. Zu große Klassen, marode Infrastruktur, zu wenig KiTa-Plätze, zu wenig Sprachangebote.
Auf der Bedarfsseite hat ebenfalls etwas getan. Mehr erfordliche Integrationsarbeit, wachsende Zahl erwerbstätiger Frauen, weniger generationenübergreifende Unterstützung für Familien, allgemeiner Egoismus, Verrohung der Gesellschaft.
Insofern muss man mehr Geld in die Hand nehmen, um das selbe Niveau zu erreichen. Höhere Bildungsausgaben führen also nicht zwingend zu einem höheren Niveau.
Nicht eingerechnet dabei die Effizienzverluste durch ständige Umstrukturierungen von Schulen sowie die steigende Bürokratie auch in dem Bereich.
Mein Punkt:
Früher und aktuell leben wir in allen Bereichen der Sozialsysteme von der Hand in Mund. Die Nachhaltigkeit ist aber durch den demografischen Wandel und die Entwicklungen im Bürgergeld nicht mehr gegeben.
Die staatlichen Zuschüsse für die KK reichen nicht aus, um die aus der selben Kasse finanzierten Ausgaben für die Bürgergeldempfänger zu decken. Im Ergebnis explodieren die Zusatzbeiträge.
Die Rentenversicherungsbeiträge waren tatsächlich schon einmal höher. Die positive wirtschaftliche Entwicklung mit Halbierung der Arbeitslosenzahlen von 13% auf 6% haben eine Senkung bewirkt.
Es ist aber nicht zu erwarten, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. Demzufolge geht man von steigenden Abgaben auf bis zu 50% bis 2050 aus.
Damit das nicht so kommt, müssen entweder die Menschen länger Arbeiten oder die Erwerbsquote bleibt weiterhin hoch bzw. entwickelt sich trotz abgängige Boomergeneration positiv.
Um Ihre konkrete Frage zu beantworten:
Ich glaube, man müsste die Anzahl der Erwerbstätigen stabil halten (weniger Teilzeit, länger Arbeiten), mehr Leute in gut bezahlte Arbeit bringen (Bürgergeldempfänger, Fachkräfteeinwanderung) und die gesellschaftlichen Gesamtkosten (Unterbringung, Qualifizierung, Sicherheit, Integration) der irregulären Migration verringern, um wieder mehr Geld auf Landes- und kommunaler Ebene für Investitionen verfügbar zu haben.
Damit könnte man dann auf die neuen Herausforderungen reagieren und die Klassen drastisch verkleinern, um perspektivisch mehr Leute zu qualifizieren.
https://www.zdf.de/video/reportagen/die-wahrheit-ueber-100/die-wahrheit-ueber-unsere-rente-100
Vor dreißig Jahren betrugen laut IW Köln die bundesweiten durchschnittlichen Bildungsausgaben pro Schüler*in 3600 € das wären heute inflationsbereinigt ca. 6000 € . Laut letzter Statistik wären es aber 9.800€. Auch wenn man die Meinung vertritt, das wäre immer noch zu wenig, ist es doch ganz wesentlich mehr als zur Schulzeit der Generationen, denen nun vorgeworfen wird auf Kosten der jetzigen Schüler zu leben.
Seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten werden junge und immer jüngere Leute als Politiker für Parlamente aufgestellt und man feiert sich dafür, dass man damit ein Signal setze und etwas für die Jungen tue. Diesmal ist der jüngste neue Abgeordnete im Bundestag 23 Jahre alt. Das ist pure Symbolpolitik! Da sitzen dann Leute im Parlament, die noch nie gearbeitet haben, und entscheiden über das Schicksal von 80 Millionen. Wie entscheiden die denn? Warum entscheiden die nicht im Sinne der “Jungen”? Die machen, was die Parteiführung vorgibt, weil es so lukrativ im Parlament ist und sie das nicht mehr verlieren wollen. Und jedes Jahr hört man wieder die gleiche hohle Phrase, die Politik tue zu wenig für die jungen Leute.
Letzter Bundestag bis 2025:
Durchschnittsalter von 47,3 Jahren
Das Durchschnittsalter aller Abgeordneten beträgt 47,3 Jahre, bei den Frauen 45,5 Jahre und bei den Männern 48,2 Jahre. Am höchsten ist es bei der AfD mit 51,0 Jahren, gefolgt von der Linken mit 50,2 Jahren, der CDU mit 49,5 Jahren, der CSU mit 48,7 Jahren, der FDP mit 47,5 Jahren, der SPD mit 46,1 Jahren.
Ich behaupte (ohne Prüfung):
Es gibt mehr Parlamentarier im Ruhestandsalter (>65) als Abgeordnete unter 30 Jahren…
Unser nächster Kanzler wird im November 70 Jahre “jung”.
Und was ändert das daran, dass die jungen Leute im Bundestag keine Lebenserfahrung haben und anscheinend auch nichts weiter für ihresgleichen durchsetzen? Es gibt sie doch.
Die Antwort liegt sicherlich darin, dass es zu wenige “junge Leute” gibt, die auch nicht in den entscheidenden Positionen sind.
Der Vorsitzende der jungen Union ist 1991 geboren.
Man wird da praktisch bis Mitte 30 per Definition von “richtiger Politik” ausgeschlossen.
Der Generalsekretär der Union wird 48 Jahre alt und ist in 20 Jahren wahrscheinlich Kanzlerkandidat.
Ausgeschlossen, dass bei uns jemand Kanzer mit unter 40 Jahren wird (beispielsweise Finnland).
https://www.kas.de/de/web/geschichte-der-cdu/generalsekretaere
Dann berechnen Sie aber auch, dass man mit 80 zwar wählen darf und mit 8 noch nicht, man aber mit 80 mitunter nicht mehr arbeiten oder “regieren” kann und logischerweise auch nicht mit im Parlament sitzt.
Ja. Ist kein Widerspruch.
Die Wertschöpfung wird aber von der erwerbstätigen Bevölkerung erbracht. Diese Gruppe wird immer kleiner im Vergleich zu den Rentnern (18,6 Millionen).
Politik wird für die größte Wählergruppe gemacht. Diese ist widerum repräsentativ vertreten.
Gebe es die direkte Demokratie bei uns, würden ähnlich entschieden werden:
https://www.deutschlandfunk.de/mehrheit-der-schweizer-fuer-13-rentenzahlung-streit-ueber-finanzierung-100.html
Es gibt viele Menschen, die mit 23 schon einige Jahre arbeiten. Nicht alle studieren. Und nicht alle, die studieren, studieren viele Semester.
Das ändert doch nichts an dem Umstand, dass man mit 23 noch sehr wenig Lebenserfahrung hat. Haben Sie im Laufe Ihres Lebens nicht schon einige Ansichten stark verändert? Oder steht Ihnen das erst bevor?
Ja, die ideologischen Studenten aus den 20ern verändern ihre Ansichten stark, sobald sie zu den Gutverdienern in den 30ern/40ern gehören und finden ihre Eltern, die sie für Wohlstand aufs Gymnasium prügeln wollten auch nicht mehr falsch, sondern machen es bei ihren Kindern dann genauso. 😉
Nicht gesagt, dass das immer eine “Weiterbildung” ist.
“Schule sozialräumlich zu öffnen, sie zum „Mittelpunktsort“ einer Nachbarschaft zu machen”
Wir sind also am Arsch… Danke für die wissenschaftliche Einschätzung!
Aber OK, Plan A ist darauf zu hoffen, dass die künftigen Rentner*innen etwas der Gesellschaft zurückgeben wollen, anstatt sich von einem harten Arbeitsleben erholen zu wollen (müssen!)
Ich meine, was sollen wir sonst machen, außer die Alten nach ein paar Jahren kostenloser Arbeit auszuschütteln? Vermögenssteuer? 😉
Die Ehrenamtlichen sind JETZT schon im Einsatz, ohne eine Empfehlung! Jede Woche danke ich meiner Lesepatin für ihren Einsatz und ihre engelsgleiche Geduld (u.a. mit meiner Planlosigkeit).
Eines der reichsten Länder der Welt (ja, immer noch!) bettelt um Freiwilligenarbeit, damit das Bildungs”system” noch ein paar Jahre durchhält…
Peinlich, dass politische Weichenstellungen den Senior*innen offenbar nicht zugemutet werden :/
Das liegt auch daran, dass die Masse der Senioren politisch als Wähler einfach zu wichtig ist, als dass man ihr Abstriche zumutet…..
Mensch Rainer, Ihre letzten Kommentare sind irgendwie anders….reflektiert, verständlich und ohne Provokationen / seltsamer Fragen….danke!
Gewöhnen Sie sich nicht daran 😉
Schade, auch ich hatte mich bereits gefreut! 😉
Stimme zu!
Vor allem diese Bemerkung…
„Wenn wir nur zehn Prozent von ihnen dazu bringen, sich ehrenamtlich für Schulen zu engagieren, dann sind das mehr Menschen als alles pädagogische Personal zusammen.“
.. ließ bei mir die Warnsignale angehen:.
Bahnt sich da wieder mal ein “machen die Ehrenamtler schon” an?
Damit dann das System eben nicht umgekrempelt werden muss?
Damit dann eben nicht mehr Geld und bessere Bedigungen für die ausgebildeten und auszubildenden Kräfte im Bildungssystem hergenommen werden muss?
So sehr ich Frau Merkel auch zustimme in ihrer damaligen Aussage “Wir schaffen das!” –
so sehr habe ich auch Angst, dass “die Boomer in die Schulen – und wir schaffen das…” so oder ähnlich wieder dazu führt, dass das System bleibt wie es ist und die Fachkräfte weiter ausbrennen, Schule von Menschen aufrecht erhalten wird, die selbst schon in genau diesem System groß geworden sind. Obendrein zahlen die Ehrenamtler meist noch drauf: sie tanken ihr Auto auf eigene Rechnung, kommen für ein, zwei Stunden und fahren wieder, nicht mal ein freies Ticket ist drin; sie bringen teilweise Material mit in die Schule (manchmal auch anderes, als der Lehrer vorgibt, worüber es dann Diskussionen gibt).
Oftmals müssen wir – aus der Zwischengeneration – uns regelrecht gegen Ehrenamtler wehren, die meinen, sie könnten es “von Alters wegen” eh besser als wir Lehrer. Kuriose Dialoge manchmal… das kostet uns zusätzlich Zeit und Nerven, um des lieben Friedens willen und damit die Leute nicht verschreckt werden, kümmern wir uns um sie.
Ehrenamt ist nicht die Lösung, sondern darf bestenfalls ein Teil einer Lösung sein.
Wie soll sich sonst grundlegend etwas ändern?
Übrigens: Ich kann mir für mich nicht vorstellen, nach dem Ende meiner Dienstzeit Schule weiter am Laufen zu halten!! Dazu müsste sich sehr viel ändern!
Wir sehen es am Lehrernachwuchs: Die jungen Leute verteidigen das ihnen bekannte System in vielen Fällen mehr als die Kollegen meiner Generation!
Scheint, als merkten sie nicht mal mehr, dass etwas nicht stimmt!
Die, die es merken, bleiben nicht!
Ich kann Ihre Empörung schon nachvollziehen. Wenn meinen Informationen stimmen, lagen die absoluten Bildungsausgaben pro Schüler*in in Ihrem Bundesland ja auch bei der letzten Statistik wieder unter dem Bundesschnitt, bei den relativen Bildungsausgaben für allgemeinbildenden Schulen wäre es laut Bildungsmonitor 2024 Rang 10.
Die Daseinsvorsorge gilt fuer alle: Kinder und Rentner also auch. Zu gleichen Teilen. Deswegen ist der Vergleich etwas spaltend
“Der heute 18-Jährige hat ein funktionierendes und verlässliches Deutschland nie kennengelernt.”
Was für eine Einschätzung! Und das wird noch hervorgehoben!
Ich setze jetzt auch mal ein Statement!
Die Bildungsforscher haben noch nie zwei Jahre am Stück mit den vorhandenen Mitteln an einer Schule gearbeitet und jeden Schüler, die sich in seiner Betreuung befindet, Lesen, Schreiben, und Rechnen beigebracht.
“Wer dann Schüler befrage, warum sie nicht so gerne lesen, komme schnell darauf, dass ihnen offenbar zu selten in der Schule geeignete Inhalte angeboten würden („Was uns interessiert, kommt halt nicht.“). ”
Schritt 1: Erst mal lesen lernen.
Schritt 2: Wenn du lesen kannst, da kannst alles selber lesen, was dich intressiert.
Schritt 1: Ist für viele harte Arbeit, in einer Zeit, in der sie lieber etwas anderes tun.
Es ist ein kontinuierliches Üben notwendig, alles auf freiwilliger Basis natürlich!
Schritt 2: Dann müsste sie erst mal etwas lesbares intressieren und sie auch bereit sein, etwas mehr als eine Seite zu lesen. (Gibt es einige, aber auch viele, die lieber etwas anderes tun)
Provaktiv gefragt man aber auch fragen: Warum lesen lernen! Heutzutage kann man doch jeden Text fotografieren und sich dann vorlesen lassen oder zukünftig wird der Blechkasten gefragt, und der informiert mich dann.
Erinnert mich an einen Gag, in dem man für über 50-Jährige einen VHS- Kurs mit dem Thema “Wie lese ich ein Buch” angeboten hat, weil sie aus der relevanten Fernsehgruppe rausgefallen sind.
Erinnert mich an einen Gag, …
…oder den Cartoon, auf dem ein Erstklässler seinen Lehrer fragt, warum er denn Lesen lernen solle, er könne sich doch eine Lesebrille kaufen. 🙂
Sicherlich gibt es im Bildungswesen und seiner Finanzierung noch Optimierungsbedarf. Wenn man aber bedenkt, dass die durchschnittlichen Bildungsausgaben pro Schüler*in im Vergleich z.B. zur Boomergeneration in den meisten Bundesländern erheblich stärker gewachsen sind als z.B. das reale BIP, dass sich das monatliche Kindergeld verzehnfacht hat, sich die Quote junger Menschen, die höhere Bildungsabschlüsse erreichen, mehr als verdoppelt hat, dass jungen Menschen aktuell wesentlich mehr Fördermöglichkeiten zur Bildungsteilhabe zur Verfügung stehen, die Jugendarbeitslosigkeit wesentlich niedriger ist, bei Ausbildungsstellen ein hoher Angebotsüberhang herrscht usw, usw., finde ich den Vergleich mit den Bundeszuschüssen zur Rentenversicherung und den Bildungsausgaben schon etwas an den Haaren herbeigezogen.
Die Hauptthese nach Politikwissenschaftler Prof. Sebastian Kurtenbach lautet, dass Deutschland kaum kindgerecht ist . denn sehr viel weniger Geld gelangt in Form von Investitionen ins Bildungssystem, während Milliarden zur finanziellen Absicherung im Rentensystem landen, wobei zeitgleich jedes Jahr Zehntausende Jugendliche ohne Abschluss zurückbleiben. Kindergeld, Ermäßigungen für Kinder, ob im Theater etc. oder Zuwendungen für Essen sind keine Investitionen is Bildungssystem. Hier werden von Ihnen beide Altersgenerationen gegeneinander ausgespielt, und das ist unangemessen. Satt und getränkt reicht nicht aus, um unser Bildungssystem zu verbessern.
Nicht Herr Prof. Sebastian Kurtenbach sollte sich schämen !
Vergleichen Sie einfach wie sich die jährlichen Bildungsinvestitionen pro Schüler*in in Ihrem Bundesland und im Bundesschnitt inflationsbereinigt über die letzten 30/20/10 Jahre so entwickelt haben, dann fallen Ihnen Schuldzuweisungen vielleicht leichter.
Das ist nicht nur inflationsbereinigt zu sehen. Oder meinen Sie 1% und 90% nicht deutsch Sprechender wäre das Gleiche? Nur ein Beispiel. Soll heißen, früher war auch weniger Geld notwendig. Ich weiß nur, dass wir damals so viele kleine Dorfschulen hatten, wo man sich wohl fühlen konnte , die heute alle dicht gemacht werden sollen. Wir hatten auf dem Dorf auch Sparkasse, Bäcker, Tankstelle,…. und sogar ein Krankenhaus mit Geburtstation in der Nähe – wird alles dicht gemacht, obwohl wir damals höchstens 60 Mio Bewohner in D hatten, heute 84 Mio. Komisch, oder?
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Bildungsfinanzen-Ausbildungsfoerderung/Tabellen/ausgaben-oeffentliche-haushalte.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Nachhaltigkeitsindikatoren/Generationengerechtigkeit/_inhalt.html#805474
Die gesamte Schulbildung ist kostenlos. DAS ist schon eine enorme Investition in unsere Kinder. Es wird nur leicht vergessen. Und nicht nur die gesamte Schulbildung ist kostenlos, auch die Berufsausbildung. Materialien, Gebäude, Löhne und Gehälter, letztendlich auch die Pensionen, die Beihilfen zur privaten Krankenkasse…….. ALLES ist für die Kinder, die das nutzen, direkt kostenlos. Sie können alles in Anspruch nehmen und müssen nicht direkt dafür zahlen. Indirekt natürlich schon, durch Steuern, wenn sie denn so viel verdienen bzw. nicht so diverse Freibeträge haben, dass sie (keine) Steuern zahlen müssen. Das Bildungssystem sind nicht nur die Lehrbücher, lieber AvL, das ist so viel mehr und das ist alles kostenlos !!!!!!!!!!!!!!!
Und es zahlt sich rechnerisch finanziell für die Gesellschaft positiv aus, all dieses im Rahmen der Schulpflicht auszugeben. Allerdings sind 50.000 Schüler und Schülerinnen ohne einen Schulabschluss bei zunehmender demographischer Alterung der Gesamtbevölkerung eine erhebliche Belastung für die zunehmend
prozentual abnehmende Zahl an Einzahlern in dieses System.
Warum die Professorin zum Beweis für Vorteile von Ländern mit datengeschützter Bildungspolitik gerade das Beispiel mit den beim Lesen abgehängten Jungen anführt, bleibt mir ein Rätsel. Bei PISA 2022 betrug der Abstand beim Lesen zwischen Mädchen und Jungen in Kanada ja 24 Pkt, in DE “nur” 19 Pkt. Der Anteil “low-performer” beim Lesen war bei den Jungen in Kanada um 57% höher als bei den Mädchen, in DE betrug die Abweichung “nur” 31%. Daraus könnte man aus meiner laienhaften Sicht nun wirklich keine Vorteile des kanadischen Schulsystems beim Thema Gendergerechtigkeit-Lesen bei PISA ableiten.
Man spricht über die heute 18jährigen, nennt 50000 ohne Abschluss, benutzt aber gleichzeitig Begriffe wie ‘vom Kind aus denken’ oder ‘viele Kindheiten’. Niedliche Grundschulkinder in bunten Klassenräumen, ohne eigenes Zutun vergessen, schöne Bilder im Kopf. Viel schöner als ‘mir egal’, ‘mache ich halt Hartz’ oder ‘in der Schule hat mir keiner was zu sagen’ und was es noch so alles gibt, bei denen, die eigentlich gemeint sind. Weiter oben schrieb jemand etwas von undankbar. Ich erwarte keine Dankbarkeit, aber alle in der Schule machen sich jetzt schon sehr viele Gedanken, um Jugendlichen auf ihrem Weg zu helfen. Selbst versuchen muss man es aber schon, nicht alles kann man ‘gamifizieren’, eigenes Interesse am weiteren Leben ist hilfreich und manchmal hilft schon eine minimale Frustrationstoleranz.
10% der Alten sollen ehrenamtlich helfen, das auch noch in den Schulen?Super, das dehnen wir auf Pflege, Bauhandwerk usw aus: Leute waschen kann jeder, in der Erde buddeln auch. Was sollen die denn machen?Schon mal versucht, mit Großeltern problemorientiert über ihre Enkel zu reden? Oder ihnen zu erklären, dass ‘Lebenserfahrung’ schön ist, aber nicht viel mit dem heutigen Leben ihrer Enkel zu tun hat? Dass Schule andere Wege und Ziele hat als liebevolle Großeltern?
Sind diese hilfreichen Großeltern eigentlich die gleichen Boomer, von denen die Hälfte sich nach dem 60.Geburtstag am besten -aus demografischen, demokratischen und sozialstaatlichen Gründen- ein Loch buddeln und sich hineinlegen soll? Die ihr ganzes Leben lang ‘vernachlässigt’ und nicht beachtet wurden, zu viele für die Schulen, zu viele für die Ausbildung, zu viele für den Wohnungsmarkt, gerade gut genug für den Wehrdienst, Kampf um jeden Millimeter Umweltschutz und Gesundheit, z.B. Smogalarm als Normalität? Von denen im Gegensatz zu einem gern verbreiteten Narrativ die Mehrzahl eben kein ‘Leben in Sorglosigkeit’ geführt hat, sondern oft irgendwie durchkommen musste? Von denen alle im Osten und, sorry liebe Ostler, auch viele im Westen sich exakt am Beginn des Berufslebens komplett umorientieren mussten? Die sind jetzt leider durch dieses ach so sorglose Leben leicht renitent geprägt, nicht unsozial, aber auch nicht mehr bereit, bis zum Lebensende nur als selbstverständliche Verfügungsmasse für ratlose Bildungsfachleute und -politiker zu dienen.
Und, liebe Bildungsforscher und Referenten, wenn ihr noch ein paar so neue Erkenntnisse wie die fehlende Jungenförderung finden wollt: Ein Vormittag Lehrerzimmer reicht, die Menschen da verteilen nämlich nicht nur Arbeitsblätter, die reden sogar über die Probleme, die ihnen jeden Tag begegnen. Meist schon 15 Jahre bevor die Bildungsforschung dieses Problem entdeckt.
Und genau weil dise Menschen Realitäten aus- und ansprechen würden…darf man sie keinesfalls zu Wort kommen lassen.
Ist doch ganz easy.
Das Menschen im Alter nichts mehr tun müssen und ihren Lebensabend genießen, gibt es noch nicht lange und wird es in Zukunft vermutlich auch nicht mehr geben. Hat diese Generation da ein Privileg drauf, weil sie in einer Zeit gelebt hat, in der das als selbstverständlich erachtet wurde? Haben die Generationen davor weniger gearbeitet? Werden die Generationen danach weniger arbeiten? Aber klar, dass ist ein Dämpfer, dass das Wirtschaftswunder vorbei ist und deren Generation scheint zu meinen, dies zu besitzen und ein Anrecht auf Lebenslänglich zu haben.
Kleines Parallelbeispiel : Heute sind Scheidungen normal und keiner käme mehr darauf, dass der Mann die Frau bis ans Lebensende unterhalten müsse. Er muss nur für seine Kinder gerade stehen und das ist auch gut so.
In den 60ern waren Scheidungen ungewöhnlich und man konnte damit noch nicht umgehen. Abgesehen von den armen Frauen, die allein gelassen wurden mit allem und klar kommen mussten, gab es auch reiche geschiedene Frauen. Die waren kurz mit einem Professor verheiratet, bekamen mit ihm ein Kind, brannten dann mit einem jungen Kerl durch und müssen nun bis an ihr Lebensende nicht arbeiten, fahren mehrmals im Jahr auf Reisen und genießen das Leben. Wegen so einer rechtlichen Regelung, dass der Mann die Frau bis ans Lebensende unterhält. Auch diese Frau, ich kenne da eine persönlich, wird das als in Stein gemeißelt betrachten und hat wohl “unterschrieben”, wie ihr Leben aussehen wird.
“Doch wie soll das gehen, wenn Lehrkräfte schon jetzt damit überfordert sind, die Mindeststandards zu vermitteln?”
Diese Frage ist eine Frechheit! Wer hat Schuld an der aktuellen Situation?! Wie immer die faulen S…
Wer kann nicht einmal die Mindeststandards vermitteln?! Na klar! Die Lehrkräfte.
Unfassbar! Da wirst du an allen Enden allein gelassen, sollst aber die Welt retten und falls die Kleinigkeit nicht zur Zufriedenheit aller gelingt, dann bist du schuld.
Das ist keine Schuldzuweiseung. Das ist erst einmal ein Fakt. Gerne hier nachlesen: https://www.news4teachers.de/2024/07/vera-knapp-die-haelfte-der-drittklaessler-scheitert-an-mindeststandards-ergebnisse-der-achtklaessler-kaum-weniger-schlimm/
Für die Bedingungen in der Schule können die Lehrkräfte ja nichts.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Vera, IGLU, PISA, TIMSS: Sie können jede der Leistungserhebungen der letzten Jahre als Beleg nehmen, dass es einen großen – und wachsenden – Anteil von Schülerinnen und Schülern in Deutschland gibt, die die Mindeststandards nicht erreichen. Größenordnung: ein Viertel bis ein Drittel. Wer behauptet denn, dass es an den Lehrkräften liegt? Dass Lehrkräfte für die Personalausstattung von Schulen, die völlig unzureichende Sprachförderung von Migrantenkindern oder die mangelhafte Frühförderung in den überlasteten Kitas verantwortlich sind, wäre uns neu.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
An was/ wem liegt es dann wirklich ?
Ich befürchte, dass sich da mehrere Tabus eingeschlichen haben:
– Eltern sorgen natürlich grundsätzlich hervorragend für das Sein und die Zukunft Ihrer Kinder,….soso.
– Deshalb müssen die Gorreichen lediglich die im Übermaß zur Verfügung stehenden Gelder verwalten und sich bei medienwirksamen Themen wie Gendern, handynutzung….total verausgaben, so dass dann Wochenlange Entspannung im whirlpool nötig ist – ach ja, arme 16.
– Es fehlt bei vielen Erwachsenen grundsätzlich am Überblick/Wissen zur schulischen und beruflichen Ausbildung. Im Vordergrund steht ein Abschluss, der scheinbar die Welt öffnet – bis die Realität zuschlägt, – ohje.
Früher ! ( war wirklich nicht alles besser) jedoch, man las zur Entspannung teils Schnulzen oder Krimis, wissend, dass Realität anders sein kann.
Heutzutage leben zu viele in einer unrealistischen ( Medien)Welt. Der Gedanke an tun, um zu erreichen, ist für viele zu weit weg, auch: ” weil die Kinder es mal besser haben sollen “.
Dabei muss man ihnen helfen – und zwar alle Beteiligten.
Lehrkräfte zB sollte man auch helfen lassen, sogar wenn sie Kritik wagen.
Liebe Redaktion,
leider geht Ihre Antwort (wie schon oft beobachtet) am Kommentar vorbei.
Zwischen “Doch wie soll das gehen, wenn Lehrkräfte schon jetzt damit überfordert sind, die Mindeststandards zu vermitteln?”
und
“Vera, IGLU, PISA, TIMSS: Sie können … als Beleg nehmen, dass es … Schülerinnen und Schülern in Deutschland gibt, die die Mindeststandards nicht erreichen.”
gibt es einen Riesenunterschied!
Durch eine reißerische Behauptung (Zitat 1) wird natürlich den Lehrkräften die Schuld zugewiesen an … eigentlich allem, was nicht funktioniert, weil es (das Bildungswesen in Deutschland) nicht funktioniert.
Verfasser*innen solcher Statements weisen den Lehrkräften die Schuld zu.
Schöne Grüße
Klara
Lehrkräfte sind mit den Bedingungen überfordert – sagen sie selber: https://www.news4teachers.de/2025/04/lehrkraefte-erleben-eine-starke-entgrenzung-ihrer-arbeitszeit-nur-noch-jede-fuenfte-wuerde-den-beruf-weiterempfehlen/
Was hat das mit Schuld zu tun?
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Wenn jeder, der arbeitet, davon auskömmlich leben kann, braucht man keinen Staat, der in alles eingreift und versucht, Ungerechtigkeiten auszugleichen, was dann oft genug wieder zu Ungerechtigkeiten oder Begehrlichkeiten an anderer Stelle führt. Der Staat halte sich weitestmöglich raus, aber Grundlage ist, dass jeder, der arbeitet, sein Leben von seinem Lohn oder Gehalt selbst problemlos bestreiten kann und auch noch was übrig hat.
Schöner Vorschlag, aber das exakte Gegenteil passiert gerade. Der Staat zieht immer mehr Sachen an sich, versagt dabei und zieht als Reaktion noch mehr Sachen an sich.
Alleine die immer wieder aufkommende Debatte über Ganztagesschulen. Dieser Staat ist doch schon damit überfordert, in groß geschätzt (über) 10.000 Unterrichtsstunden wenigstens sicher zu stellen, dass alle Schüler die Grundrechenarten beherrschen.
Der Staat (und wenn wir ehrlich sind auch [noch] die Mehrheit der Wähler) würde gerne “Nägel in dicke Bretter hauen, um ‘nen Schuppen zu zimmern.”.
Nur kommt hämmern ja garnicht in Frage, was da für Druuuuuuuck!!!11 ausgeübt wird!
Und Bretter sind Holz, also toter Baum! Geht garnicht!
Können Schuppen nicht auch aus Recycling-Pappe, Einhornglitzer und vor allem ohne jede Form von Schwitzen gebaut werden?
Sicher…sicher…wir erstellen da mal ein Konzeptpapier…
Und viele Eltern und Kinder wollen gar nicht die Ganztagsschule und nichts anderes am Tage mehr sehen als eben die Schule.
Von den im Artikel erwähnten Katastrophen haben die 18-jährigen die meisten lediglich medial “erlebt”. Da konnten die Jahrgänge 1898 oder 1925 z. B. ganz andere Geschichten erzählen – sofern sie überlebt haben. In anderen Worten: Natürlich müssen Professoren auf sich aufmerksam machen (vor allem so lange sie noch keine “Stars” sind und solche werden möchten), aber eine besondere Notlage der heute Jungen erkenne ich nicht.
Früher war alles besser – sogar die Katastrophen (Scherz). Herzliche Grüße Die Redaktion
Erster Weltkrieg: Das Trauma der Gesichtsversehrten – DER SPIEGEL
Wie soll man eine Ausgangsperre nur “medial erleben”? Oder wie soll man es nur “medial erleben”, wenn man sich nicht mehr mit seinen Freunden im Park treffen darf? Oder wenn man beim Verlassen der Wohnung überlegen muss, ob man einen polizeisicheren Grund vorweisen kann?
Tatsächlich kommt wohl die Boomergeneration, um die es geht, was Krieg betrifft, am besten davon. Warum also missgünstig ggü den Jüngeren?
Nicht missgünstig gegenüber den Jungen von heute, sondern mitfühlend gegenüber den Jungen von gestern. Alles ist halt relativ und ich wenn ich auf die Verhältnisse in anderen Ländern – krasses Beispiel: Mädchen in Afghanistan – schaue, dann neige ich eher zur Dankbarkeit. Den heiteren Zynismus unter meinem Beitrag kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Welche Missgunst meinen Sie explizit? Die jährlichen Bildungsausgaben pro Schüler*in , das Kindergeld usw. haben ja z.B. ganz massiv stärker zugenommen als z.B. die Standardrente.
Tja, was soll man zu den Kommentaren hier sagen, die zu großem Teil kostenlose Bildung gegen Rentenhöhe ausspielen ?
Vielleicht kann ich mit meinem Blickwinkel das ganze etwas in die Waage bringen:
War die Bildung für Boomer (60er/70er/80er) nicht auch kostenlos?
Inwiefern betrifft Kindergeld, Elternzeit ect direkt die Kinder und nicht deren Eltern, oder wurden die Boomer als Kinder weniger versorgt oder hatten weniger Zeit mit den Eltern, weil deren Eltern dies nicht hatten? Soweit ich weiß, konnten die Eltern der Boomer sich oft Haus und Alleinverdiener leisten .
Hat man die Boomer als Kinder oder Eltern im Second-Hand-Laden oder bei Kik angetroffen? Wählten die im Einkaufsladen gezielt und nur noch nach Preissenkungen oder konnten die im Tante Emma Laden problemlos einkaufen?
Tafel Milka Schokolade, 100g, vor 25 Jahren ca 80 Pfennig, aktuell 2 Euro – also etwa 4 DM. Meine Großtante hatte zum Kaffeebesuch immer jedem Kind eine mitgebracht – das hat sie auch nicht umgegerechnet 20 Mark pro Sonntag gekostet.
Eine Tageskarte, um mit Bus in die Stadt zu kommen, 10 Euro – vor 10 Jahren noch 5 Euro – damit es sich lohnt, die Vergünstigungen in Anspruch zu nehmen, müsste man oft fahren müssen…
Alles, was sich preislich verdoppelt – oder bei Lebensmitteln mehr als verdoppelt – hat, summiert sich. Wenn ihr an Flaschen sammelnde Rentner denkt, dann auch an die vielen Alleinerziehenden und Geringverdiener, deren Einkommen sich auch nicht mit der Inflation verdoppelt hat. Genauso gibt es auch reiche Rentner und reiche Jüngere.
Wohnungsnot : 50% aller Haushalte sind Singlehaushalte, vor allem im Alter. Trägt viel zur Wohnungsnot bei, dass Rentner nicht wie deren Eltern und Großeltern leben.
Trägt auch zur Betreuungssituation bei, dass sie selbstverständlich Reisen und Unternehmungen vorziehen dürfen, als sich in die Familie ihrer Kinder einspannen zu lassen. Das hatten vorherige Generationen nicht und können sich zukünftige evtl nicht leisten.
Wie ging es den Eltern der Boomer im Vergleich zu den Boomern? War das nicht auch ungerecht? Deren Eltern mussten Krieg erleben, Riesenklassen, kein Bafög und deren Eltern wiederum bis zum Tode hart auf dem Hof arbeiten. Kurz, den Boomern ging es viel besser als ihren Eltern und Großeltern, die das aufgebaut hatten – sollen die sich also auch schämen? Zum Dank haben die Boomer wenig Kinder bekommen und denen damit allerlei aufgebürdet.
Nun zurück zu den jetzigen Kindern, die nicht jammern sollen, weil sie – ungewöhnlicherweise ^^ – zur Schule gehen und von Eltern erzogen werden dürfen und es Angebote für Transport, sowie Freizeitaktivitäten gibt – im Gegensatz zu ganz armen und kriegsgebeutelten Ländern (toller Vergleich, Flaschen sammelnden Rentnern geht es natürlich auch besser, als Rentnern in diesen Ländern, falls man die überhaupt “Rentner” nennen kann).
Wie wird es den jetzigen Kindern in der Rente gehen und wie davor, wenn sie so viele Rentner unterhalten müssen, im Vergleich zu den Boomern?
Also, betrachte man die Kindheit der Kinder heute ( Smartphone – Eltern, Verkehrslage, Kita-und Schulsituation, ect, mediale Ruhigstellung, viele teure, Elterngerechte Urlaube – aber keine Zeit für spielen im Wald, durchorganisierte Kindheit, überbehütete Kindheit) mit der Kindheit der Boomer.
Betrachte man das spätere Arbeitsleben der heutigen Kinder (viele, viele Rentner versorgen) mit dem Arbeitsleben der Boomer.
Betrachte man die (noch) sichere Rente der Boomer mit der ungewissen Zukunft für die Rente späterer Generationen.
Und ganz nebenbei : Meine Mutter ist 1949 geboren und 2022 im Frühjahr gestorben – da hatte gerade Putin die Ukraine angegriffen.
Bemerkenswert : Das sie ihr ganzes Leben ohne Krieg, Kriegsangst verbringen konnte ist wohl eine ausgesprochene Seltenheit in der Menschheitsgeschichte.
Also kurz : Ich finde die Missgunst hier ggü den Jüngeren unangebracht. Ich finde, meine Kindheit war entspannter, als die meiner Kinder. Meine Rente ist vermutlich auch noch etwas sicherer als deren Rente und die Wahrscheinlichkeit, in meinem Leben keinen Krieg hautnah zu erleben, noch etwas größer.
Warum seid ihr Lehrer hier so missgünstig? Ach ja, größtenteils Boomer! 😉
Wo sehen Sie denn hier Missgunst gegenüber den aktuellen Staatsausgaben für die junge Generation? Liest sich für mich eher so, als ob man den Rentnern und den Zuschüssen zur Rentenkasse statt den zuständigen Politker*innen die Schuld dafür zuschieben möchte, dass immer noch zuwenig in Kinder und Bildung investiert wird, Allerdings wird aktuell aber deutlich mehr in Kinder und Bildung investiert als früher. Im Jahr 1995 betrug z.B. das Kindergeld 35€, die jährlichen Bildungsausgaben pro Schüler*in 3600€, die Standardrente 971€. Im Jahr 2023 dann Kindergeld 250€ = +600% , Bildungsausgaben 9800 = +170%, Standardrente 1503 = +55%. Da sollte es schon schwer fallen, den Rentern vorzuwerfen, sie wären Schuld, dass zu wenig in Bildung investiert wird. Im Jahr 1995 gab es auch nur 1,8 Mio Studierende , im Jahr 2023 dann 2,8 Mio.
Tafel Milka Schokolade, 100g, vor 25 Jahren ca 80 Pfennig, aktuell 2 Euro – also etwa 4 DM. Meine.
Bitte als Gegenrechnung auch mal die Einkommen beleuchten.
Wieso missgünstig? Was hat das mit Boomern zu tun? Auch wieder alle in einen Topf werfen. Ich glaube alle Eltern unterstüzen größtenteils ihre Kinder.
Das Hauptproblem an diesem Artikel ist doch, dass den “Alten” vorgeworfen wird, nicht genug zu tun. Kenne auch genügend ältere Menschen, die im Alter noch arbeiten müssen, um über die Runden zukommen.
Ja, es stimmt es soll kein Kind zurückgelassen werden, aber das alte Sprichwort, dass kein Hund zum jagen getragen werden werden kann, gilt auch immer noch.
Leider ist man in Deutschland die letzten Jahre immer mehr dazu hingekommen, die Schuld für bestimmte Situationen immer bei anderen zu suchen. Einer muss schuld sein, und ich selber bin es nicht.
Bsp.: Wenn ein Kind nicht lesen will, ist die Lehrkraft schuld. Hat nicht genug motiviert!
Eltern können sich mit Kindern beschäftigen, manche tun es, mache wollen nicht, manche können das lesen auch nicht ihren Kindern beibringen. Aber zumindestens könnten sie ihre Kinder dazu anregen, hier aktiv zu werden. Die kann man unterstützen.
Und wichtig ist, ja niemanden “die Wahrheit” zu sagen. Irgendwann muss jedes Kind lernen, dass man des eigenen Glückes Schmied ist, ohne Fleiß keinen Preis, es gibt Nichts, außer man tut es (manch mal auch ohne die Frage, was beomme ich dafür).
Viele alte Sprüche, aber deswegen immer noch gültig. Märchen, wie das von Frau Holle ist eigentlich ein gutes Beispiel. Jetzt kommt das Problem, dass es nicht mehr der aktuellen Lebenserfahrung entspricht.
– wie in den Brunnen gefallen. Gab es keine geeigneten Sicherheitsmaßnahmen.
– blutige Spindel: Kinderarbeit, TShirts kommen aus der Modestraße
– Brot muß man aus dem Ofen holen
– Bett ausschütteln, damit es schneit (bei dem Klimawandel nicht sinnvoll)
Aber: Kinder sollten es lesen und nicht die gleichnamige Verfilmung anschauen. Man kann sich über die Geschichte unterhalten und diskutieren.
Und nun der letzte: JEDER MUSS SICH AN DER EIGENEN NASE PACKEN
Migrantenkinder, die in der Schule keine Sprachförderung bekommen, MÜSSEN SICH ALSO AN DER EIGENEN NASE PACKEN? Kinder aus dysfunktionalen Familien, die zu Hause keine Förderung bekommen, MÜSSEN SICH ALSO AN DER EIGENEN NASE PACKEN? Kinder aus armen Familien, die anregungsarm aufwachsen, MÜSSEN SICH ALSO AUCH AN DER EIGENEN NASE PACKEN?
Das Doofe an sozialdarwinistischen Vorstellungen wie diesen ist ja, dass der Schuss nach hinten losgeht: Diejenigen, die Kinder sich selbst überlassen wollen, bekommen dann später eben keine Rente/Pension mehr, weil niemand da ist, der ihnen diese Rente/Pension finanzieren könnte. Sie wird auch keiner pflegen, weil das Sozial- und Gesundheitssystem ohne genügend Beitragszahler zusammenbricht. Und wenn Sie Pech haben, gibt es dann immer noch oberschlaue Leserbriefsschreiber, die in Versalien schreiben: JEDER MUSS SICH AN DER EIGENEN NASE PACKEN (und sich gefälligst selbst unterhalten/pflegen).
Gruselig.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Aber ob man die Meinung vetritt, dass die je nach Bundesland unterschiedlich unzureichende Sprachförderung von Migrantenkindern daran liegen soll, dass der Bund Zuschüsse zur Rentenversicherung zahlt, dürfte individuell verschieden sein. Ich würde meine Hand z.B. nicht dafür ins Feuer legen, dass in NRW plötzlich mehr in Schulbildung investiert würde, wenn der Bund die Rentenzuschüsse kürzen würde. Dass z.B. das Kindergeld in den letzen 30 Jahren um +600% zugelegt hat, die durchschnittlichen Bildungsausgaben der BL pro Schüler*in um +170%, die Standardrenten abedr nur um +55%, habe ich weiter oben auch schon vorgerechnet. Auch die Quoteund Anzahl der Hochschulzugangsberechtigten und der Studierenden ist in diesem Zeitraum ganz massiv angewachsen. Sieht für mich deshalb nicht unbedingt danach aus, dass sich die Renter an der Bildung der Jungen beredichert haben. Es scheint zwar aktuell en vogue zu sein, mit plakativen Sprüchen wie “mehr Geld für Bildung statt für Renten” einen Keil zwischen die Generationen treiben zu wollen, aber nicht alles was so behauptet wird, hält auch einer Überprüfung stand.
Tja, da muss man sich doch schon fragen, warum es immer mehr “dysfunktionale” Famileien gibt und warum zu Zeiten mit weitaus weniger staatlicher Unterstützung und schlechterer Schulausstattung die Bildung der Kinder auf besseren Füßen stand. Es ist sicher nicht von der Hand zu weisen, dass Eltern und ihre Kinder sich immer mehr aus der Eigenverantwortung ziehen, weil es bequemer ist, bedient zu werden. Dann sinkt natürlich auch die Motivation, sich anzustrengen. Man sieht das Leben inzwischen als Ponyhof und ist schon benachteiligt, wenn man kein IPhone hat. Wie hat ein Jugendlicher letzthin argumentiert, weil er Energydrinks im Unterricht dabei hatte: “Seit der Zeitumstellung werde ich einfach nicht mehr wach”. Medial werden den Leuten alle möglichen persönlichen psychischen und physischen Belastungen eingeredet, denen sie sich um Himmels Willen bloß nciht aussetzen sollen.
“Es ist sicher nicht von der Hand zu weisen, dass Eltern und ihre Kinder sich immer mehr aus der Eigenverantwortung ziehen, weil es bequemer ist, bedient zu werden.”
Wir staunen immer wieder, wie schlicht man sich die Welt erklären kann. Alle nur faul? “Nach Schätzungen von Experten leiden bis zu 30 Prozent der Erwachsenen in Deutschland an einer psychischen Erkrankung, etwa die Hälfte von ihnen hat Kinder. Auch deren Psyche gerät durch die elterliche Erkrankung in ernste Gefahr. Vor allem in den ersten drei Lebensjahren können psychische Krankheiten und Suchterkrankungen der Eltern die Entwicklung der Kinder ungünstig beeinflussen.” Quelle: https://www.zdf.de/nachrichten/ratgeber/gesundheit/psychische-erkrankungen-eltern-kinder-unterstuetzung-fuer-familien-100.html
Aber klar, das reden “die Medien” den Menschen alles nur ein…
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Das mag schon sein, aber wo soll der Zusamnenhang zwischen den Bundeszuschüssen zur Rentenkasse und der Quote der psychischen Erkrankungen und den je nach Bundesland unterschiedlich zu niedrigen Bildungsausgaben pro Schüler*in oder zu wenigen Förderstunden sein?
Relativ einfach: Eine Gesellschaft, die so viel konsumtiv für Renten ausgibt, dass sie kein Geld mehr hat (oder haben will), um in ihre Kinder und Jugendlichen zu investieren – hat keine Zukunft, jedenfalls keine erstrebenswerte.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Tja, nur das die Rentner ihr Leben lang malocht und fleißig in Rentenkasse eingezahlt haben. Nicht vergessen liebe Redaktion, auch Sie werden einmal Rentner sein.
Wo ist denn die Rentenkasse? Sie existiert nicht – mit dem Geld wurden die Rentner der Vergangenheit unterhalten. Nennt sich Generationenvertrag, und der funktioniert nunmal nicht, wenn nicht mehr genügend junge Menschen in Arbeit sind, um ihren Teil erfüllen zu können. Ja, auch wir werden mal Rentner sein. Das macht uns aber nicht zu Wundergläubigen. Gerne hier nachlesen: https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19473/generationenvertrag/
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Was ist aber die Lösung des Problems? Arbeiten bis 70-75? Das erzählen Sie gern jemanden, der hart auf dem Bau arbeitet. Der Journalismus gehört üblicherweise nicht zu körperlich harter Arbeit.
Nicht jedes Jahr 50.000 Jugendliche in die Perspektivlosigkeit entlassen – damit fängt’s mal an.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Bei den Quoten gibt es aber erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern, z.T. über 100%. Seltsamerweise wird aber den Bundesländern mit den niedrigsten Quoten an Schüler*innen ohne Abschluss und jungen Menschen ohne Berufsabschluss häufig mangelnde Bildungsgerechtigkeit vorgeworfen.
Wenn sie die Angebote der Schule(n) usw. annehmen, sich dransetzen, lernen- auch, wenn’s anstrengend ist- und sich durchbeißen, dann haben sie immer eine Perspektive. Dann können sie einen Schulabschluss machen, eine Ausbildung absolvieren, einen Arbeitsplatz bekommen und ihren Lebensunterhalt verdienen. Aber dazu müssen sie etwas tun, den Allerwertesten hochkriegen, das Daddelphone und die Schnapsideen vom Influencerdasein und anderen Quatsch beiseite legen.
Da die Schulen bekanntermaßen perfekte Lernbedingungen für Schüler und wundervolle Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte bieten – muss das ja so sein. Ein Förderparadies (Scherz).
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Daran sind die Jugendlichen aber zu einem großen Teil selbst schuld. Man hat sogar dass Gefühl, dass je besser die Bildungsangebote und je mehr Förderung, desto schlechter die Lernergebnisse. Daran sollte man auch mal einen Gedanken verschwenden und den Schülern mal wieder mehr Eigenverantwortlichkeit und Leistungsbereitschaft abverlangen.
Daran sind die Jugendlichen aber zu einem großen Teil nicht selbst schuld – genauso wenig wie die Lehrkräfte an ihren Arbeitsbedingungen.
Andere Staaten leisten sich viel weniger Schulabbrecher. Es ist verrückt, wie einzelne Lehrkräfte, die keine Gelegenheit auslassen, über die (genauer: ihre) Probleme im Schulsystem zu klagen, ebendieses Schulssystem für perfekt erklären, wenn es um die Schülerinnen und Schüler geht.
Gerne hier nachlesen: https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2024-02/schulabbrecher-quote-deutschland-eu-durchschnitt
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Ich habe nie behauptet, dass das Schulsystem perfekt ist. Wieder so eine Ihrer konstruierten Interpretationen. schule ist ein kostenloses Bildungsangebot, und wenn wir keine Schulpflicht hätten, wäre die Situation noch viel schlimmer. Es ist immer weniger Pflichtbewusstsein unter vielen KIndern und Jugendlichen vorhanden, da sie ja doch alles bereitet bekommen.
Natürlich ist das Schulsystem nicht perfekt.
Großes “aber”:
– Hausaufgabenbetreuung zusätzlich zu Arbeitsstunden
– kostenlose (=symbolische 1 €) Nachhilfe in der Schule selbst (man muss nicht mal wohin!)
– Beratungslehrer
– Schulsozialarbeit
– EIGENER (!) Schulpsychologe vor Ort
– das “übliche” (sic!) Quartalsnoten- und Beratungsgedengel
– Bildungsgutscheine
– Nachhilfegutscheine (für diejenigen, für die das Gratisangebot der Schule nicht gut genug ist, lol)
– Schulbibliothek (MIT Betreuung!)
– zusätzlicher Lernberatungstag
– “Schüler helfen Schülern”-Programm
– gratis-Stundenangebot von vollexaminierten LuL (ich war auch lange genug unbezahlt dabei)
…und das ALLES REICHT NICHT?
Für den absoluten Witz, den in NRW der “erste Schulabschluss” darstellt?
Joa, wer das alles in den Wind schlägt und drauf pfeifft…”PP”, persönliches Pech.
Die ganz stumpfe Realität, das eine sehr kleine Minderheit von SuS es einfach nicht bringt (weil sie aktiv schlicht nicht wollen) – das ist in Ihrer Welt ein nicht vorstellbares Sakrileg, oder?
Lustig, wie Sie – der hier sonst keine Gelegenheit auslässt, Kultusminister zu kritisieren – hier plötzlich zu deren Pressesprecher mutieren.
All das Wundervolle, was die Politik den Kindern und Jugendlichen anbietet, reicht nicht? Ganz offensichtlich: Nein, reicht nicht. Das fängt damit an, Kinder, die keine Chance hatten, zu Hause Deutsch zu lernen, ohne Sprachförderung in Klassen zu stecken – und endet bei einer Schulabbrecherquote, die europaweit mit am höchsten ist.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Ich habe die konkreten, (und nicht nur auf dem Papier) stattfindenden Maßnahmen an zwei Schulen (einziger Unterschied: Bei der zweiten muss der Psychologe “gebucht” werden – und kommt dann auch) beschrieben.
Dass sowas längst nicht jede Schule auffahren kann oder will ist klar.
Trotzdem haben beide Schulen ziemlich genau den sehr niedrigen Schnitt, der den berühmten “50.000!!111!!1” entspricht.
Die Kultusbürokratie kann man für vieles kritisieren – für EINES aber nicht:
Wenn ****bestimmte**** SuS (in sehr kleiner Anzahl) willentlich und aktiv ALLE diese konkreten, real existierenden Angebote vor Ort ABLEHNEN. Und Ablehnen/Fernbleiben ist noch der günstigste Fall.
*Fun fact:*
Der stetig weitere Ausbau und das ständige Aufreiben der KuK (die das alles null machen müssten ausser KAoA, das geht also “auf deren Nacken”, wie man so schön sagt) hat genau zero (jenseits insignifikantem Rauschen) an der Quote geändert.
Vielleicht sind ja Lehrer wie 447 das Problem?
Zu schlichte Antworten auf komplexe Probleme (= Populismus) sind das Problem.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Schon mal mit den Schülerinnen und Schülern oder deren Eltern darüber gesprochen, woran das liegen könnte? Nicht jedes Angebot ist so toll, dass es gerne angenommen wird. Herzliche Grüße Die Redaktion
Ach, da haben wir es wieder, dei Angebote sind nicht adäquat. Ich kann Ihnen versichern, dass jede Schule ähnliche Erfahrungen und Beobachtungen macht, da können die Angebote noch so toll sein. Oder was meinen Sie warum da Schüler teilnehmen, die es gar nicht nötig hätten und die eigentliche Zielgruppe nicht? Weil die Angebote so schlecht sind??? Ja, ja. Netter Versuch, wie immer.
“Schulabbrecherquote” ??? Kann eigentlich nicht so ganz richtig sein, da ja Schüler*innen von 18 bis 24 Jahren mit Schulabschlüssen der Sek 1 in den Zahlen von EUROSTAT mitgerechnet werden. Dazu gibt es zwischen den deutschen Bundesländern erhebliche Unterschiede von bis über 100% .
Zumindest für NRW gilt:
Schüler müssen sich AKTIV VERWEIGERN, um nicht über …
– Vornotenmanipulation
– “””vorsortierte””” Korrekturlehrer,
– “”””Hinweise””” der Schulleitungen, was das ja für die armen Hascherl “bedeuten würde” usw. usf.
doch noch den verhassten Schulabschluss zu bekommen.
Nicht “das Schulsystem entlässt” (nette Verdrehung, als ob irgendeine Lehrkraft solche Desaster anstrebt!) – diese Schüler ENTSCHEIDEN sich zur aktiven Verweigerung der hunderte Personalstunden Hilfe, die in sie versenkt werden.
Sehr, sehr gerne mit ‘ner dicken Portion Verachtung obendrauf, bis hin zum Stich in die Autoreifen der Beratungslehrer, die sie “””nerven”””.
Ist das nicht interessant ?
Genau auf die “engagierten” (=realitätsfremden, über-empathischen, co-abhängigen) LuL, auf DIE gehen sie dann (glücklicherweise 99% der Zeit nur verbal oder in sozialen Netzwerken) los.
Diese 50.000, das sind zum ganz, ganz großen Teil NICHT die mitleidserregenden , schwarz-weiß abgelichteten “Mädchen mit Hoodie überm Kopf, mit Rücken zur Wand sitzend”. Oder die traurig schauenden, abgemagerten 14jährigen Knaben, die da gerne als Fotomotiv gewählt werden, um den Helferinstinkt anzusprechen.
Es sind in der Regel die Schläger(zunehmend auch mit -innen), Mobber(innen), Drogendealer(innen), Unterrichtssprenger(innen).
50.000 jugendliche “Schläger(zunehmend auch mit -innen), Mobber(innen), Drogendealer(innen), Unterrichtssprenger(innen)” – jedes Jahr? Was für ein trauriges Menschenbild…
Wie seltsam auch, dass es in den meisten europäischen Staaten deutlich geringere Anteile davon gibt. Oder dass es in manchen Bundesländern doppelt so viele davon gibt als in anderen (bis zu 10 Prozent – jeder zehnte Schüler!).
Hat natürlich alles nichts mit dem wundervollen deutschen Schulsystem zu tun, das Schülerinnen und Schüler optimal fördert und Lehrkräften ideale Arbeitsbedingungen bietet und die Schulgebäude hervorragend in Schuss hält. Kinder werden so – Schläger, Mobber, Drogendealer, Unterrichtssprenger -, weil sie von Natur aus bösartig sind. Kann man halt nichts machen (Scherz).
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Ach ja, das Schulsystem ist schuld. Und ich dachte schon, laut dem Artikel, dass die Rentner schuld wären.
Offensichtlich haben Sie den Artikel nicht verstanden. Es geht nicht um Schuldfragen – es geht um Verantwortung, das Problem zu lösen. Herzliche Grüße Die Redaktion
“Arbeiten bis 70-75? Das erzählen Sie gern jemanden, der hart auf dem Bau arbeitet,” steht da , aber das fordert niemand, behauptet aber der Abschaum gegen Deutschland(A*D) gerne, um genau diese Gruppe einzufangen.
Beschäftigen Sie sich gern mit dem Rentenniveau in Deutschland. Und natürlich ist es in Ihren Augen ein Märchen, dass sich Rentner z. T. etwas dazuverdienen müssen, um im Alter über die Runden zu kommen… Klar, gibt es auch einen kleinen Anteil an Wohlstandsrentnern… Was die von Ihnen zitierte Partei damit zu tun haben soll, erschließt sich mir nicht. Diese Partei ist mir jedoch ebenso egal wie Sie es mir sind. In dem Sinne wünsche ich Ihnen ein angenehmes Wochenende.
Schon mal davon gehört, dass die Rentenkasse, die Ihrer Meinung nach nicht existiert, über Jahrzehnte zweckentfremdet wurde und nie zurückgezahlt? Und auch heute noch werden Leistungen daraus bezahlt, die nicht vorgesehen waren. Nur leider kann sich der Rentner nicht wehren, auch wenn er dafür bezahlt. Und dass nicht mehr genügend Leute in Arbeit hat sehr komplexe Gründe, deren Auswirkungen man offenbar nicht lösen möchte, aber daran sind wohl auch wieder die Rentner schuld.
“Ihrer Meinung nach” – wo soll sich der Tresor denn befinden? Er existiert schlicht nicht.
Und “versicherungsfremde Leistungen” sind nicht so “versicherungsfremd” wie suggeriert: Es handelt sich um Rentenansprüche aufgrund von Kindererziehungszeiten, der Grundrentenanspruch aufgrund von langjährig niedrigem Einkommen, Kriegsfolgelasten und Fremdrentenleistungen. Quelle: https://www.fr.de/wirtschaft/milliardenhoehe-rente-deutsche-rentenversicherung-versicherungsfremde-leistungen-93093528.html
Die gesetzliche Rentenversicherung ist eben ein Solidarsystem, keine private Kapitallebensversicherung. Sie als (mutmaßlich) verbeamtete Lehrkraft tragen dazu allerdings nicht bei. Und: Es geht nicht um Schuld. Es geht um die Zukunft dieses Landes.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Zu Ihrer Info:
1957 wurde die kapitalgedeckte (!!) Rentenkasse in ein Umlagesstem verwandelt und dabei 14,5 Milliarden Goldmark geplündert.
jDurch das Wirtschaftwunder der 50er und 60er Jahre war die Kasse bald prall gefüllt, da begann dann die nochmalige Plünderung:
Alles sicher Zahlungen, die gerechtfertigt sind, aber bitte nicht aus der Rentenkasse.
Bis heute wurden den Arbeitnehmern durch die regierenden Parteien insgesamt annähernd 812 Milliarden Euro aus der Rentenkasse gestohlen, mit Zinsen 950 Milliarden. Und die Zweckentfremdung geht munter weiter.
1981 wurde entschieden, dass die Rentenkassen zu den “öffentlichen Geldern” gehören, und damit hat die Regierung unbeschränkt Zugriff.
Dazu kommt noch das Zweiklassensystem bedingt durch die Privilegien der Pensionäre, denn diese “Kasse” existiert tatsächlich nciht, weil sie nichts einzahlen und die Gelder aus der Steuerkasse genommen werden. Es zählt das letzte Gehalt als Paramenter (deshalb auch oft die schnellen Beförderungen kurz vor der Pensionierung), beim Rentner das gesamte Arbeitsleben, das ja am Anfang mit weniger Gehalt steht.
Aber ganz klar, die Rentner sind schuld, dass in der Bildung das Geld fehlt.
Also ist Adenauer schuld… Wem nützt das jetzt?
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Ich möchte mich nur dagegen wehren, dass immer die Rentner an den Pranger gestellt werden, da sie momentan in hogher Zahl vorhanden sind.Und es ist im Übrigen keine Schuldfrage, sondern das Agieren der Politik, das nicht immer gerecht ausfällt.
Hier wird niemand an den Pranger gestellt. Die Demografie ist aber ein Problem – übrigens vor allem eins der Renter (die ja versorgt werden wollen, das aber – Stand jetzt – nicht werden). Es geht hier um Deutschlands Zukunft, und nicht darum, dass sich hier jemand stellvertretend für andere auf den Schlips getreten fühlt.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Deutschlands Zukunft hängt wahrhaftig nicht nur von der Demografie und den ach so plötzlicht auftretenden Rentnern ab. Das ist absoluter Nonsens, warum, habe ich schon mehrfach erläutert, aber es wird den Leuten permanent eingetrichtert, dass die Rentner unser Untergang sind. Ich finde das hochgradig menschenverachtend und charakterlos.
Sie verstehen offensichtlich das Problem nicht: “Allein bis zum Ende dieser Dekade könnte das Erwerbspersonenpotenzial um bis zu 3 Mio. Personen schrumpfen, verbunden mit einem Verlust von 4,5 Mrd. Arbeitsstunden. Diese Entwicklung stellt einerseits die Finanzierung der Sozialsysteme, anderseits die Schuldentragfähigkeit in Frage. Das Phänomen wird absehbar das Arbeitsangebot verringern und das Wachstumspotenzial der deutschen Wirtschaft nachhaltig restringieren.” Quelle: https://www.iwkoeln.de/studien/thomas-obst-wie-der-demografische-wandel-das-wachstum-bremst.html
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Da die Politiker den privilegierten Beamtenstatus haben, wird sich an dieser Ungerechtigkeit nichts ändern. Die Zweiklassenteilung bei Lehrern ist halt besonders bitter, da man den direkten Vergleich hat. Da beißt man sich die Zähne aus, und die meisten Beamtenkollegen meinen “das stimmt doch gar nicht”, ohne fundierte Begründung. Privileg halt.
Welche Politiker haben einen “privilegierten Beamtenstatus”? Herzliche Grüße Die Redaktion
Übersieht eben, dass der weitaus größte Teil der Politiker*innen ihre Aufgaben im Ehrenamt versieht und allenfalls eine Aufwandsentschädigung erhält. Und das auch nur, wenn sie gewählte Vertreter*innen in einem Gemeinde-/Stadtrat oder einem Kreistag sind. Auch bei 16 Landesparlamenten und dem Bundestag ist die Zahl der MdL und BdL in Deutschland überschaubar im Vergelich zu den vielen Politiker*innen, die sich auf kommunaler Ebene engagieren.
Selbst Politiker*innen die an die Spitzenpositionen der Exekutive gewählt wrden sind, werden weitaus geringer vergütet als entsprechende Leitungspositionen in der freien Wirtschaft.
Das ist keine Kasse.
“…..die Rentner, die ein Leben lang malocht und in die Rentenkasse eingezahlt haben….” Da sprudeln wieder einmal verallgemeinernde Phrasen aus dem kleinen Troll hervor.
Wo hat man Sie denn vergessen abzuholen?
Niveau ist keine Hautcreme.
Die Bildungsausgaben werden aber von den Bundesländern geschultert, nicht vom Bund, da besteht keine direkte Konkurrenz. Außerdem wird heutzutage trotz steigender Zuschüsse zur Rentenkasse viel mehr Geld pro Kind und pro Schüler*in investiert als früher. Seit 1995 Kindergeld +600%, Bildungsausgaben pro Schüler*in +170%, Standardrente +55%. Bayern hat z.B. zuletzt die Bildungsausgaben pro Schüler*in um 6% erhöht, die Rentenanpassung betrug aber nur 4,39%. Ich würde auch darauf wetten, dass nicht die Rentner in SH schuld sind, dass dort künftig Unterrichtsstunden gestrichen und Lehrerstellen abgebaut werden sollen. usw. usw. Aber jeder wie er mag.
Es ist ein Unding zu behaupten, dass die Gesellschaft, oder besser der Staat so viel “konsumtiv” für Renten ausgibt, dass es für andere Dinge nicht reicht. Ich habe da mal einen anderen Link:
https://www.wsi.de/de/blog-17857-die-wahrheit-warum-bundeszuschuesse-zur-rentenversicherung-richtig-sind-63218.htm
Und warum spricht eigentlich keiner hier vopn den Pensionen?
Man hat es so satt, dass immer wieder die Rentner für alles herahlten sollen und dann mit Halbwahrheiten um sich geworfen wird.
Mit einfachen Worten ausgedrückt: die Rentner sind schuld. So ist der allgemeine Tenor. Auweia ……..
Muss es für Sie immer Schuldige geben? Niemand ist schuld – die Situation ist, wie sie ist. Sie bedarf aber einer Lösung.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Das ist Jacke wie Hose. Vererbt werden kann ja nur das, was den Hinterlassern gehört hat – offensichtlich eine Menge (nach Schätzungen in Deutschland 400 Milliarden Euro – pro Jahr). Gleichzeitig fehlt es der Bildung massiv an Ressourcen. Es geht hier um das Thema Zukunftsfähigkeit, nicht um Details einer Abgabendebatte. Niemand schimpft hier auf Rentner. Sorry, Phantomdebatte.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Schulden-Finanzvermoegen/_inhalt.html
Die öffentlichen Schulden (über 2,5 Billionen Euro) haben aber nichts mit dem geerbten/ vererbten Privatvermögen zu tun. Der Eingriff ins Privatvermögen bleibt tabu.
Ich habe nicht “alle” gesagt, sondern “iimer mehr”, verdrehen Sie nicht schon wieder die Aussagen.
Woher kommen denn die inflationären psychischen Erkrankungen? Ist das nicht auch ein Problem unseres Überflusses, dekadenter Verhaltensweisen, übermäßigen Medienkonsums und der Verfall der Werte? Die Gesellschaft ist immer ein Abbild der Dynamik der einzelnen Mitglieder, wobei ich keinesweg behauptet habe, dass man die wirklichen psychischen Erkrankungen den Leuten einredet, aber es gibt mittlerweile Einstellungen, bei der jede Überlastung sofort zu psychischen Erkrankeungen führt, und das kann nicht sein. Manchmal ist es einfach nur die Konequenz daraus, dass man den Kindern jegliche anstrengunge und Problemlösung abnimmt.
Danke für die Belehrung.
Sie tun ja auch so, dass die betroffenen keine Förderung bekommen. Wenn dem so ist, muss man dagegen steuern.
Und arme Kinder aus anregungsarmen Familien. Wenn sie letztendlich aus der Misere kommen wollen, müssen sie Eigeninitive entwickeln.
Sonst wird es auf Dauer nichts werden.
Wenn die Förderungen aber angeboten und im Schulalltag wird auch einiges Angeboten und es gibt genügend Schüler die dieses Nutzen (auch aus diesen von Ihnen benannten Gruppen), aber es gibt genauso viele die diese Angebote nicht nutzen. Und dann wird wieder vorgehalten, dass es die Lehrkräfte sind, die überfordert sind.
Und weil sie das nette Beispiel mit der Pflege nennen. Ja es kann jeden treffen und ja es wäre gut, wenn es entsprechend ausgebildetes und fähiges Personal gibt, die auch entsprechend bezahlt werden.
Dazu gehört aber auch bestimmter Menschenschlag, vor dem ich höchste Achtung habe. Inwieweit dann dieser bei den 50000 pro Jahr dabei sind, vermag ich nicht zu beurteilen. Wenn jemand diesen Weg gehen will, wird er Wege findem.
Gruslig fände ich Pflegekräfte, die nicht lesen und schreiben können und mit Menschen nicht umgehen möchten. Aber das ist ein anderes Thema
Und zum Vorwurf selbst überlassen. Jede Lehrkraft hat ein Quantum an Energie, dass den Schülern zur Verfügung gestellt wird. Wenn die Schüler das Angebot aber nicht wahrnehmen wollen (das meine ich mit an die eigene Nase fassen), kann man ihnen auch nicht helfen. Und ganz ehrlich. Ich bin auch niemanden böse, wenn meine Unterstützung nicht annimmt, aber böse, werde ich, wenn jemand behauptet, ich wäre überfordert.
“Wenn jemand diesen Weg gehen will, wird er Wege findem.”
Und wenn nicht, dann bleibt der Jugendliche halt auf der Strecke, egal – Sozialdarwinismus eben. Gerne hier nachlesen: https://www.bpb.de/themen/rechtsextremismus/dossier-rechtsextremismus/214188/was-ist-sozialdarwinismus/
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Liebe Redaktion,
einfach auch mal innehalten und Kritik auch wirken lassen.
Sind bsp. die Menschen, die in Offenbach sich engagieren, aber nur jedes Jahr ein bis drei Kinder “retten” können, Versager?
https://www.hessenschau.de/gesellschaft/neues-projekt-in-offenbach-letzte-chance-fuer-schulverweigerer-v1,projekt-scout-offenbach-100.html
Die fortwährende Besserwisserkritik ist gewöhnungsbedürftig. Ja, Schule verliert Kinder, und ja, das scheint nicht wirklich die Entscheidungsträger zu stören. Die Minderaussattung der Hilfesysteme dann den dort arbeitenden Menschen als charakterliches Defizit vorzuhalten – so verstehe ich ihren Hinweis – hat nichts mit einer fachlichen Analyse zu tun, macht dafür aber sehr viele kaputt.
Selbstverständlich sind Lehrkräfte, die Kinder “retten”, keine Versager. Wie kommen Sie darauf?
Wir haben lediglich auf einen Leserbrief reagiert – und klargestellt: Es macht für uns aber einen sehr gewichtigen Unterschied, ob die hohe Schulabbrecherquote als Defizit des Schulsystems kritisch gesehen oder als Sanktionsinstrument sogar noch begrüßt wird. Darin zeigt sich eine grundsätzliche Haltung Kindern und Jugendlichen gegenüber – letztlich ein Menschenbild. Die Vorstellung, dass Kinder und Jugendliche für sich selbst verantwortlich sind, teilen wir ausdrücklich nicht.
Was es mit “Besserwisserkritik” zu tun haben soll, die Defizite des Bildungssystems zu benennen – sie betreffen ja auch die Lehrkräfte in Form schlechter Arbeitsbedingungen – erschließt sich uns null. Dafür sind wir als Redaktion da. Wenn Sie nur positive Meldungen lesen möchten, empfehlen wir die Pressemitteilungsverteiler der Kultusministerien.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Sorry, aber Menschen, die alles geben, Kindern zu helfen, ganz lapidar Sozialdarwinismusbezüge anzudeuten – da bitte einmal den selbsternannten Heiligenschein rethorisch man ins richtige Licht rücken.
Woher wollen Sie wissen, dass es sich bei einem oder einer anonym hier Postenden um einen Menschen handelt, “der alles gibt, Kindern zu helfen”?
Wir wissen das nicht und können das auch nicht erkennen. Wir reagieren – nur – auf das, was hier öffentlich erklärt wird.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Zum ABschluss: “Woher wollen Sie wissen, dass es sich bei einem oder einer anonym hier Postenden um einen Menschen handelt, “der alles gibt, Kindern zu helfen”?” Und das Gegenteil?
Ich denke, die kritisch Mitlesenden werden sich schon einen Reim auf Beiträge machen – die Kommentierenden hier sind auch nicht zimperlich, das dann zurecht auch zu kritisieren. Als Hauptschullehrer muss ich damit leben, auch wenn alles versucht wurde, Kinder nicht dorthin bringen zu können, wo sie eigentlich hingehören. Dennoch sehe ich mich moralisch nicht in der Ecke der beruflichen Insolvenz. Da bin ich aber nicht.
ops, jetzt geht es um Menschenbild und Rechtsextremismus.
Dann muss ich doch mal zu Doktor gehen, vielleicht habe ich mir da etwas eingefangen.
Vielleicht ist es bis ja nicht so ganz rübergekommen.
Allen, die sich helfen lassen wollen, wird ja geholfen. Es wird auch mehrfach angeboten (und ja ich beantworte auch Schülerfragen nach 16:00 und am Wochenende)
Für diejenigen, die sich nicht helfen lassen wollen, gibt es andere Instutuionen (oder sollte es geben), die denjeneigen klarmachen müssen uns sollen, dass es nur funktioniert, wenn sie selber auf die Füße kommen. Und das kann keine Schule geschweige Lehrkraft liefern.
Na ja, und ich hoffe, dass sie neben/neben ihren Redaktionstätigkeiten sich auf dem Weg machen, und ein paar der 50.000 zurück gelassen retten.
Würde mich freuen, wenn sie wenigstens diesen wenigen eine entsprechende Perspektive für die Zukunft aufzeigen können, auch ohne das sie sich anstrengen müssen. Aber bitte dabei daran denken, es liegt ja nur an Ihnen, wenn die Betreuten dann wirklich nicht wollen.
“Allen, die sich helfen lassen wollen, wird ja geholfen.”
Das wird es nachweislich nicht. 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler wollen keine Hilfe beim Lernen? Alle faul? Gerne hier nachlesen: https://www.news4teachers.de/2023/10/in-hohem-masse-besorgniserregend-jeder-dritte-neuntklaessler-scheitert-an-deutsch-mindeststandards/
Wenn das Schulsystem so perfekt ist – worüber beschweren sich denn dann die Lehrkräfte? https://www.news4teachers.de/2025/04/lehrkraefte-erleben-eine-starke-entgrenzung-ihrer-arbeitszeit-nur-noch-jede-fuenfte-wuerde-den-beruf-weiterempfehlen/
Offensichtlich ist es nicht perfekt. Weder für Schüler noch für Lehrer.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Für Lehrkräfte ist das Sytem sicher nicht perfekt- da passt der angeführte Artikel,
Was die 30% der SuS angeht- da wollen viele mit Sicherheit Hilfe beim Lernen- zu fragen wäre aber, wie sie sich diese vorstellen. Hilfe hin oder her- das Lernen selbst, die Anstrengung nimmt ihnen trotzdem niemand ab. Und dieses Anstrengen, Durchbeißen wird vermieden- auch deshalb scheitern viele.
Punkt 1: Der Artikel gibt den aktuellen Stand der Erhebung wieder. Es werden auch die möglichen Ablegungen für die Schüler geschrieben.
Wo seht in dem Artikel etwas davon, das nachweislich nicht geholfen wird. Oder ist das ein Interpretation ihrererseits.
Kann mich entsinnen, etwas von faul geschrieben zu haben, sondern nur das sich irgendwann auch selbst “bewegnen” müssen, wenn sie ihre Defizite bereijigen müssen.
Punkt 2: Wo habe ich etwas von einem perfekten System geschrieben. Das perfekte System wird es für den einzelnen nie geben.
Wenn Sie es so polemisch nennen wollen, ja. Den Weg kann man zeigen, in gewisser Weise auch ebnen, Hilfsmittel stellen- aber ihn gehen, muss jeder Jemand selbst. Irgendwann muss man Verantwortung für sich übernehmen und ggf. die Konsequenzen tragen.
Gilt das dann auch für Lehrkräfte, die sich über ihre Arbeitsbedingungen beklagen? https://www.news4teachers.de/2025/04/lehrkraefte-erleben-eine-starke-entgrenzung-ihrer-arbeitszeit-nur-noch-jede-fuenfte-wuerde-den-beruf-weiterempfehlen/
Oder haben die nachweislich schlechten Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte keinerlei Auswirkungen auf Unterricht und Förderung? DAS wäre ein sehr erstaunlicher Befund.
Für Lehrkräfte kaum auszuhalten, für Schüler völlig ausreichend: Sorry, das geht nicht zusammen.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Ich sprach von den Schülerinnen und Schülern.
Und wir sprechen von einem defizitären System. Herzliche Grüße Die Redaktion
Ja und? Ändert das etwas daran, dass man sich für jedweden Erfolg auch in der Schule als Schüler und -in anstrengen und auch mal durchbeißen muss?
Müssten sich Lehrkräfte dann angesichts der Bedingungen auch nur “anstrengen und auch mal durchbeißen” – oder gilt hier zweierlei Maß?
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Da gilt dasselbe wie für die SuS- jeder kann über sein Handeln entscheiden. Wir Lehrkräfte kommen was die Bedingungen der Arbeit angeht, nicht wirklich weiter- die Gründe sind hinlänglich an vielen Stellen diskutiert worden- und leere Kassen, Personalmangel und eine gewisse Feigheit tun Übriges dazu. Ich kann mich anstrengen und durchbeißen bis zur Pension oder ich suche mir etwas anderes. Das kann ich entscheiden- nicht zuletzt, weil ich mich als SuS, als Lehrkraft, studierender Mensch durchgebissen und angestrengt habe, weil ich musste und nicht gebauchpinselt oder besonders unterstützt wurde- System hin oder her. Mit der Faust in der Tasche, aber auch mit Engagement und einer Portion Optimismus habe ich mich für die Option der (baldigen) Pension entschieden.
Und jetzt entscheide ich mich heute für den Feierabend.
Und wir entscheiden uns, unseren Job weiter zu machen: die Bedingungen in einem kaputtgesparten Bildungssystem zu kritisieren, das weder Lehrkräften noch Schülern gerecht wird.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Also ne, wirklich @ Redaktion, wie können Sie nur so etwas fragen:
Wir haben 16 total entspannte leader, die uns total entspannt mit Vorgaben beglücken, die wie Honig runtergehen.Unsere Schüler*innen sind noch weit entspannter, Abschluss dann eben erst mit 30, kein Problem, Hartzer oder/und influencer gehn immer. Was deren Erziehungsberechtigte angeht, so sind einige viele glatt wie Aal, nicht erreichbar oder anwaltsvertreten.
Da ist schwer reinzubeißen.
Und im Notfall setzt man sich ins niegelnagelneue Wohnmobil und macht – nicht! DU, weil Technik defekt? also…. das Gebiss bleibt heil. 😉 ( Sarire) 🙂
Das musste jetzt sein, @ Reaktion.
Viele von uns mussten sich schon durchbeißen , um den NC zu kriegen, um überhaupt an diesen bestbezahlten Traumberuf denken zu können. Dazwischen bissen sich viele einige Zähne im Tagesgeschäft aus, auch das coviderl kann Grund für reduzierte Beißerchen sein ( wo wir doch so gut geschützt waren ) und was derzeit los ist, gleicht dem Himmel auf Erden. Keiner aus dem Olymp steigt hernieder, dafür kommen die Kauknochen per PC – die Gefahr, dass wir uns durch Hineinbeißen übernehmen, ist riesengroß, die Amtsärzte wissen nicht mehr wie sie die Durchbeißschäden benennen sollen.
Also, im Ernst: es geht um die Anleitung von Kids zum erfolgreichen Durchbeißen und das denke ich, könnten die meisten LuL.
Die Frage ist, ob das so erwünscht ist……
Bitte unsere (rhetorischen) Fragen im Zusammenhang dieses Threads lesen: Selbstverständlich erkennen wir die Überlastung der Lehrkräfte im real existierenden Schulsystem an. Wir berichten ja tagtäglich darüber. Wir verstehen nur nicht, wie manche Lehrkräfte so tun können, als blieben die Schülerinnen und Schüler davon unberührt – und müssten nur mal ihre Faulheit ablegen.
Auch Schülerinnen und Schüler leiden natürlich unter den Defiziten des Systems.
Herzliche Grüße
Die Reaktion
Oh je, ich hatte Satire falsch geschrieben
Ich denke, wir sind gar nicht so weit auseinander.
Ein Punkt erscheint mir wichtig, steht auch oben
“Also, im Ernst: es geht um die Anleitung von Kids zum erfolgreichen Durchbeißen und das denke ich, könnten die meisten LuL.
Die Frage ist, ob das so erwünscht ist……”
Ich war grade wieder in mission possible unterwegs, im Betrieb, weil einem Schüler, der gut lernt, will, aber wenig Respekt vor Ausbilder, KuK zeigt, die Kündigung drohte.
Derlei lernte er nicht bei uns. Aber, mit 17 kann man auch einsehen, wenn Wege zur Sackgasse werden – er hats versprochen.
Fazit: Es gilt nicht nur Unterricht an sich anders zu sehn. Lehrer werden immer mehr zum Helfer in Sozialen Dingen, oft ungeliebte Korrektoren für etwas, das eigentlich nicht ihr Job ist. Das schreckt viele Jungkollegen ab.
Die Lehrer strengen sich mehrheitlich sehr wohl an und beißen sich durch, trotz der widrigen Voraussetzungen. Kommentare der Schüler “Sie werden ja auch darüf bezahlt”……. Ja nee, is klar ……..
Wer widerspricht dem denn? Herzliche Grüße Die Redaktion
Sie in einem Ihrer vorigen Kommentare, schon vergessen? “Nicht nur Schüler müssten sich in diesem System anstrengen …”
Haben wir nie geschrieben. Wir haben eine rhetorische Frage gestellt – im Konjunktiv. “Der Konjunktiv II wird auch Irrealis genannt. Der Konjunktiv II wird verwendet, um unmögliche und unwahrscheinliche Bedingungen oder Bedingungsfolgen zu benennen oder um auszudrücken, dass unter mehreren an sich möglichen Folgen infolge menschlicher Entscheidungen durch Ermessensgebrauch eine bestimmte Folge ausscheiden werde. Durch die Formulierung von Bedingungen und deren Folgen lassen sich auch Vorstellungen und Wünsche, die wahrscheinlich nicht eintreten werden oder unmöglich sind, oder Zweifel des Sprechers an bestimmten Sachverhalten zum Ausdruck bringen. Gerne hier nachlesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Konjunktiv_im_Deutschen
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Tut es auch nicht. Deswegen sind ja auch viele Lehrkräfte chronisch krank. Und das sind nicht die Low Performer.
Und ich bin seit Jahren gewerkschaftlich aktiv und in einem berufsverband und einer Partei und geize nicht mit Hinweisen und Forderungen.
Ja, das gilt es.
Was auch sonst?
Entweder ändert man sein Verhalten – oder geht eben zur Not.
Also, als erwachsener Mensch.
Welchen Zweck verfolgt eigentlich das Titelbild? Wenn meine Informationen stimmen wären ja über 60% der Rentenempfänger Frauen.
Irgendwann hat alles sein Gutes! Nach Jahrzehnten der Überfüllung- in Schulen, auf dem Ausbildungsmarkt, an Universitäten, schließlich am Arbeitsmarkt- haben wir uns nach der Decke gestreckt. JETZT fahren wir Boomer die Ernte ein. An uns kommt kein Politiker, keine Partei in den kommenden 20 Jahren ungeschoren, ohne Stimmenverlust, vorbei. Man wird es sich gut überlegen, es sich mit uns zu verscherzen. Und wie man schnell viel Geld beschafft, hat man ja jetzt gelernt.
“Die Lösung der Wissenschaftler: Schule sozialräumlich zu öffnen, sie zum „Mittelpunktsort“ einer Nachbarschaft zu machen, die sich nach Kräften um ihre Kinder kümmert. Vereine, Initiativen, sogar Arbeitsplätze für Elternteile, die im Homeoffice arbeiten, ließen sich dort ansiedeln.”
Habe mal gehört, Berliner* würden in solchen Fällen sagen: “Ick lach’ mir ‘nen Ast!”
Würde die soziale Schere garantiert weiter öffnen.
Und ein „Paradigmenwechsel in der Bildung“ soll darin bestehen, mehr “datengestützt zu arbeiten” – wirklich enorm “spannend”.
Heißt das nicht: Milliarden in IT & Testindustrie statt in genug qualifiziertes Personal?
Muss auch eine echte Wundersoftware sein, wenn die Daten von familären Problemen und/oder sozial auffälligem Verhalten der jeweligen Schüler*innen sammelen kann, von denen die betroffenen Lehrkräfte scheinbar nichts mitbekommen.
Unter diesem link befindet sich ein Interview mit dem Co-Autoren Aladin El Mafaalani. Da erkennt man mehr, dass nicht Jung gegen Alt ausgespielt wird wie hier viele denken.
https://youtu.be/hSeRdTi3axE?si=OQRExGVcdBoROqSc
Danke dafür .