BERLIN. Die PISA-Studie hat gezeigt: Die Begeisterung fürs Lesen ist bei Jugendlichen nicht besonders groß und viele haben Probleme, Texte überhaupt zu verstehen. Lesen muss in den Familien und in der Schule wieder einen größeren Stellenwert bekommen, wird nun gefordert. Die Philologen wollen das Lesen von “Ganzschriften” in den Deutsch-Lehrplänen der Mittel- und Oberstufen zur Pflicht machen.
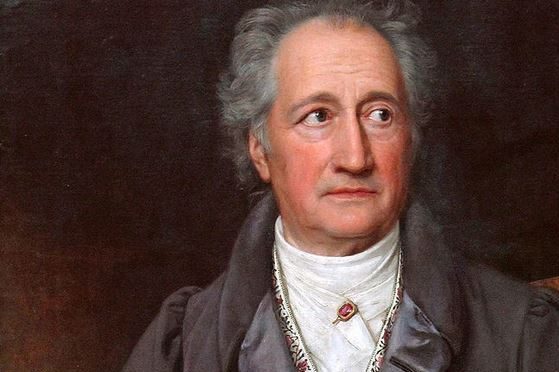
Nach den ernüchternden Ergebnissen des Schulleistungsvergleichs PISA zur Lesekompetenz und Lesefreude deutscher Schüler (News4teachers berichtete) werden Forderungen nach mehr Anstrengungen in Schule und Familie laut. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) rief Eltern dazu auf, ihren Kindern mehr vorzulesen. Der Deutsche Philologenverband forderte eine Pflicht, im Deutschunterricht Bücher komplett zu lesen.
Die deutlichsten Leistungseinbußen gibt’s bei der Lesekompetenz
Die PISA-Studie hat vor allem im Bereich Lesen besorgniserregende Befunde hervorgebracht: Die deutschen Schüler haben sich zwar in allen drei Bereichen der internationalen Vergleichsstudie – Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften – verschlechtert, in Sachen Lesekompetenz ist der Rückgang aber am deutlichsten (um 11 Punkte). Zwar sehen die Bildungsforscher in “demografischen Veränderungen” der Schülerschaft in Deutschland eine Ursache dafür. Doch auch ohne die Aufnahme der Flüchtlingskinder hätten sich die Leistungen der Schülerinnen und Schüler hierzulande verschlechtert. Jeder fünfte 15-Jährige kann nicht einmal auf Grundschulniveau lesen.
Neben den Tests, die die Schüler absolvieren mussten, wurde auch das Thema “Lesefreude” abgefragt. Im Zehnjahresvergleich wird dabei sichtbar, dass das Interesse der Jugendlichen am Lesen abnimmt. Jeder zweite befragte 15-Jährige in Deutschland sagt mittlerweile: Ich “lese nur, wenn ich lesen muss” oder “um Informationen zu bekommen, die ich brauche”. Lesen als liebstes Hobby gibt nur noch jeder Vierte an. Mehr Schüler (34 Prozent) sagen dagegen, für sie sei Lesen Zeitverschwendung.
Neben der Familie sieht Karliczek auch Kitas und Schulen in der Pflicht
“Eltern sollten ihren Kindern schon früh vermitteln, dass Lesen und Bücher zum Leben gehören und das Leben bereichern”, sagte Karliczek nun im Gespräch. “Das beginnt damit, dass Eltern, aber auch vielleicht die Omas und Opas, den Kindern möglichst früh vorlesen. Am besten jeden Abend vor dem Schlafengehen.” Das stärke auch die Beziehung zu den Kindern. Gerade Feiertage und Ferien böten sich zum gemeinsamen Lesen in den Familien an.
Neben der Familie sieht Karliczek auch die Bildungsinstitutionen in der Pflicht, um Sprach- und damit auch Lesekompetenzen zu verbessern. In einem hoch entwickelten Land wie Deutschland müsse jeder gut lesen können, um in Gesellschaft und Arbeitsleben gut zurechtzukommen. Nach Ansicht der Ministerin geht es im Smartphone-Zeitalter vor allem um “vertieftes Lesen”. Nur darüber erschließe man sich komplexe Sachverhalte. Die CDU-Politikerin ist zum Beispiel auch für verbindliche Sprachprüfungen in den Kitas im Alter von vier Jahren. Dann sei genug Zeit, die Kinder bis zum Beginn der Schule zu fördern.
Der Deutsche Philologenverband betont die Wichtigkeit intensiver Lektüre auch im Unterricht. In manchen Bundesländern sei das Lesen ganzer Bücher gar nicht mehr vorgeschrieben, kritisiert die Philologen-Vorsitzende Susanne Lin-Klitzing im Gespräch. Das gelte beispielsweise für Thüringen, Niedersachsen und auch für Bremen ab der achten Klasse. Viele Schulen und Lehrer würden sich dann zwar in Eigenregie trotzdem dafür entscheiden. Aber: “Wenn Lehrkräfte sich dafür rechtfertigen müssen, dass sie von Schülerinnen und Schüler verlangen, sich durch eine (klassische) Lektüre zu arbeiten, weist das auf ein gesellschaftliches Problem hin.”
Philologen: Dass ein Fünftel der Schüler schlecht liest, “muss uns beunruhigen”
Das Lesen von sogenannten Ganzschriften sei wichtig, weil Leser sich dabei “gründlich und vertieft auch in andere Charaktere und Lebenswelten hineindenken und hineinfühlen”. Dadurch würden sie auch dazu animiert, gründlich und vertieft über sich selbst nachzudenken. Lin-Klitzing plädierte für mehr Verbindlichkeit: “Im Deutschunterricht sollte die Lektüre von Ganzschriften in jedem Schuljahr in der Mittel- und Oberstufe verpflichtend sein.” Zu den Ergebnissen der PISA-Studie sagte die Verbandsvorsitzende, sie teile zwar die “Katastrophenstimmung” nicht, “aber dass ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler nach wie vor zur Risikogruppe gehört und nicht vernünftig lesen kann, muss uns weiter beunruhigen”. News4teachers / mit Material der dpa
In Deutschland erreichten 79 Prozent der Schülerinnen und Schüler im Bereich Lesekompetenz mindestens Stufe 2. Der OECD-Durchschnitt lag bei 77 Prozent. Diese Schüler können die Hauptaussage eines mittellangen Textes erfassen, sie können expliziten, zum Teil aber auch komplexen Kriterien entsprechende Informationen finden und nach ausdrücklicher Anweisung über die Funktion und die Form von Texten reflektieren.
Etwa 11 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Deutschland erfüllen die Anforderungen von Stufe 5 oder 6 des PISA-Lesekompetenztests. Sie zählen damit in diesem Bereich zu den besonders leistungsstarken Schülern (OECD-Durchschnitt: 9 Prozent). Schüler, die diese Kompetenzstufen erreichen, können längere Texte verstehen, mit abstrakten und kontraintuitiven Konzepten umgehen und aufgrund von impliziten Hinweisen in Bezug auf Inhalt oder Informationsquelle zwischen Fakten und Meinungen unterscheiden. In 20 Ländern bzw. Volkswirtschaften, darunter 15 OECD-Länder, zählten mehr als 10 Prozent der 15-Jährigen zur Kategorie der besonders leistungsstarken Schüler.
Die Mädchen schneiden in Deutschland im Bereich Lesekompetenz deutlich besser ab als die Jungen. Sie erzielten im Schnitt 26 Punkte mehr (OECD-Durchschnitt: 30 Punkte). Ihr Leistungsvorsprung war damit allerdings geringer als im Jahr 2009, als er noch 40 Punkte betrug.
Der Leistungsunterschied im Bereich Lesekompetenz zwischen Schülerinnen und Schülern mit günstigem sozioökonomischem Hintergrund und solchen mit ungünstigem Hintergrund ist in Deutschland beträchtlich. Er hat sich seit 2009 um 9 Prozentpunkte ausgeweitet. Die privilegiertesten 25 Prozent der Schüler haben gegenüber den sozioökonomisch am stärksten benachteiligten 25 Prozent einen Leistungsvorsprung von 113 Punkten –das sind 24 Punkte mehr als im OECD-Durchschnitt (89 Punkte). Trotzdem liegen in Deutschland etwa 10 Prozent der sozioökonomisch benachteiligten Schülerinnen und Schüler im obersten Quartil der Leistungsverteilung. Dies entspricht in etwa dem OECD-Durchschnitt (11 Prozent).
Zwischen Schülern mit und Schülern ohne Migrationshintergrund besteht im Bereich Lesekompetenz ein Leistungsabstand von 63 Punkten. Dieser Abstand ist auch nach Berücksichtigung des sozioökomischen Profils der Schüler und der Schulen noch vergleichsweise groß (17 Punkte). 16 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund konnten sich jedoch trotz ihrer relativen sozioökonomischen Benachteiligung im obersten Quartil der Leistungsverteilung platzieren.
Der Beitrag wird auch auf der Facebook-Seite von News4teachers diskutiert.
Wenn plötzlich die Lektüre von Ganzschriften gefordert wird (in früheren Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit), dann wird das ja wohl seinen Grund haben, und zwar in der vorherigen Abschaffung eben dieser Lektüre von Ganzschriften. Und welche “modernen Pädagogen” haben das empfohlen?
Zitat zum Thema “Change Management” aus dem Tagungsband “Time for Change?” (J.Krautz, M.Burchardt, Hrsg., 2018) von Seite 90:
“Kritiker öffentlich bloßstellen: Eine Deutsch-Lehrerin in Österreich wehrt sich gegen die Marginalisierung der Literatur. Sie zweifelt an der Sinnhaftigkeit eines Deutschunterrichts, der lediglich mit Textfragmenten arbeitet. Bei einer Lehrerkonferenz spricht der Direktor das Thema an: Leider gebe es immer wieder Querulanten, die sich gegen alles Neue stellen. Die Kollegin wird vor allen anderen als rückschrittlich und unmodern bezeichnet und als jemand, der nicht mit der Zeit gehe. Der Rest der LehrerInnen, die ähnlich denken, schweigen, um nicht auch bloßgestellt zu werden.”
Und diese Methoden kommen von der höheren Schulbürokratie und den psychologischen Beratern im Sinne des “Change Managements”. Der Direktor hatte sich auch nicht selbst ausgedacht, was da modern oder unmodern zu sein hat, sondern es ist ihm quasi befohlen worden,
Wenn man sich der Frage stellt, muss man zuerst einmal ergründen, wie viel “Pflicht” früher zu den Ganzschriften bzw. Lektüren bestand, in welchem Umfang sie in den Lehrplänen erschienen und in Klausuren oder Abschlussprüfungen relevant waren.
Danach kann man dies gegenüberstellen.
Es ist ja nicht so, dass heute NICHTS gelesen würde, im Gegenteil, gerade in die Leseförderung und -motivation wurde investiert. Dies reicht aber offenbar noch immer nicht aus oder die positiven Effekte werden durch andere Entwicklungen aufgehoben.
Weitere Fragen, die sich auch stellen:
Wurden die Ganzschriften gestrichen zu Gunsten anderer Inhalte?
Welche anderen Inhalte haben nun Vorrang?
Ist dies auf ein verändertes Literacy-Konzept zurückzuführen, dass uns u.a. auch die PISA-Studien beschert haben und anderes vorgeben, um auf die Testung vorzubereiten?
Und letztlich: Welche Inhalte möchte man streichen, wenn Lektüren Bestandteil des Unterrichts sein sollen und dafür Zeit eingesetzt werden soll?
Andererseits kann man aber auch überlegen, ob und wie stark Lektüren allein im Unterricht/ für den Unterricht zu lesen sind oder ob man SuS anhält zu lesen, indem man Vorgaben für das Jahr/ für Ferien, also weitestgehend außerhalb des Unterrichts, erlässt. Dies scheint in anderen Ländern üblich zu sein. (seihe Beitrag vom 27.12, 22:38)
Darüber erreicht man, dass sich bestimmte SuS mit bestimmten Werken auseinandersetzen.
Die schwachen 20% wird man über solche Vorgaben nicht erreichen, sie benötigen andere Förderung.
Die Frage, die sich stellt, ist doch, was man zusätzlich zu den ohnehin erfolgenden Maßnahmen machen kann.
Vielleicht kann man sich in anderen Ländern ansehen, wie es dort in den weiterführenden Schulen umgesetzt wird. Ich weiß, dass es schon früher in den Niederlanden für das Schuljahr Listen gab, welche Bücher im Laufe des Jahres verpflichtend zu lesen waren.
Auch in anderen Ländern soll es Bücherlisten für die Ferien geben.
Etwas anderes ist die frühe Leseförderung, bei der es größere Unterstützung und mehr Personal braucht, bis Kinder, die zu Hause keine Förderung erhalten und/oder gleich zu Beginn Schwierigkeiten zeigen, fließend und sicher lesen können, sodass sie das Lesen von Büchern selbstständig schaffen.
Es gilt in den Grundschulen mit Hilfe strukturierter Leselehrgänge die Grundlagen für ein weitgehend automatisiertes Lesen zu legen, damit die Schüler in den weiterführenden Schulen sich die Lerninhalte selbstständig erarbeiten und aneignen können.
Es fehlt gerade in den Grundschulen an einer strukturierten Vermittlung der Lesefähigkeit, da von Anfang an methodenbedingt (Spracherfahrungsansatz ) mehr Wert auf selbst gesteuerte Lesemethoden im individualisierten Methodenmix gelegt wird und so versucht wird, den Kindern das Lesen nahe zu bringen.
Mit bebilderten Anlaut-Tabellen als Hilfsmittel, sollen sich die Schüler die Phonem-Lautbeziehung aneignen, wobei dann überwiegend die Langvokale trainiert werden.
Es werden durch das einseitige Training der Langvokale linguistisch falsch betonte Wörterlauttechnisch erzeugt, in denen der Schwa-Laut in den Endsilbe wie ein langes französisch gesprochenes é betont wird.
So entstehen langsam und auflautierend erfasste, vom Lesenden sprachlich produzierte Textpassagen, die sich vom Inhalt her den Lesenovizen, auf Grund der Länge größerer Passagen, nicht mehr kognitiv erschließen.
Die Schüler trainieren mit dem Arbeitsspeicher Textpassagen zu erfassen. Und dabei bleibt es dann auch, wenn es diesen nicht gelingt die Silben und einzelnen Phoneme im sprachlichen Langzeitspeicher zu verknüpfen. Wer bis zum dritten Schuljahr es nicht gelernt hat flüssig automatisiert zu lesen, dem bleibt ohne einen erheblichen Mehraufwand der Zugang zum flüssigen Lesen sehr wahrscheinlich auch weiterhin versperrt.
“Wer bis zum dritten Schuljahr es nicht gelernt hat flüssig automatisiert zu lesen, dem bleibt ohne einen erheblichen Mehraufwand der Zugang zum flüssigen Lesen sehr wahrscheinlich auch weiterhin versperrt.”
Ja, das sehe ich auch so.
Wobei ich der Meinung bin, dass es diesen “Mehraufwand” schon vorab gebraucht hätte, weil diese Kinder im Unterschied zu anderen das Lesen nicht erlernen konnten. Dabei kann man auf die Materialien oder Lehrgänge wenig Rückschlüsse ziehen, da diese in vielen Klassen ganz unterschiedlich sind, schwache Leserinnen und Leser aber in allen Landesteilen in den Schulen auffallen.
Den Grund sehe ich in mangelnden Lernvoraussetzungen unterschiedlichster Art, die diese Kinder nicht allein kompensieren können, sodass das Erlernen des Lesens eine nicht zu bewältigende Herausforderung darstellt.
Um dies zu erkennen, muss man jedoch nicht warten, bis das Kind in Klasse 3 noch immer nicht ausreichend lesen kann, sondern sollte Möglichkeiten innerhalb des Schulsystems installieren, diesen Kindern zu helfen.
Dazu gehört eine gute Diagnostik und eine intensive Förderung in sehr kleinen Gruppen, bei der auf die entsprechenden Lernvoraussetzungen eingegangen werden kann.
Je älter die Kinder werden, desto schwieriger wird es, an den Grundlagen zu arbeiten.
Eine anders gelagerte Förderung würde ich bei denen ansetzen, die zwar ab Klasse 2/3 flüssig Vorlesen können, die Inhalte des Textes aber nicht erfassen. Auch hier bräuchte es Hilfen, den Kindern einen Zugang zum sinnentnehmenden Lesen zu vermitteln.
Dazu bedarf es aber in Städten mit einem sehr hohen Anteil an Kindern aus den Risikogruppen sehr viel kleinerer Klassen bzw. mehr Lehrer in den ersten beiden Klassen. Es geht darum, den Anschluss an die Kinder mit den besseren Lernvoraussetzungen möglichst durch intensiviertes Training aufzuholen.
Man muss aber auch dazu die Risikokinder im Vorfeld der Schulen, also bereits in den Kindergärten erfassen, und diese dort gezielt an das sprachliche Niveau heranführen, das es bedarf, um eine Beschulung durchführen zu können. Wir benötigen also mindestens zwei beitragsfreie Kindergartenjahre vor der Einschulung.
Und dort muss professioneller gearbeitet werden, als man es hier in NRW zuweilen erleben muss.
Von Sprachförderung und Heranführen an konzentriertes Arbeiten mit Malstiften, Blatt und Papier wird dies nicht immer im richtigen Maß von jedem Kindergarten verwirklicht. Auch mit dem Zahlenraum bis 10 und kleinen Mengenbegriffen sowie den Großbuchstaben wird meistens nicht gearbeitet.
Es existieren Stadtteile, die eine größere Anzahl an Risikoschülern aufweisen als in sozial besser gestellten Stadtgebieten.
Und so benötigt man eben in den Risikobezirken eben auch mehr Personal und auch mehr erweitertes Personal an Lernbegleitpersonal, Sozialarbeitern und eventuell auch an Psychologen.
Stimme Ihnen voll zu!!! Ungleiches ungleich behandeln: sozialindizierte Ressourcensteuerung
Das sollte sich nicht auf Städte oder Stadtteile beschränken, es bräuchte flächendeckend bessere Möglichkeiten.
Und es wäre gut, dies schleunigst umzusetzen, statt sich weiter hinter Statistiken oder frommen Wünschen zu verstecken: Jeder weitere Jahrgang ist ein verlorener und Eltern, die selbst nicht fließend lesen gelernt haben, werden ihren Kindern nicht vorlesen (können), die mit Lesen im Zusammenhang stehenden Fähigkeiten im Alltag nicht vorleben und die Tragweite dessen womöglich nicht verstehen.
Jaja: “Ungleiches ungleich behandeln”, und das aber bitte “flächendeckend” (also mit der Gießkanne?).
Es wird dabei übersehen, dass das gegliederte Schulsystem per se eine Maßnahme zum “Ungleiches ungleich behandeln” ist. So wie sich das Gymnasium nach 1945 neu erfunden hat, war es kein Paradies, aus dem man Arbeiterkinder aussperrte, sondern es war eine Institution, die sehr hohe intellektuelle und theoretische Anforderungen an die Schüler stellte (dafür wurde etwa das praktische Werken kleingeschrieben). Da wurde mehr gefordert als gefördert, und als Paradies sahen das längst nicht alle, man setzte einen gewissen Lernwillen voraus. Natürlich hatte man auch mehr Hausaufgaben und mehr Klassenarbeiten als an der Hauptschule, und schwache Leute mussten “absteigen” wie aus der Bundesliga.
Dagegen gibt es heute die Mentalität, dass alle ohne eigene Anstrengungen zu “fördern” sind, alles muss freiwillig sein, Hausaufgaben gelten als “sozial ungerecht”, ein schulischer Abstieg wird teilweise in Koalitionsverträgen verboten, die Abiturquote soll durch staatliche Maßnahmen erhöht werden usw.
Und noch eins: Wer so argumentiert wie Herr Möller, will einfach nicht sehen, dass die Ungleichheit der Kinder ganz wesentlich von Art. 6 GG herrührt, der den Eltern alle Macht über ihre Kinder gibt (außer in Extremfällen), im Positiven wie im Negativen. Es ist ein logischer Widerspruch, das durch staatliche Fördermaßnahmen ausgleichen zu wollen, ohne die Eltern in die Pflicht zu nehmen. Beide Einflüsse können nämlich direkt gegeneinander gerichtet sein, z.B. bei religiösen Spinnern, die ihre Kinder von “weltlichen Einflüssen” abschirmen wollen. Unsere Gesellschaft basiert darauf, dass alle sich selbst in Eigenverantwortung organisieren (das geht auch, wenn man materiell arm ist). Das Gegenmodell ist die staatliche Fürsorge-no-child-left-behind-Mentalität, die immer postuliert wird, aber niemand scheint zu wissen, wie das praktisch gehen soll, ohne auch mal Zwang auszuüben, damit die “Risikoschüler” lesen und schreiben lernen und auch tatsächlich lesen. Stattdessen scheinen die an den Ganztagsschulen Fußball zu spielen, siehe news4teachers zum Thema “Fußballprojekte iin der Ganztagsschule sind ein Renner”.
@ Carsten60: Ihre Einschätzung, dass früher das Gymnasium eine Institution war, “die sehr hohe intellektuelle und theoretische Anforderungen an die Schüler stellte” teile ich nicht.
Ich habe diese nicht so erlebt (Eintritt ins Gymnasium 1955 und Abitur 1964). Woher haben Sie denn Ihre Einschätzung?
Was allerdings so war, war die geringe Anzahl von Kindern aus bildungsfernen Schichten (wir waren hier nur 3 von 54). In meiner Grundschulklasse in einem Arbeiterviertel im Ruhrgebiet gab es eine Reihe von Kindern, die ebenfalls das Gymnasium locker geschafft hätten wie ich, sie wurden aber an der Volksschule angemeldet und wenige an der Realschule.
“Unsere Gesellschaft basiert darauf, dass alle sich selbst in Eigenverantwortung organisieren”.
Ein guter Spruch, der für das Bildungsbürgertum mit entsprechen der Unterstützung sicherlich zu realisieren ist. Dies gilt aber für die wenigsten aus bildungsfernen Schichten, die wenig Anregung und Unterstützung in ihren Elternhäusern erhalten. Hier muss die Schule Kompensationsarbeit leisten. Tut sie aber nicht hinreichend, auch weil die notwendigen Ressourcen hierzu fehlen.
Noch kurz zu Artikel 6 GG.
Was halten Sie denn davon, wenn beim Übergang aus der Grundschule die Grundschulempfehlungen sowohl nach oben (wie heute z.B. in Bayern) sondern auch nach unten verbindlich gemacht würden. Dann wären Abweichungen nach unten, wie häufig bei bildungsfernen Eltern praktiziert, nicht mehr möglich. Zumindest die sekundären Effekte würden dadurch reduziert.
Flächendeckend ist für mich nicht gleichbedeutend mit “Gießkannenprinzip”.
Angemerkt war, dass es mehr Förderung in großen Städten in bestimmten Stadtteilen geben müsste.
Darauf habe ich mich bezogen und bereits oben dargelegt, dass es auch in anderen Schulen Kinder gibt, die dringend Förderung bedürfen, diese aber außerschulisch nicht erwarten können und innerhalb des Schulsystems derzeit mangels Ausstattung nicht erhalten können.
Wenn Sie darauf setzen möchten, dass in der Gesellschaft sich jeder selbst organisiert und dies der Gesellschaft zuträglich ist, müssen Sie die dadurch entstehenden Nachteile in Kauf nehmen.
Entsprechend dürften Sie die Pisa-Ergebnisse ja nicht weiter tendieren, schließlich haben hier die betroffenen SchülerInnen ganz eigenverantwortlich das Lesen vernachlässigt und es schadet Ihrer Meinung nach der Gesellschaft nicht, wenn 20% oder mehr nicht einmal geringste Lesefähigkeiten aufzeigen.
DAS nennt man Sankt-Florian-Prinzip
und ich wünsche Ihnen und mir keine Gesellschaft, die danach ausgerichtet ist.
Herr Möller: 1. Eins haben Sie also mit Sarrazin gemeinsam: Er kam (als Flüchtlingskind) im selben Jahr wie Sie (nach einer strengen Aufnahmeprüfung) an ein Gymnasium in Recklinghausen. Er scheint das aber anders einzuschätzen.
2. Ich streite Ihnen das Recht ab, rein persönliche Erfahrungen zum Maßstab aller Dinge zu machen. Meine Erfahrungen sind andere: Man war sehr anspruchsvoll, eine “1” gab es in einer Klassenarbeit nur, wenn alles komplett und richtig war, heute genügen 85 % für eine “1-“. Die Klassenkameraden, die früher wegen zweier Fünfen sitzen blieben, bekämen heute für dieselbe Leistung zwei Vieren. Praktisch niemand hatte im Abitur einen Notenschnitt von 1,0. Und nur wenige durchliefen das Gymnasium so “locker” wie Sie das sagen.
3. Deutschland besteht nicht nur aus dem Ruhrgebiet. Nach dem Krieg hatten arme Leute andere Prioritäten als das Abitur. Sie wollten oft, dass ihre Kinder möglichst schnell eigenes Geld verdienten. Und familiäre Traditionen gab’s auch: es galt angeblich als Ehre, wenn der Sohn eines Bergmanns wieder Bergmann wurde.
4. Ich habe kein Problem mit einer verbindlichen Übergangsempfehlung nach oben UND nach unten. Das wäre sogar sinnvoll. Ich fürchte nur, es könnte Einwände dagegen geben, wenn auf dem platten Land das nächste Gymnasium unzumutbar weit weg oder überfüllt. aber die Realschule besser erreichbar ist. Leute wie Sie übersehen gern die Ungerechtigkeit im Verhältnis Stadt/Land. Nicht ohne Grund gibt es in Großstädten überproportional viele Gymnasiasten, aber niemand fordert kostenlose Schulbusse auf dem Land als “Förderung”.
Palim und Herr Möller: Sie reden beide mit der üblichen Rhetorik weitgehend am Kern meines Beitrags vorbei. Ich leugne nicht, dass die Risikoschüler speziell behandelt werden müssten, aber wenn Sie meinen, rein freiwillige Angebote würden das schon richten, dann unterstellen Sie genau jene Selbstorganisiertheit, die Sie bei mir kritisieren. Da müsste ZWANG ausgeübt werden (auch GEGEN die Eltern), sonst spielen die Risikoschüler in den Ganztagsschulen einfach Fußball (n4t berichtete) statt lesen und schreiben zu üben. Hier zeigt Art 6 GG seine negative Seite: Der Staat ist ohnmächtig gegen den Einfluss der Eltern, und da hilft das Gesäusel vom unverbindlichen (!) “Fördern” eben nicht weiter.
Ich habe das Gymnasium in den 70er Jahren auch nicht als eine feste Institution erlebt, die sich alleine durch einen möglichst groß erzeugten Leistungsdruck und möglichst gute Schülerleistungen definiert.
Es waren Kinder alle gesellschaftlichen Gruppen entsprechend ihres möglichen Entwicklungspotentials am Gymnasium vertreten. Den meisten Lehrern ging es neben der Vermittlung des Fachwissens auch um eine Förderung der Entwicklung der Einzelpersönlichkeiten, und wir durften 9 Jahre das Gymnasium besuchen, wobei man sich fachspezifisch ab der 11. Klasse eigene Schwerpunktfächer und Nebenfächer auswählen durfte, um weitere Punkte zu sammeln und andere eventuell Fächer auszugleichen oder eigene Interessensgebiete zu stärken.
Dadurch hatte man deutlich mehr Stunden als es dem Sollzustand entsprach.
Zusätzlich gab es Literatur als Fach, in dem wir sehr viel Primärliteratur lasen und gemeinsam die Buchinhalte anschließend besprachen und diese in den geschichtlichen Kontext einzuordnen und so besser verstehen zu lernen, um sich in andere Denkweisen aus anderen Zeiten zu versetzen.Man erfährt auf diese Weise einen sehr viel tiefer gehenden Eindruck über geschichtliche Abläufe.
Ich kann hier nicht feststellen, dass hier jemand von den der Demokratie sich verpflichtet fühlenden Mitdiskutanten inhaltlich Gemeinsamkeiten mit einem Herrn Thilo Sarrazin hat.
Ich habe selbstverständlich über den Großraum Münster und NRW geschrieben.
Anderswo mag die Vermittlung des Lesens anders erfolgen.