DORTMUND. Immer wieder melden sich Kritiker zu Wort, die meinen, digitale Medien würden das Lernen in der Schule beeinträchtigen. Eine neue Studie der TU Dortmund widerspricht diesem Verdacht nun deutlich – und das in der Königsdisziplin, dem Lesen: Beim Erlernen neuer Wörter erzielen Grundschulkinder am Bildschirm dieselben Ergebnisse wie beim Lesen auf Papier. Tablets bieten darüber hinaus sinnvolle Fördermöglichkeiten.

Die Frage, ob Kinder in der Schule lieber mit Papier oder Tablet lernen sollten, spaltet die Bildungsdebatte. Nun liefert das Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS) der Technischen Universität Dortmund empirische Evidenz, die manche überraschen dürfte: Für das Lernen neuer Wörter macht es keinen Unterschied, ob Viertklässler kurze Texte digital oder analog lesen. Das belegt die Studie „Digital and Analogue Reading: Effects on Vocabulary Gains“ (DiAna), an der 405 Schülerinnen und Schüler aus Nordrhein-Westfalen teilnahmen.
![]()
Nutzen Sie das Potenzial digitaler Lese- und Sprachförderung! Mit dem Chancentablet stellt Samsung Grundschulen eine Lösung zur Verfügung, die nicht nur digitales Lernen ermöglicht, sondern auch die individuelle Förderung von Basiskompetenzen wie Lesen und Schreiben.

Das Paket, das im Rahmen des Startchancen-Programms konzipiert wurde, vereint leistungsstarke und robuste Endgeräte mit integrierten Softwarelösungen von Samsung-Partnern. Damit bietet Samsung Grundschulen einen unkomplizierten Einstieg in das systemoffene technische Ökosystem „Samsung Neues Lernen“ an. Hintergrund: Systemoffene Lösungen binden Schulen nicht an spezifische Hard- und Softwarelogiken einzelner Hersteller. Sie erlauben es den Lehrkräften, Instrumente und Tools eigener Wahl einzusetzen. Das Chancentablet ist mit drei verschiedenen Lernlösungen für eine differenzierte Lese- und Rechtschreibförderung ausgestattet – und mit Diagnosetools. Damit richtet sich das Angebot insbesondere auch an Kinder mit besonderem Förder- bzw. Unterstützungsbedarf (LRS, DaZ).
Informieren Sie sich gerne – hier!
Die Kinder lasen Texte mit rund 300 Wörtern – entweder auf Papier oder am Bildschirm – und wurden anschließend in einem Wortschatztest überprüft. Das Ergebnis: Der Lernzuwachs war in beiden Gruppen gleich groß. Weder das Textverständnis noch die Motivation unterschieden sich signifikant zwischen den beiden Leseformen.
Lesen am Tablet: weniger anstrengend – aber genauso effektiv
Ein Unterschied zeigte sich allerdings bei der empfundenen mentalen Anstrengung. Viele Kinder gaben an, dass sie das Lesen am Bildschirm als weniger anstrengend empfanden. Projektleiter Dr. Thomas Brüggemann vom IFS erklärt: „Die bisherigen Studien deuten darauf hin, dass das Lesen am Bildschirm nicht grundsätzlich weniger anstrengend ist. Vielmehr scheinen sich die Kinder beim Lesen am Bildschirm etwas weniger anzustrengen. Das könnte daran liegen, dass sie Bildschirme oft mit schnellen Interaktionen und kurzen Textformaten verbinden.“
Für den Lernerfolg hatte das aber keine Bedeutung: Die empfundene Anstrengung wirkte sich nicht auf den Zuwachs des Wortschatzes aus. Damit widerlegt die Untersuchung die weit verbreitete Annahme, dass das Lesen auf Papier grundsätzlich bessere Lernergebnisse hervorbringe.
Keine Nachteile für digitales Lesen – aber klare pädagogische Grenzen
Die Ergebnisse haben bildungspolitische Relevanz: Digitale Lesemedien sind längst Teil des Unterrichtsalltags. Schon 2021 nutzten laut IGLU-Studie knapp 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler mindestens einmal pro Woche ein digitales Gerät im Leseunterricht. Dass digitale Medien den Lernerfolg beim Lesen beeinträchtigen könnten, galt bisher als mögliches Risiko.
Für IFS-Direktorin Prof. Dr. Nele McElvany weisen die neuen Befunde darauf hin, dass digitale Lesemedien sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden können. Sie plädiert aber für einen Einsatz mit Augenmaß: „Unsere aktuellen Ergebnisse zeigen, dass die Integration digitaler Lesemedien in der Grundschule differenziert betrachtet werden sollte und kein Selbstzweck ist“, betont sie. „Durchdachte, pädagogisch sinnvolle Einsatzmöglichkeiten haben das Potenzial, Lernprozesse zu ergänzen, ohne dabei den Lernerfolg beim Lesen zu beeinträchtigen.“
Digitale Medien böten zudem Funktionen, die das Lernen gezielt unterstützen könnten – etwa integrierte Wörterbücher oder Vorlesefunktionen. Gleichzeitig warnt McElvany davor, die Technik um ihrer selbst willen einzusetzen: „Der Einsatz digitaler Medien sollte immer pädagogisch begründet und didaktisch durchdacht sein.“
Digitale Sprachförderung zeigt Wirkung schon zu Beginn der Grundschule
Bereits im Frühjahr hatte eine weitere IFS-Studie gezeigt, dass digitale Medien Lernprozesse nicht nur begleiten, sondern gezielt unterstützen können – und zwar schon in den ersten Schuljahren. In der Pilotierungsstudie „Speak“ überprüften die Dortmunder Forschenden, wie eine digital gestützte Sprachförderung wirkt. 323 Erstklässlerinnen und Erstklässler wurden in drei Gruppen aufgeteilt: Zwei Gruppen erhielten über 15 Wochen hinweg regelmäßig digital unterstützte Wortschatz- und Grammatikförderung – entweder nur im Unterricht oder zusätzlich mit Materialien für Ganztag und Familie.
Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Der Wortschatzzuwachs war in beiden Interventionsgruppen deutlich größer (13 bzw. 15 Wörter) als bei den Kindern im regulären Unterricht (7 Wörter). Zwischen den beiden digitalen Fördergruppen gab es keinen signifikanten Unterschied. „Mit den Ergebnissen unserer Pilotierungsstudie haben wir gezeigt, dass die sprachlichen Kompetenzen von Kindern bereits zu Beginn der Grundschulzeit effektiv digitalgestützt gefördert werden können“, erläuterte Projektleiterin Dr. Annik Ohle-Peters. Und Projektmitarbeiterin Leonie Dargiewicz ergänzte: „Eine digitale Sprachförderung mit auditiven und visuellen Elementen eignet sich zum Beginn der Grundschulzeit besonders, da die Kinder beim Schuleintritt sehr unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen und noch nicht über schriftsprachliche Kompetenzen verfügen.“
Deutschland nutzt Potenziale digitaler Bildung bislang zu wenig
Doch trotz solcher Erfolge bleiben die strukturellen Voraussetzungen begrenzt. Zumindest die jüngsten IGLU-Daten zeigen, dass Grundschulen in Deutschland bei der Ausstattung mit digitalen Geräten und deren Nutzung deutlich unter dem EU-Durchschnitt liegen. 2021 hatten hierzulande nur rund 57 Prozent der Viertklässlerinnen und Viertklässler Zugang zu Schulen, an denen im Durchschnitt ein digitales Gerät auf höchstens zwei Kinder kam – europaweit lag der Anteil bei 67,6 Prozent, Spitzenreiter Schweden erreichte sogar 98,5 Prozent. News4teachers / mit Material der dpa
Im November auf News4teachers: Themenmonat Digitalpakt und Co. – Was Schulen wirklich brauchen







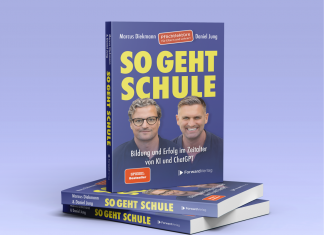


Es geht doch nicht um das Lesen. Es ist egal, ob man ein eBook oder ein Buch liest. Schädlich ist ständige Ablenkung und geringer werdende Aufmerksamkeitsspanne, sowie Social Media. Natürlich gibt es auch positive Aspekte von digitalen Medien. Es kommt eben darauf an, wie man sie nutzt. 7 Stunden am Tag Tiktok schadet halt psychologisch und neurologisch. 7 Stunden eBooks maximal den Augen.
Grundschüler, die an schuleigenen Tablets arbeiten, sind nicht auf Social Media unterwegs und haben dort auch keine Spiele oder sonstige dauerhafte Ablenkung.
Danke! Genau das habe ich auch gedacht.
Aber Differenzierung ist ja komplett out.
Absolut richtig.
Man sieht es doch heute bei allen Jugendlichen. Alle 20 Minuten wird das Handy aus der Tasche genommen. Auf dem Bildschirm wird hin und her gewischt ohne etwas zu machen und dann wird das Handy wieder weggesteckt. Es ist eine Sucht und lenkt ab.
Darüber hinaus sind die Ergebnisse mit dem Tablet nur genauso gut wie ohne. Für einen flächendeckenden Einsatz würde nur sprechen, wenn das Tablet trotz der Nachteile (Kosten, Ablenkung usw.) deutlich bessere Ergebnisse liefern würde.
Wenn trotz der Mehrkosten und des Ablenkungspotenzials nur dasselbe beim Lesen herauskommt, kann man den Erfolg durchaus anzweifeln.
Dazu ein Bonmot, das mehreren Leuten zugeschrieben wird:
“Eine Schulreform gilt bereits dann als Erfolg, wenn sie keinen allzu großen Schaden anrichtet.”
Oder hat jemand schon mal von Schulreformen gehört, die kein Erfolg waren? Die meisten werden ja schon vorweg als Erfolg gepriesen.
Wir müssen den Digitalunterricht mehr ausbauen.
Es kann nicht sein, dass kleine Firmen weltweit tolle online meetings abhalten, während die Schule 100 Kollegen für eine DB oder Gk in einen Virenraum verfrachtet. Warum?
Die Arbeitswelt hat sich komplett gewandelt, wir sind alle vernetzt, haben Netz & Co.
Deshalb
4-Tage Woche für alle Lehrkräfte
30 % Homeschoolinganteil für flexibles Arbeiten
Reallohnverlust von 17% ausgleichen
Digitalkonferenzen anbieten
Was bitte hat die 4-Tage-Woche, das Homeschooling, und der Ausgleich des Reallohnverlusts mit dem Inhalt dieses Artikels zu tun???
Bei einer Schülerarbeit hätte ich sehr klar druntergeschrieben: Thema verfehlt!
An dieser Stelle sage ich nur, es nervt total, wenn die Kommentarfunktion dazu missbraucht wird, um reflexartig und sinnfrei immer wieder die gleichen Parolen zu herunterzubeten!
Na zum tablet Unterricht hat sie doch was gesagt.
Mit der 4 Tage Woche stimme ich Realistin voll zu. Die muss endlich mal kommen!!
Dann reduzieren Sie die Stunden und dann haben Sie auch eine 4Tage-Woche…..in einer Grundschule kann Ihnen das mit einer Vollzeitstelle niemand bieten. Und wegen Ihnen bleiben die Kinder auch bestimmt nicht zu Hause…..
Das wären erhebliche Gehaltseinbußen und ungerecht, wenn andere den vollen Lohnausgleich erhalten!
Die Nummer hinkt gewaltig!
Warum sind Sie denn eigentlich Lehrerin geworden?
Glauben Sie ernsthaft, dass ein echter Mensch gebetsmühlenartig immer wieder den gleichen Stuss schreibt, egal in welchem Zusammenhang?
Nee, die Realistin ist ein Bot, dazu ein schlecht gemachter, da die Interaktion fehlt bzw. nur über die anverwandten Sockenpuppen läuft
LG, Mika
Mir ist ist neu, dass die These, man könne am Bildschirm grundsätzlich nicht sinnvoll lesen üben, weit verbreitet ist. Mir sind andere möglicherweise problematische Aspekte bekannt, die komplexer sind, als das in der Studie verglichene Lesen eines Textes auf Papier und Tablet. Daraus gleich wieder das Heilsbringen der Tablet abzuleiten (oder auch nur die Warnungen gegen die unbedachte Nutzung digitaler Geräte abzutun), erscheint mir verfrüht.
Ebensowenig finde ich verwunderlich, dass Kinder die zusätzlich digitale Förderung erhalten, mehr lernen als Kinder ohne diese Förderung (so stellte sich mir jedenfalls auch schon im Artikel damals die Versuchsanordnung dar).
wenn wir damit etwas Homeoffice für alle hinbekommen, dann mal los.
Es kann nicht sein, dass 1 Teil, wie Hasi, 3 Tage im Homeoffice sitzt, wenn andere an 5-6 Tagen alles in Präsenz machen.
Diese ganzen benefits von heute wollen wir in der Schule auch mal erhalten!!!
Und ja, ich habe Kurse, mit denen geht Homeofficearbeit von zuhause sehr sehr gut!
Da hast du Recht, Petra!
Es ist nämlich so, ganz einfaches Beispiel, bei meinem Mann in der Firma haben sie mittlerweile 8 Wochen Urlaub und das bei einer 35h Woche!
Homeoffice habe ich da noch gar nicht eingerechnet.
Da ist etwas gewaltig aus den Fugen geraten und der Lehrberuf kann nicht mehr mithalten.
Klar sind hier viele idealistisch unterwegs, aber am Ende muss doch auch das Geld und das Drumherum passen, oder nicht?
🙁 🙁
Es geht in dem Artikel nicht um digital arbeitende Lehrer, sondern um Kinder!
Ja, aber Petra geht es ausschließlich um sich….warum sie Lehrerin geworden ist? Keine Ahnung…..
Was das einfache Lesen betrifft, gab es meines Wissens keine ernsthafte Diskussion, ob man besser auf dem Tablet oder im Buch liest. Es geht um das Leseverständnis und um das, was nach dem Lesen inhaltlich hängen bleibt. Und da gibt es durchaus Unterschiede zwischen Papier und Tablet.
2016 wurde dazu von Singer und Alexander (University of Maryland) eine Studie veröffentlicht: Reading Across Mediums: Effects of Reading Digital and Print Texts on Comprehension and Calibration
Dort wurde Studenten ein wissenschaftlicher Text in zwei Ausführungen vorgelegt: digital und analog auf Papier.
“Die Ergebnisse der Studie, die Singer/Alexander mit unterschiedlichen Textformen und Inhalten in zwei Gruppen durchführten, war frappierend:
Zwar konnten allgemeine Fragen zum Text von beiden Testgruppen gleichermaßen gut beantwortet werden. Studenten jedoch, die den Text nur gedruckt gelesen hatten, konnte Detail- und Verständnisfragen deutlich besser beantworten als die Gruppe der digitalen Leser. Dabei konnten die Forscher einen wichtigen Grund ausmachen: Scrollen verhindert, dass sich das Gehirn kontinuierlich mit dem Gelesenen beschäftigt. Offenbar unterbricht die Scrollbewegung mit Daumen, Finger oder mit der Maus den Informationsfluss zwischen Auge und Gehirn, so dass nach einem Scrollen auf dem Bildschirm das Gehirn wieder neu ansetzt und das vorher Gelesene nicht fest verankert ist.”
Letztlich zeigt sich wieder: one size fits all gibt es nicht im Bildungsbereich. Der Einsatz des Mediums hat sich nach dem Ziel zu richten, und nicht andersrum.
Studie beweist: Mit dem gedruckten Buch lernt man effektiver – Cuvillier Verlag
Hier in der Studie ging es um festgelegte Texte teilweise auch mit auditiver und visueller Unterstützung.
Generell kann man aber Sachen, dass Schüler, die E-Books lesen, meist eh die Vielleser sind. Die laden sich dann die Komplettedition einer Buchreihe oder ein älteres Buch, das man nicht mehr unbedingt in der Buchhandlung findet, runter.
Ich meinte natürlich “sagen” statt “Sachen”.
Eine Studie spiegelt in der Regel nicht die Praxis wider. Außerdem geht es ja nicht nur um das Lesen, sondern auch um andere Kompetenzen. Ich finde es nicht richtig, dass Kinder schon in der 2. Unterrichtswoche ein Tablet in der Hand haben und darauf Buchstaben “schreiben”. Diese Kinder können in der Regel noch keinen Stift in der Hand halten.
“Für das Lernen neuer Wörter macht es keinen Unterschied, ob Viertklässler kurze Texte digital oder analog lesen.”
Aber welche der beiden Vorgehensweise ist denn
— preisgünstiger,
— zuverlässiger in der technischen Funktion,
— nachhaltiger?
Man kann auch jedes Brettspiel auf einem digitalen Board spielen, aber macht das wirklich Sinn, wenn es auch in der Standardweise geht? Ich bekomme das Gefühl, das Digitale wird zum Selbstzweck erklärt, und was nicht digital ist, das gilt als “out”. Entsteht da eine neue Modeströmung?
Und was ist eigentlich mit den Erstlässlern, sollen die nicht lesen lernen? Und da gibt’s keine Unterschiede bei digital vs. analog?
Ein klitzekleines, typisches “Studienproblem” bleibt dabei unberücksichtigt:
So lange der Gebrauch nicht dauerhaft reguliert/überwacht wird geht das so:
“Ja, Paaaapi, wir brauchen ein Täbläääht (besser gleich: Ipad, weil sauteuer) zum leeeeeesen!”
*liest brav*
Papi/Lehrkraft dreht sich um:
– swipe
– Taskwechsel
– Brawlstar/Clash of Clans/Roblox/Youtube/Insta regelt
Ist so auf dem Niveau und vibe von “Ich braaaauuuuuche ein Hääädi, wie soll ich sonst anrufen ?”
Die Bildungsdrohne fände das alles doch kein Problem. Sie hat wohl schon Herbstferien, weil das Vorbereiten den gute-Fühlies-Unterricht so aufwändig ist.
In der Tat, da Brawlstar-spielende Khaos-Kevins sich selbst neutralisieren und man sie daher nicht ermahnen oder sich sonstwie kümmern muss.
Selbstverständlich weiß ich natürlich trotzdem, was das *eigentlich* richtige Vorgehen wäre.
Und…Unterricht vorbereiten ?
Lol, für das (indirekt) geforderte Witzniveau der Fühli-Bildungsrad-Schule (ja, mit “d”) dass ich seit grob 1,5 -2 Jahren fahre (und viel positives feedback bekomme, natürlich, ist ja auch in Wirklichkeit kein richtiger Unterricht) braucht es keine Vorbereitung.
Soweit kommt es noch, Unterricht vorbereiten…diesen Luxus/Aufwand gibt es nur für handverlesene SuS, die noch wirklich lernen und richtige Bildung haben wollen. Das sind so grob (je nach Jahr) 5-15 oder selten mal 20%.
Ich liefere, was bestellt wird.
Seitdem ist der Job (nicht die “Berufung”) echt gut.
Ja es ist genauso effektiv, aber warum Milliarden wieder raus hauen? Ein Schreibblock ober Buch wenn zu Boden fällt passiert nicht viel, wer übernimmt die Kosten wenn die Dinger kaputt gehen? Ihr haltet euch für so intelligent, die ganzen Probleme die immer mehr ans Tageslicht kommen sind nicht einfach so entstanden. Die Lehrer meinen heute sie müssten sich mit den Kindern anfreunden, auf Facebook oder sonstigen Seiten. Als ob dabei Respekt entsteht. Vielleicht sollten Entscheidungen die Kinder betreffen auch nur von Leuten mit Kindern gemacht werde und nicht von Psychologen oder Politiker die meinen lesen qualifiziert mich um solche Entscheidungen zu treffen. Es wird alles nur noch entschuldigt mit Psychologie. Wir die die alte Schule noch genießen durften sind diejenigen die jetzt vermisst werden und länger arbeiten dürfen weil ihr die Erwartungen immer weiter runter schraubt. Ich glaube auch nicht das so ein Tablett das beste für die Augen ist von heranwachsenden.
Im Prinzip ist hier ja schon alles gesagt! 🙂
Kleine Anmerkung zur Digitalisierung (oldschool) am Rande:
Mein Sohn ( = Lesemuffel hoch 5 !) hat, weil Papi sehr IT- Affin, schon vor 30 Jahren (mit 9 J.) einen PC in seinem Zimmer gehabt und gerne gespielt. Und weil wir uns geweigert haben, ihm die Spielregeln, Handhabung, etc. …zu erklären, hat er tatsächlich und zwangsweise “richtig lesen” gelernt.
Allerdings hat der Papi (bei beiden Kindern) die Computer 1x wöchentlich sehr genau überwacht, was die Beiden aber nicht wussten, und alle Aktivitäten kontrolliert. (Das funktionierte damals schon, wenn man es wirklich wollte!)
Spannenderweise gab es niemals Beanstandungen, sodass die “Überwachung” mit der Volljährigkeit jeweils endete, ohne dass sie je davon erfahren hätten.
Based, vernünftiges Vorgehen ohne Tamtam.
Uns erwartet eine Epidemie der Kurzsichtigkeit, mit allen Gefahren, die insbesondere hohe Myopie mit sich bringt.