FRIEDLAND. Zwei Lehrerinnen kehren dem klassischen Schulsystem den Rücken und gründen in Friedland, Mecklenburg-Vorpommern, eine Freie Demokratische Schule. Statt auf Frontalunterricht und Notendruck setzen sie auf selbstbestimmtes Lernen und Mitbestimmung. News4teachers hat mit den Gründerinnen, Peggy Kaminski und Kerstin Baumgartner, gesprochen – über Motivation, Zweifel und die Kraft pädagogischer Visionen.

News4teachers: Mit welcher Motivation sind Sie Lehrerinnen geworden?
Kerstin Baumgartner: Ich wollte eigentlich nicht von vornherein Lehrerin werden. Nach der zehnten Klasse habe ich einen Lehrberuf gelernt, dann das Abitur gemacht. Anschließend stand die Entscheidung an: Was mache ich? Ich habe mich für den Beruf der Grundschullehrerin entschieden, weil es mich schon immer gereizt hat, mit Kindern zu arbeiten und ihnen etwas beizubringen. An der Grundschule habe ich bisher alles unterrichtet: Deutsch, Mathe, Sachunterricht, Musik und Religion – das sind auch meine Ausbildungsfächer. Als Grundschullehrer unterrichtet man aber auch andere Fächer, zum Beispiel Werken oder Kunst in Vertretung.
Peggy Kaminski: Ich wollte Kindern und Jugendlichen etwas beibringen und sie aufs Leben vorbereiten. Gleichzeitig wollte ich ihnen zeigen, dass unsere Welt voller Rätsel steckt, die man gemeinsam lösen kann. Als es dann um die Studienwahl ging, habe ich mich für Deutsch und Geografie entschieden. Geografie war mein Steckenpferd – ich wollte mehr über die Welt erfahren und bin auch gern gereist. Diese Begeisterung wollte ich an Kinder und Jugendliche weitergeben. Meine Leidenschaft für die deutsche Sprache kam später dazu. Es steckt so viel darin: Dichter, Denker, Geschichte. Ich bin Studienrätin und war bereits an mehreren Gymnasien und Gesamtschulen tätig. Zurzeit unterrichte ich an einer Grundschule in meinem Wohnort, weil es hier Bedarf gab.
„Das hat mich frustriert, weil ich den Eindruck hatte, die natürliche Neugier der Kinder zu ersticken.“
News4teachers: Sie arbeiten beide an derselben Grundschule. Wie entstand die Idee, eine Privatschule zu gründen?
Baumgartner: Ich arbeite erst seit anderthalb Jahren an dieser Schule. Vorher war ich schon an vielen verschiedenen Schulen tätig, darunter auch an zwei freien Schulen. Dort habe ich unterschiedliche Konzepte kennengelernt. Peggy hat sich schon länger mit dem Gedanken beschäftigt, selbst eine Schule zu gründen. Irgendwann hat sie mich angesprochen und überzeugt, dass das Konzept einer Freien Demokratischen Schule hier vielleicht gebraucht wird. Es ist eine neue Form des Lernens.
Kaminski: Mein großes Umdenken setzte ein, als ich an die Grundschule wechselte. Kinder in diesem Alter sind so unverstellt und ehrlich. Sie sagen einem direkt, wenn ein Thema sie nicht interessiert oder wenn sie andere Dinge lieber lernen möchten. Oft habe ich mich dabei ertappt, wie ich dachte: „Ich würde jetzt lieber Zollstöcke rausholen und draußen Bäume oder Parkplätze vermessen.“ Aber stattdessen musste ich sagen: „Es tut mir leid, wir müssen jetzt Märchen lesen.“ Das hat mich frustriert, weil ich den Eindruck hatte, die natürliche Neugier der Kinder zu ersticken. Gespräche mit Schülern und Eltern, die ebenfalls unzufrieden mit dem System waren, haben diese Gedanken noch verstärkt. Schließlich habe ich mich umgesehen, wie es andere machen, und bin auf das Prinzip der Demokratischen Schule gestoßen.
Etwa zu dieser Zeit kam Kerstin an unsere Schule, und menschlich hat es sofort gepasst. Wir haben uns viel ausgetauscht und Nach und nach rückte das Thema Schulgründung immer mehr in den Fokus. Im März 2024 sind wir dann mit der Idee nach außen getreten.

News4teachers: Kommen wir zum neuen Schulkonzept. Wie unterscheidet sich die Freie Demokratische Schule Friedland von anderen Schulen?
Baumgartner: Bei uns lernen die Kinder und Jugendlichen altersgemischt. Das bedeutet, dass Schüler*innen von der ersten bis zur zehnten Klasse miteinander lernen. Wir starten mit Schüler*innen der ersten bis siebten Klasse. Die Kinder und Jugendlichen suchen sich ihre Lernpartner oder Lerngruppen selbst aus. Die Jüngeren können von den Älteren lernen, und es wird viel gemeinschaftlich gearbeitet.
Ein weiterer Unterschied ist, dass es bei uns keine Noten gibt. Das Ziel ist, dass die Kinder selbst die Welt entdecken und das lernen, was für sie gerade wichtig ist. Außerdem haben wir eine Schulversammlung, in der alles besprochen wird, was für die Gemeinschaft relevant ist – von Regeln bis hin zu Projekten.
Kaminski: Die Kinder und Jugendlichen haben ihren Lernprozess bei uns selbst in der Hand. Sie entscheiden, wann, wo und mit wem sie lernen möchten. Es gibt einen Kursplan, in dem wir Kurse anbieten – das können wir als Lehrkräfte, externe Expert*innen oder auch die Kinder selbst sein. Die Schüler*innen gestalten die Schule aktiv mit – sei es bei der Auswahl der Kurse, der Planung von Projekten oder bei organisatorischen Entscheidungen, wie der Ausstattung der Schule oder der Planung von Ausflügen. Sie lernen auch, Verantwortung zu übernehmen: Für ihre eigenen Ideen, für Finanzen, und für die Umsetzung ihrer Projekte.
Ein weiterer zentraler Punkt ist die Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen und Institutionen. Wir möchten, dass die Kinder und Jugendlichen frühzeitig Einblicke in die Praxis erhalten. Wenn ein Schüler zum Beispiel sagt: „Ich möchte gern mit Holz arbeiten“, dann suchen wir einen Betrieb, der ihm das ermöglicht. Oder wir laden Handwerker in die Schule ein, um Workshops zu geben.
Unser Ziel ist es, praktisches Lernen mit Eigenverantwortung zu verbinden. Die Kinder sollen die Verantwortung für ihren Lernprozess übernehmen, unterstützt von uns Erwachsenen. Ich glaube fest daran, dass wir unseren Kindern mehr zutrauen können. Sie haben schließlich auch gelernt, zu sprechen, zu laufen und zu hüpfen – warum sollten sie den Rest der Welt nicht ebenfalls entdecken und verstehen können?
„Unser Ansatz ist, Demokratie in der Schule wirklich zu leben.“
News4teachers: Liegt der Schule ein bestimmtes pädagogisches Konzept zugrunde?
Kaminski: Wir sind nicht festgelegt auf ein bestimmtes Konzept. Wir möchten offen bleiben, weil Kinder und Jugendliche auf unterschiedliche Arten lernen. Manche lernen gut im Selbststudium, andere profitieren von der Zusammenarbeit mit Älteren oder durch Kurse. Unser Ansatz ist, Demokratie in der Schule wirklich zu leben. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler bei uns mitbestimmen. Es gibt zum Beispiel ein Justizgremium, das aus Schülern besteht. Dieses Gremium entscheidet über Konsequenzen bei Regelverstößen. Solche Regeln entstehen in der Schulgemeinschaft, und die Kinder und Jugendlichen übernehmen Verantwortung dafür.
News4teachers: Wie stehen Ihre Kolleginnen und Kollegen an der Grundschule zur Schulgründung?
Baumgartner: Da gibt es tatsächlich alles. Von Neugier bis hin zu neutralem Beobachten. Einige wünschen uns Glück, andere sind traurig darüber, dass wir die hiesige Grundschule verlassen.
Kaminski: Der engste Kreis fragt oft, ob wir verrückt seien. Lehrkräfte würden doch überall gebraucht werden. Viele Freund*innen und Kolleg*innen sind von unserem Projekt begeistert und einige möchten sich uns am liebsten anschließen. Eine meiner ehemaligen Kommilitoninnen aus dem Studium denkt auch darüber nach, eine Privatschule zu gründen. Wir sind also auch Inspiration für Andere.
News4teachers: Welche Hürden gab es auf dem Weg zur neuen Schule und welche positiven Erfahrungen haben Sie gemacht?
Kaminski: Friedland ist ein kleiner Ort mit 8.000 Einwohnern. Die Leute waren begeistert, dass es plötzlich eine neue Wahlmöglichkeit geben würde. Hier gibt es nur zwei staatliche Schulen, eine Grundschule und eine weiterführende Schule. Viele wollten ihr Kind sofort an unserer Schule anmelden, aber es war uns wichtig, dass sie erst einmal unser Konzept verstehen. Demokratisches Lernen ist schließlich etwas völlig anderes als das, was man aus dem klassischen Schulsystem kennt.
Die Hürden waren vielfältig. Wir mussten ein umfangreiches Konzept schreiben, um es dem Bildungsministerium vorzulegen. Alle Entscheidungen müssen vom Ministerium abgesegnet werden. Gleichzeitig wurden wir immer wieder mit Klischees konfrontiert: „An so einer Schule kann doch jeder machen, was er will. Da gibt es keine Regeln, das ist Laissez-faire.“
Wir begegnen diesen Vorurteilen offen, führen Gespräche und setzen auf maximale Transparenz. Regelmäßig veranstalten wir Infoabende, bei denen wir erklären, wie unsere Schule funktioniert.
Hinzu kommt der finanzielle Aspekt. Mecklenburg-Vorpommern gibt keine finanzielle Unterstützung für die ersten drei Jahre. Das bedeutet, dass wir die Finanzierung selbst stemmen müssen. Zum Teil machen wir das über Elternbeiträge, aber wir suchen auch Investoren, die an innovativen Konzepten interessiert sind.
News4teachers: Was muss alles beachtet werden, wenn man eine Privatschule gründen möchte?
Baumgartner: Man braucht ein Konzept. Dann natürlich ein Gebäude oder zumindest einen Platz, wo das Gebäude entstehen kann. Und man braucht genügend Geld, um in Vorleistung zu gehen, damit alles den Anforderungen einer Schule entspricht.
Kaminski: Personal ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Außerdem braucht man einen Finanzplan, der für die ersten drei Jahre stehen muss. Das Ministerium möchte sehen, wie wir uns finanziell aufstellen und wie die Abschlüsse der Schüler*innen gestaltet werden.
Darüber hinaus gibt es natürlich die klassischen Anforderungen: Brandschutz, Hygiene, Gesundheitsauflagen. Das Konzept muss klar und schlüssig sein und auch räumlich muss alles den Vorgaben entsprechen.
News4teachers: Haben Sie auch Ängste, was die Schulgründung angeht?
Kaminski: Ängste sind natürlich da. Vor allem die finanzielle Frage. Es ist ja immer die Unsicherheit, ob alles so läuft, wie wir es uns vorstellen. Aber ich habe festgestellt, dass in solchen Momenten immer etwas passiert, das uns wieder Mut macht. Manchmal kommt Kerstin mit einer Idee um die Ecke, die mich überzeugt. Oder wir erhalten eine E-Mail oder eine Rückmeldung, die uns zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich glaube fest daran, dass man ein Ziel erreichen kann, wenn man sich wirklich darauf konzentriert und daran arbeitet.
„Wir bauen diese Schule gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen auf.“
News4teachers: Was bedeutet für Sie persönlich Zufriedenheit im Job und insbesondere im schulischen Alltag?
Baumgartner: Zufriedenheit bedeutet für mich, dass es sowohl den Schülerinnen und Schülern als auch den Lehrkräften gleichermaßen gut geht. Es ist wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen gerne zur Schule kommen und wissbegierig bleiben. Genauso entscheidend ist, dass die Lehrkräfte Freude an ihrer Arbeit mit den Kindern haben, motiviert bleiben und die Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern als Bereicherung empfinden.
In staatlichen Schulen wird das leider immer schwieriger. Deshalb freue ich mich schon sehr auf unser Projekt, weil wir dort ganz anders arbeiten werden. Wir Lehrer stehen nicht einfach vorne und geben vor, was die Kinder tun sollen. Stattdessen lernen wir gemeinsam mit ihnen und entwickeln uns selbst dabei weiter. Wir bauen diese Schule gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen auf, und das ist eine ganz neue Art des Zusammenarbeitens.
Kaminski: Ein Vorteil, den wir durch die Schulgründung haben, ist, dass die Kinder, die zu uns kommen, wirklich dorthin kommen wollen. Sie wissen, dass sie bei uns Freiräume haben, die jedoch in einem klaren Regelrahmen gestaltet sind, der für alle gilt. Unser Konzept ist demokratisch: Jedes Kind, egal wie alt es ist oder wie lange es schon dabei ist, hat eine Stimme und kann bei allen schulischen Themen mitentscheiden. Es darf eigene Anliegen einbringen und diese der Gemeinschaft vorstellen.
Unser Ziel ist es, die Schule zu einem Lernort für die Kinder zu machen – nicht zu einem Lernort, den wir gestalten und in den wir sie hineinpressen wie ein Plätzchen in eine Form. Die Kinder sollen ihren Lernort mitgestalten, sodass sie gestärkt und gut vorbereitet für das Leben daraus hervorgehen. Das macht mich froh und stolz.
News4teachers: Zum Abschluss: Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Baumgartner: Dass wir am 1. August starten können und in drei bis vier Jahren sagen: „Das war die richtige Entscheidung.“
Kaminski: Ich wünsche mir eine Bildung, die kindgerechter ist und das Kind in den Mittelpunkt stellt – nicht die abstrakten Interessen eines Systems. Bildung sollte einen höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft haben, und Kinder sollten eine stärkere Lobby bekommen. Nina Odenius, Agentur für Bildungsjournalismus führte das Interview.
Prüfungen und Noten streichen: Schüler legen Reformideen vor – Bildungspolitiker dagegen



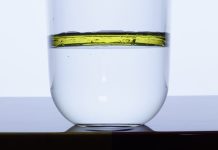






Ich wünsche viel Erfolg! Ich befürworte die Öffnung der Schullandschaft für verschiedene Ideen, damit die Bildungsreformer abseits der staatlichen Schulen ihren Visionen nachgehen können, ohne andere Lehrer damit zu belasten.
// Die Kinder und Jugendlichen haben ihren Lernprozess bei uns selbst in der Hand. Sie entscheiden, wann, wo und mit wem sie lernen möchten. Es gibt einen Kursplan, in dem wir Kurse anbieten – das können wir als Lehrkräfte, externe Expert*innen oder auch die Kinder selbst sein. Die Schüler*innen gestalten die Schule aktiv mit – sei es bei der Auswahl der Kurse, der Planung von Projekten oder bei organisatorischen Entscheidungen, wie der Ausstattung der Schule oder der Planung von Ausflügen. //
Genau das möchte ich wegen der damit verbundenen Überforderung nicht für meine Kinder. Kinder sind Kinder und keine Erwachsenen. In einem optimalen Lernumfeld müssen sie sich nicht um organisatorische Dinge kümmern und täglich irgendwelche Entscheidungen treffen, die sie wegen fehlender Lebenserfahrung noch gar nicht fundiert treffen können. Das ist ein Irrweg.
Gäbe es die fordernde Schule der 90er Jahre wieder, die ich in lehrerzentriertem, ruhigem Unterricht genießen durfte, würde ich meine Kinder sofort dort anmelden.
Diese freien Schulformen gibt es doch schon lange. Selbstregulierung als Konzept für das Lernen. Schon in den 1980ern habe ich eine Arbeit darüber geschrieben. Leider funktioniert es nicht bei jedem Kind wie geplant und es gibt genug Schulversager, weshalb manche Schulen ihr Konzept anpassen mussten. Neu ist das nicht.
Mich irritiert immer die Kombination von “gemeinsamem Lernen” und “individuellem Lernen”, so als sei das dasselbe. Individuell kann man auch zu Hause lernen, man müsste gar nicht jeden Tag in die Schule gehen. Gemeinsam lernen kann man eigentlich nur an demselben Thema (nebeneinander zu sitzen allein wird nicht viel helfen), aber das gilt ja wieder als schlecht:
“„Ich würde jetzt lieber Zollstöcke rausholen und draußen Bäume oder Parkplätze vermessen.“ Aber stattdessen musste ich sagen: „Es tut mir leid, wir müssen jetzt Märchen lesen.“ “
Da fragt man sich doch, was passiert, wenn jeder was anderes will. Das könnte doch auch zu einem Chaos führen. Woher kommt der Optimismus, dass sich dieses Problem von alleine erledigt?
Das kommt durch mangelnde Wertschätzung des pädagogischen Erfahrungswissens und einem leichfertigen Fortschrittsglauben, der gern alles über Bord wirft, was nicht neu ist und daher automatisch als schlecht gilt.
Ich stimme zu, dass dieses Modell nach Überforderung der Kids klingt. Trotzdem bin ich auch für individuelles und SuSzentriertes Lernen. Dabei sollen sie aber nicht entscheiden, was sie lernen, sondern eher wann, wie schnell oder langsam und mit welchen Mitteln. Dabei sollen sie nicht allein gelassen werden, sondern angeleitet, bis sie es wirklich auch können. Da würde ich mein Kind anmelden, wenn es das bei uns gäbe.
Kurzum: Die guten Seiten an Montessori-Pädagogik.
Und vorab: Nein, auch Montessori (v. A. in “Reinform”) funktioniert nicht für alle Kinder perfekt.
Warum? Eigentlich ganz einfach: Weil das kein Konzept erfüllt.
Ansonsten stimme ich “mississippi” absolut zu. Erweitere jedoch mit: Kein Konzept funktioniert bei allen Kindern. Genügend Beispiele sieht man bei jedem Konzept, welches
a.) Langfristig ist
b.) Genügend Reichweite hat (mehrere Schulen/Als Gesamtkonzept für alle vorstellbar/keine Einzelfälle und absoluten Ausreißer)
c.) Realistisch umsetzbar für alle wäre [mit ~ dem Durchschnitt “auskommen muss”]
Gibt jedoch “Annäherungen”.
Ich stimme voll zu: es gibt kein Konzept, was gut für alle passt. Daher plädiere ich für mehr Auswahl an öffentlichen Schulformen, so dass nicht nur privilegierte Kids oder die, die zufällig eine in der Nähe haben, in den Genuss kommen.
Sie sprechen mir aus dem Herzen. Ich habe schon viele Gedanken zu dieser Thematik gelesen, auch meine eigene Erfahrungswelt analysiert, nein, Kinder brauchen Struktur. Natürlich gepaart mit Momenten , in denen sie individuell sich einbringen und entfalten können. Und Kinder benötigen Hilfe und Unterstützung von den Lehrkräfte , um lebenslanges Lernen zu lernen, auch wieder gepaart mit helfender Kritik und Lob/ Anerkennung der erbrachten Leistung. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, erst dann gelingt es den Kindern / Jugendlichen selbstbestimmt sich selbst Wissen anzueignen. Doch um dies zu erreichen, benötigt man Lehrkräfte, die selbst diese Fähigkeiten besitzen und Anerkennung erfahren. Man verwendet heute den Begriff” Resilienz “, auch emotionale Intelligenz würde ich sagen. …. was ich beobachte, ist, kommen jüngere Jahrgänge an Lehrer in die Schule, wollen sie soooo viel verändern- eigentlich nicht schlecht, denn die Welt/ mediale Welt / gesellschaftl. Anforderungen etc. verändern sich. Aber das sogenannten “Kerngeschäft”/ das vermitteln von Grundlagen verlieren sie aus den Augen. Sie gehen oft davon aus, wie sie ” heute” Schule haben wollen, nicht, welche Entwicklung/ Zeit sie selbst gebraucht haben, um so zu werden wie sie heute sind. Ja, nicht so einfach! …aber machbar- Kopf hoch…..meine Meinung, die niemand teilen muss.
Zu den demokratischen Strukturen schaue man mal auf:
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedland_(Mecklenburg)
Freie Wähler 34 %, AfD 28 %, rot-rot-grün: 0 %.
Wie hoch der Migrantenanteil ist, steht nicht da, ist vermutlich gering.
Wieso setzen Sie einen hohen Migrantenanteil für eine funktionierende Demokratie voraus?
Eine Brennpunktschule wird das definitiv nicht. Und günstig, dass die Kinder relativ bewusst dorthin gehen (oder eben bewusst von den Eltern dort angemeldet werden). Ich denke, diese Schule wird nicht wirklich ein “Abbild der Gesellschaft” sein, allein das wird vielen Eltern gefallen. So eine Schule haben wir hier auch: privat, ländlich und auf christlichen Grundsätze fußend.
Sehr beliebt. Die Schülerschaft mutet an wie aus der Generation davor. Das pädagogische Konzept scheint mir für die meisten Eltern eher von zweitrangiger Bedeutung zu sein.
Da mein Kind gezwungenermaßen auch an einer (GsD nur zweijährigen) jahrgangsübergreifenden Schuleingangsphase teilnehmen mussze und unsere Erfahrungen damit verheerend sind, eine pragmatische Frage: Wenn die Kinder sich ihre Lernpartner und -gruppenbselbst aussuchen dürfen, dürfen sie dann auch bewusst darauf verzichten und bevorzugt Einzelarbeit machen?
Der Bürgermeister gehört zu den Linken, gleiche Quelle.
Ja, der wurde Jahre vorher schon gewählt. Aber wie kann er eine “linke” Politik machen, wenn die Stadtvertretung mehrheitlich konservativ ist? Schon FW und CDU zusammen haben die Mehrheit. In der Lokalpolitik kommt es viel auf die Personen an, weniger auf Parteidoktrinen. Vielleicht sitzt ja der “linke” Bürgermeister mit “rechten” anderen regelmäßig beim Bier am Stammtisch?
Ob die beschriebene neue Schule den Vorstellungen der Linkspartei entspricht, sei mal dahingestellt. Gilt als Privatschule denen vermutlich als “bürgerliche Segregation”.
Ihre Aussage mit dem gemeinsamen Bier am Stammtisch belegen Sie womit? Ach, ich habe tatsächlich Ihre Einschätzung “vielleicht” übersehen.
Elternbeiträge sind ein guter Filter…
Ich hoffe, das Projekt scheitert nicht an den Finanzen. Ob es eine staatliche Förderung geben wird, wage ich zu bezweifeln, weil die Schule vermutlich nicht über eine Ergänzungsschule ohne eigene Prüfungsberechtigung hinauskommt.
Mir tun die Kinder leid, die ohne eine weitgehende Vermittlung strukturierter Arbeitsweisen,
sich selbst vermitteln sollen, diese Arbeitsstrukturen anzutrainieren und dazu
auch noch das gesamte erforderliche Wissen unserer Gesellschaft sich
selbst erarbeiten sollen.
Lieber @ AvL
Ich habe lange überlegt, kann aber aus dem Artikel nicht herauslesen, was Sie lesen-wo finden-schreibend folgern?
Ich lese ein anderes Konzept heraus.
Bitte erklären Sie es mir (auf Textbasis wär schön).
https://www.schlosstorgelow.de/
Privatschulen sind in Mecklenburg-Vorpommern nichts ungewöhnliches, ebensowenig wie anderswo. Ich wünsche viel Erfolg.
Das Projekt wird wohl scheitern werden, da die Automatisierung
der Lese- der Schreib- und der Rechenautomatisierung in den ersten
zwei Schuljahren nicht strukturiert vermittelt worden sein wird.
Dadurch steigt die Zahl der Fehler und die Automatisierung wird stark verlangsamt,
es wird umgelernt werden müssen. Es bedarf einer anleitenden Begleitung in den ersten Schuljahren, die dann in ein immer weiter eigenständiges Lernverhalten überführt werden kann. Zusätzlich bedarf es der selbstkritischen Eigenreflexion, um sich weiter zu verbessern.
“… wird wohl scheitern werden…”, so ganz genau wissen Sie es nicht? Wie ich Sie verstanden habe, kommen Sie nicht aus dem Bildungsbereich. Woher nehmen Sie Ihre Expertise?
Warum sollte das Projekt scheitern? Vergleichbares gibt’s bereits.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Neue_Schule_Hamburg
Na ja, es werden eben Schüler scheitern, denen die Eltern die für dieses Modell erforderliche Unterstützung nicht bieten wollen oder können.
Schüler scheitern nicht wegen bestehenden Schulmodellen.
Ich verteufele Privatschulen nicht. Die Einrichtungen wie Schloss Torgelow, Louisenlund, Salem,… haben ihre Berechtigung. Es gibt Eltern, welche sich das für ihre Kinder leisten wollen und können. Die Schülerschaft auf diesen Einrichtungen ist übrigens international.
N4T unterstützt ebenfalls das System der Privatschulen, aktuell durch die Bekanntgabe von Stellenangeboten an der Villa Elisabeth auf der Startseite.
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/schulbehoerde/veroeffentlichungen/pressemeldungen/2018-09-10-bsb-zuschuesse-fuer-privatschulen-514034
Meine Zahlen (2018) sind vermutlich ähnlich antiquarisch wie Ihre (2016). Es bleibt eine Kombination von Spenden, Elternbeiträgen und staatlichen Mitteln. Zu Ihrem Hinweis zu der Schule im Berlin habe ich mir spontan die Frage gestellt, wie die Schulaufsicht funktioniert hat.
Die ausgeübte Dienst-, Rechts- und Fachaufsicht der Schulaufsicht eben.
“Warum sollten sie den Rest der Welt nicht ebenfalls entdecken und verstehen können?”
Natürlich können Sie das. Nur werden sie halt in 9 Jahren nicht ganz so weit kommen wie der Rest der Menschheit in 5000.
Die beiden Lehrerinnen gehen mit sehr viel Pathos an die Sache ran und ich wünsche gutes Gelingen. In kleinen Gruppen und mit einem ausgewählten Klientel (Privatschule) kann das auch funktionieren, da wahrscheinlich alle Kinder ähnlich sozialisiert sind.
Je heterogener die Gruppe, umso mehr würde ich diese Art von Schule in Frage stellen. Das sehen wir an Jugendlichen, die wir betreuen, wo sich insbesondere bei den Jungs leider diese “Alpha”-Mentalität etwas durchgesetzt haben. Die lernen, wie man sich “auf der Straße” verhält und unsere Aufgabe ist es, sie gemeinsam mit der Schule überhaupt auf einen Weg zu begleiten, der sich nicht im kriminellen Milleu abspielt. Natürlich sind das Extremfälle, aber ich behaupte, dass ein Schulkonzept wie das hier beschriebene, einfach nicht funktionieren würde.
Doch, das würde auch funktionieren, denn auch auf der Straße lernen die Jüngeren von den Älteren und in kleinen Gruppen oder auch allein.
Allerdings nicht das, was wünschenswert wäre. Und genau hier liegt das Problem.
Sie haben vollkommen recht, eine heterogen zusammengesetzte Schüler*innenschaft könnte bei einem solchen Konzept dann lauter Dinge weitergeben, die die Macherinnen absolut nicht wollen.
Die Kids lernen eben nur das, was sie lernen wollen – nur leider nicht immer schulisch oder Richtung Ausbildung/Studium.
“Könnten weitergeben”, hätten, vielleicht -> und überhaupt – passiert das alles, was Sie unken ?
Im “normalen” Schulalltag lernen die Lieben von all dem soundo schon dazu 🙂
Vielleicht könnte, wäre -> ist? ja die Zusammensetzung an der Schule der 2 Mutigen Mädels eine andere, bessere. Denn Sie sehen ja, wie weit wir anders gekommen sind.
Neues ist nicht immer schlecht, weil es anders ist.
Insgesamt kann es nur noch besser werden.
-> geht auch an den mutlosen, frustrierten SozPäd ):
Was ist jetzt Ihr Problem? Ich habe mich auf @Rüdiger Vehrenkamps Szenario bezogen. Wenn die Schule der beiden Macherinnen eine solche Zusammensetzung hätte, …
Nicht aufregen, sondern genau lesen, bitte!
Ganz ganz viel Erfolg !
Im Ausland erlebten wir, dass ähnliche Systeme gut funktionieren; unsere drei Raubtierchen fanden, als wir zurückkommen, Schule hier einengend und schafften es nur dank ihrer Kreativität, sich anzupassen – alle drei haben Abitur und Studium anschließend geschafft, nicht zuletzt ob des breiten festen Fundaments der ersten Jahre.
Welches Ausland meinen Sie da konkret?
🙂 irgendwo in Africa
Alles klar. Das würde dann auch zu Meldungen aus Kanada passen, dass Kinder die selbst oder deren Eltern aus Afrika eingewandert sind, deutlich überdurchschnittlich häufig höhere Bildungsabschlüsse erwerben als der Landesdurchschnitt, während PoC, die selbst und beide Eltern in Kanada geboren sind nur halb so oft einen höheren Abschluss erwerben als der Landesschnitt.
Das Konzept dürfte wohl auch pragmatischen Erwägungen folgen, da man in einer 8000-Seelengemeinde wohl keine ersten bis siebten oder zehnten Klassen vollbekommen dürfte, auch nicht einzügig.
Aber das gute an kleinen (privaten) Einheiten ist, dass man immer wieder wird nachsteuern können, weil man die entsprechende Handlungsfreiheit genießt.
“Wenn ein Schüler zum Beispiel sagt: „Ich möchte gern mit Holz arbeiten“, dann suchen wir einen Betrieb, der ihm das ermöglicht. ”
Viel Erfolg dabei. Ich bin daran bislang gescheitert.
Warum nicht?
Frontalunterricht hat ausgedient.
Die machen dann
4-Tage Woche
online Stunden
Homeschooling
Hybridkonferenzen
Freiheit und flexibel
Klingt genau nicht danach, sondern eher nach Ganztagsunterricht in Anwesenheit.
Ergibt anders auch keinen Sinn.
Ich wünsche viel Erfolg und viele Erkenntnisse, was funktioniert und was nicht!
Mich hätten zu der Schule noch ein paar Eckdaten interessiert, zumal sie ja theoretisch erst noch starten.
Wie viele Schüler hat die Schule dann und wie viele Lehrkräfte?
Wie die Zusammensetzung der Schülerschaft vom Alter her?
Wie setzt sich die Lehrerschaft zusammen?
Die Interessenslage zwischen Erstklässler und 10. Klässer ist doch sehr unterschiedlich.
Ich habe den Eindruck, die beiden Damen wünschen sich zwar das Beste für die Kinder, haben aber einige Dinge nicht durchdacht:
Schulen vermitteln grundlegende Kompetenzen, Grundwissen der jeweiligen Fächer, können Einblicke vermitteln, vielleicht auch in Bereiche, die man sich sonst nie angeschaut hätte. Darüber hinaus sollten Schulen aber auch vermitteln, dass ich nicht immer alles sofort genau so geliefert bekomme, wie ich es haben will.
Sicher ist es auch mal frustrierend, lesen und schreiben zu lernen und macht sich sofort Spaß. Wenn ich lesen gelernt habe, kann ich aber in eine spannende Welt von Geschichten eintauchen. Ebenso ist das Lernen einer Fremdsprache mühsam, aber ich mehrke schnell, dass ich mehr und mehr verstehen und ausdrücken kann. Insofern ist es sinnvoll, etwas nicht immer nur so lange zu machen, wie es auch Spaß macht!
Vielleicht kann ich mir auch anfangs gar nicht vorstellen, dass ein bestimmtes Fach oder Fachgebiet interessant sein könnte, muss es aber belegen und merke, dass es doch toll ist. Sich nur mit Dingen zu beschäftigen, auf die man Lust hat, schränkt auch den Erfahrungshoriziont massiv ein…
“Wenn ein Schüler zum Beispiel sagt: „Ich möchte gern mit Holz arbeiten“, dann suchen wir einen Betrieb, der ihm das ermöglicht. Oder wir laden Handwerker in die Schule ein, um Workshops zu geben.”
Das hört sich zunächst gut an. Mich stören aber mehrere Dinge:
Zunächst sollte es in der Schule um Grundlagen gehen, die alle Schüler “brauchen” können. Auch wenn wir nicht immer glücklich mit der Entscheidung sind, ist das gesetztlich vorgeschrieben. Darüber hinaus bieten Schulen doch aber Wahlpflichtangebote an. Natürlich kann man einen Wahlpflichtkurs zu Holzbearbeitung anbieten, wenn es genügend Interessenten gibt und natürlich kann und soll man da auch externe Partner involvieren.
ABER:
Vor allem können wir in einer Schule von begrenzter Größe auch nicht alle besonderen Interessen abdecken. Der eine Schüler wird sich vielleicht für Metallbearbeiung interessieren, der nächste für Modellbau, für Töpfern, fürs Schmieden, für Kalligraphie, für 3D-Druck, für Japanisch, für Ägyptische Hieroglyphen, für Segeln, für American Football usw.
→ Natürlich kann eine Schule ein möglichst umfangreiches Wahlpflichtprogramm aufbauen, aber irgendwo sind auch Grenzen gesetzt. Dafür haben Kinder und Jugendliche heute unglaubliche Möglichkeiten, sich über spezielle Themen zu informieren. Das muss nicht alles in der Schule von Lehrkräften organisiert werden…
“[…] wie ich dachte: „Ich würde jetzt lieber Zollstöcke rausholen und draußen Bäume oder Parkplätze vermessen.“ Aber stattdessen musste ich sagen: „Es tut mir leid, wir müssen jetzt Märchen lesen.“ Das hat mich frustriert, weil ich den Eindruck hatte, die natürliche Neugier der Kinder zu ersticken.”
Wenn gerade eine Deutsch-Stunde ist, man sich mit Märchen beschäftigt und daran lesen lernt, dann muss man vielleicht einen spontanen Wunsch auch mal aufschieben. Alleine das muss man für die Arbeitswelt auch lernen. Das bedeutet aber noch nicht, dass man sich nicht kreativ mit Märchen beschäftigen könnte, Bilder oder Comics zu den Inhalten erstellen oder ein kurzes Theaterstück dazu erarbeiten könnte..
Außerdem bedeutet es nicht, dass man nicht die Mathe-Stunden genau für das Messen nutzen könnte, wenn es zum Stoff passt. Alternativ gibt es sicher eine Möglichkeit, am Nachmittag in einem Wahlpflichtkurs oder einer AG die Messungen durchzuführen. Es muss aber nicht unbedingt jetzt in genau dieser Stunde gemacht werden…
Ich bin ein großer Freund davon, Schüler auch immer mal wieder offen arbeiten zu lassen und eigene Projekte bearbeiten zu lassen, Schule zu öffnen, Experten von außen einzuladen oder Exkursionen in die “echte Welt” zu unternehmen.
Was man dabei aber nicht vergessen darf ist der Arbeitsaufwand, wenn man es richtig machen will. Bei Projektarbeit soll am Ende ja auch ein gutes Lernprodukt herauskommen und die Schüler sollen wirklich etwas gelernt haben. Eine Klasse von ca. 30 Schülern in Kleingruppen von 2-3 Schülern eigenständig an Projekten arbeiten zu lassen und sie dabei ordentlich zu betreuen, bringt einen schnell an die eigenen Grenzen.
Darüber hinaus finde ich es zum Großteil nicht effizient, Kinder alles alleine entdecken lassen zu wollen. Natürlich kann ich mir Grundlagen zu einem Thema anlesen. Aber wenn ich ein bestimmtes Thema genauer verstehen will, besuche ich im Zweifelsfall einen guten Workshop, bei dem mir das Thema didaktisch durchdacht beigebracht wird. Genau das sollte Fachunterricht in der Schule doch bringen.
“Ich habe den Eindruck, die beiden Damen wünschen sich zwar das Beste für die Kinder, haben aber einige Dinge nicht durchdacht:”
Und ich hane den Eindruck, dass es Ihnen nicht gelingt, nicht um sich selbst zu kreisen.
“Wäre es nicht selbstwirksamer, wenn der Schüler selbst bei einem Betrieb anfragt, dort ein Praktikum macht und sich selbst mit seinem Thema beschäftigt?”
Wäre es nicht selbstwirksamer, wenn ein Schüler sich nicht gleich alles selbst beibringt und wir ein paar Millionen Lehrerstellen mitsamt Schulpflicht streichen?
“Vor allem können wir in einer Schule von begrenzter Größe auch nicht alle besonderen Interessen abdecken.”
Kann man wohl nicht, aber man kann rotieren.
“Ich bin ein großer Freund davon, Schüler auch immer mal wieder offen arbeiten zu lassen und eigene Projekte bearbeiten zu lassen, Schule zu öffnen, Experten von außen einzuladen oder Exkursionen in die “echte Welt” zu unternehmen.”
Ach was, fällt mir schwer, das zu glauben.
“Was man dabei aber nicht vergessen darf ist der Arbeitsaufwand, wenn man es richtig machen will.”
Sowas, wer genau wird denn mit A12 aufwärts dafür kompensiert?
“Aber wenn ich ein bestimmtes Thema genauer verstehen will, besuche ich im Zweifelsfall einen guten Workshop(…)”
Witzig, dass Lehrkräfte genau das für sich nicht gelten lassen wollen. Da muss immer alles vom Staat bezahlt inhouse stattfinden und natürlich innerhalb der Schulzeit. Gott bewahre, dass man einmal ein Buch in die Hand nimmt.
Wow, Sie haben zumindest ganz schön viel Meinung…
“Was man dabei aber nicht vergessen darf ist der Arbeitsaufwand, wenn man es richtig machen will.”
Sowas, wer genau wird denn mit A12 aufwärts dafür kompensiert?
“Vor allem können wir in einer Schule von begrenzter Größe auch nicht alle besonderen Interessen abdecken.”
Kann man wohl nicht, aber man kann rotieren.
Mich ärgert dieser Service-Gedanke, der Lehrkräften zunehmend entgegengebracht wird:
Wir sind in erster Linie Fachlehrer und werden genau dafür bezahlt, den Schülern einen guten Unterricht zu ermöglichen und sie auf Prüfungen vorzubereiten. Hier geht es aber um alle möglichen Dinge, die außerhalb des regulären Unterrichts stattfinden. Es ist eben nicht die Aufgabe der Lehrkräfte, für alle Partikularinteressen der Schüler entsprechende Zusatz-Angebote zu machen:
Wenn heute ein Schüler Lust auf Töpfern hat, soll die Schule dann einen Workshop organiseren, eine AG anbieten und Töpferscheiben und einen Brennofen anschaffen? Morgen hat jemand Bock, schweißen zu lernen, also sollen wir das Material kaufen, uns einarbeiten, damit das Kind bei uns schweißen lernt?
Übermorgen ist dann jemand an Astronomie interessiert – sollen wir dann Teleskope anschaffen? Am Ende steht der ganze Kram dann irgendwo rum, weil man die Angebote rotiert und erst in ein paar Jahren vielleicht wieder macht?
Stattdessen wird man als Schule eben bestimmte Angebote haben, die man immer wieder anbietet. Im Werkbereich einer anderen Schule habe ich mal an einem Schmiede-Workshop teilgenommen. Die sind richtig gut dafür ausgestattet, das war beeindruckend. Eine andere Schule macht wirklich Metall-Guß! An einer anderen Schule gab es bspw., mit Unterstützung eines Imkers, Schulbienen. Die nächste Schule macht 3D-Druck und hat eine ganze Batterie von 3D-Druckern rumstehen.
Solche Angebote werden i.d.R. betreut von Lehrkräften, die auch privat Interesse daran haben, man baut sowas nicht einfach mal auf und die rotiert das auch nicht. Dafür hat man ein begrenztes Angebot, kann aber fachlich auch wirklich in die Tiefe gehen.
“Gott bewahre, dass man einmal ein Buch in die Hand nimmt.”
Es geht hier im Artikel um handwerkliche, praktische Tätigkeiten wie z.B. Holzbearbeitung. Das können Sie gerne ergänzen mit Metalbearbeitung, Schweißen, Schmieden etc. Und Sie meinen, sowas bringt man sich mal eben mit einem Buch bei?
Genau das meine übrigen ich mit Effizienz. Man kann das bestimmt alles irgendwie anlesen, ausprobieren, selbst entwickeln. Das ist aber absolut nicht effizient und macht irgendwann auch keinen Spaß mehr. Stattdessen muss es dann jemanden geben, der es einem beibringt…
“Wäre es nicht selbstwirksamer, wenn der Schüler selbst bei einem Betrieb anfragt, dort ein Praktikum macht und sich selbst mit seinem Thema beschäftigt?”
Wäre es nicht selbstwirksamer, wenn ein Schüler sich nicht gleich alles selbst beibringt und wir ein paar Millionen Lehrerstellen mitsamt Schulpflicht streichen?
Es geht hier um eine Schule mit Schülern bis zur 10. Klasse. Man muss ihnen nicht alles hinterhertragen:
In einem meiner Kurse wollten zwei Schülerinnen unbedingt einen Arzt einer bestimmten Fachrichtung für einen Vortrag in der Schule haben. Auch wenn ich etwas im Hintergrund abgeklärt und den Kontakt vermittelt habe, haben die beiden Mädchen ihn per E-Mail angeschrieben und eingeladen.
Was meinen Sie, wie stolz die waren, als er dann seinen Vortrag bei uns gehalten hat? – Das meine ich mit Selbstwirksamkeit!
Meine Güte, Sie werden ziemlich persönlich. Warum ärgert Sie dieser Beitrag so, dass Sie ohne sachliche Argumente in den Angriff gehen?
Liebe Kommentierende!
Vielen Dank für Ihre Stellungnahmen und Einblicke in Ihre Gedanken, Bedenken und Wünsche. Sie sprechen Punkte an, die uns schon zahlreich entgegengebracht wurden und über wir uns jederzeit gern austauschen.
Für mich ist dabei immer interessant zu wissen, von welchem Standpunkt aus Sie argumentieren: Sind Sie im Schuldienst aktiv bzw. haben Sie viele Jahre Kinder unterrichtet? Haben Sie mehrfach Gespräche mit Kindern und Jugendlichen geführt, die Ihnen Einblicke in Ihre Einstellung zum Lernen, in ihr Leben und ihre Lernbeziehungen geben? Wir haben es über 38 Jahre lang getan; denn uns liegen die Menschen, die vor uns sitzen, am Herzen: was sie können, was sie erreichen wollen, was sie brauchen, um weiterzukommen. Dass sie dafür lesen, rechnen und schreiben müssen, sei unbenommen. Doch gehört zum Lernen für’s Leben nicht auch dazu, wie ich es für mich so nutze, dass ich im Leben zurechtkomme und lebenslang lernen will (der Punkt zur Weiterbildung wurde in den Kommentaren ja auch erwähnt)?
Lassen Sie mich an dieser Stelle einen Vergleich aufmachen: Wenn ich krank bin, gehe ich zu einem kompetenten Arzt, der mir hilft. Kompetenz ist hier der Schlüssel des Vertrauens, richtig? Welchen Grund gibt es, uns als erfahrene Lehrkräfte nicht zu vertrauen? Denn wir sind erfahrene Lehrkräfte – Staatsexamen I + II, haben Erfahrungen aus 38 Jahren im Schuldienst, waren in 6 Bundesländern als Lehrkräfte im Grundschul-, Gesamtschul- gymnasialen Zweig tätig, haben Brennpunktschulen als auch Wohlstandsverwahrlosung kennengelernt, haben Funktionen wie Schulleitung, Steuergruppenmitglied und AG’s inne gehabt und haben selbst Kinder im Alter von 6 bis 17 Jahren. Wie schätzen Sie nach diesem “Fakten-Check” unsere Kompetenz als Lehrkräfte ein?
Wir haben Kinder ins Schulleben begleitet und ins Leben entlassen – und dabei immer den Blick auf das einzelne Kind gehabt. Glauben Sie mir, uns ist bewusst, dass unser Schulkonzept Kontroversen hervorruft – und das ist gut so. Denn Sie, Ihr Nachbar, Ihr Kind, mein Kind oder ich sind unterschiedlich. Und diesem Unterschied geben wir Raum. Finden Sie diesen Ansatz verwerflich? In unseren Augen ist es wichtig, Co-Existenzen zuzulassen, und Unterschiedlichkeiten als Bereicherung zu sehen. Oder bevorzugen Sie Einheitlichkeiten?
Aus welchem Grund stehen Freude und Lernen in einem Widerspruch? Mit Freude zu lernen bedeutet, dass Kinder im Flow sind bei dem, was sie tun. Denn dann verankern sie das Wissen und Können viel nachhaltiger als wenn sie es nach Vorgaben erwerben sollen. Wie leicht fällt es Ihnen, wenn Sie sich für ein Thema interessieren? Wie viele Informationen merken Sie sich, wenn Ihnen jemand etwas über ein Thema erzählt, das Sie nicht interessiert? Während unseres Lehrerdaseins haben wir uns intensiv mit dem Lernen beschäftigt – in Präsenzveranstaltungen, durch Onlinekurse, Diskussionsforen, Selbststudium und durch Lesen von Fachliteratur! – Grundlagen und Bausteine, die unsere Kompetenzen weiter ausgebaut haben. Deswegen stelle ich mich gern Diskussionen. Und glauben Sie mir, die führen wir mit unserem Konzept oft und tiefgründig. Dabei stelle ich häufig eine Frage: Wie wäre es in Ihren Augen besser? Lassen Sie es mich gern wissen. Denn ich denke, dass wir in diesem Punkt dasselbe Ziel haben: Wir wollen weiterkommen!
Viele Grüße aus Friedland i. Meckl.,
Peggy Kaminski
PS. @Nick, @AlterHase: Wie soll ich die Diskussion über unseren Bürgermeister und seiner Parteizugehörigkeit einordnen? Vielen Dank für Ihre Erläuterung.
Ich persönlich glaube zwar nicht an die allgemeine Anwendbarkeit Ihres Konzeptes, finde aber den Versuch sehr interessant. (Gerade deswegen)
Und dieser scheint auch gut zu der konkreten Lage “vor Ort” zu passen.
Das kann ja eine ganz wesentliche Stärke sein, nicht immer muss alles gleich maximal übertragbar sein.
Ich wünsche Ihnen daher viel Erfolg und bin gespannt auf weitere Ergebnisse bzw. Berichte in Zukunft. Ich würde das jedenfalls gerne lesen.
Hallo, ich finde es super, dass Sie die Beiträge hier lesen und ernst nehmen.
Generell würde ich sagen: Viel Erfolg. Die Jahre werden von selbst zeigen, ob das Konzept sich durchsetzt. Erstmal Phase 1 überstehen und dann die nächsten Phasen (langjähriges Bestehen, erfolgreiche Abschlüsse der SuS usw.) schaffen. Das Endresultat wird zeigen, “ob es klappt oder nicht”.
Ich hätte jedoch auch eine Frage:
– Wie unterschiedlich ist Ihr Konzept zu anderen Konzepten? Also konkret nehme ich mal
-> Falko Peschel [Offener Unterricht] (Wird ebenfalls als sehr stark “laissez-faire” eingeordnet)
-> (Maria/Mario) Montessori [Kindgerecht, Selbstgesteuertes Lernen, “Flow”/”Polarisation der Aufmerksamkeit”, (Montessori-Materialien), freie Wahl der Arbeit, altersgemischte Klassen (bspw. 1.-6. Klasse), Lehrer als Begleiter – jedoch auch als Regulator, dass etwas gemacht wird und das Kind sich nicht selbst überlassen ist/wird]
—> Folgefrage: Ihr Konzept liest sich etwas wie Montessori für mich (erster Eindruck) – warum “steigen” sie hier nicht ein und nutzen ggf. die Vorteile des Konzepts? Was finden Sie an Montessori hier “schlecht” bzw. wollen Sie besser machen? Wodurch stechen Sie hier raus als Schule/Konzept?
Ich freue mich auf N4T über die neue Schule und das Konzept zu lesen und wünsche mir regelmäßige Artikel über die Entwicklung der Schule.
Aus meiner eigenen Erfahrung mit freier Schule kann ich berichten, dass ein gutes Team das wichtigste ist. Passen sie gut auf wen sie an der Schule beschäftigen. 1-2 toxische Personen an entscheidenen Stellen und ihnen fliegt alles um die Ohren.
Liebe Grüße aus MV
Da haben sich Leute vor Ort:
– ein eigenes Projekt ausgedacht
– das genehmigt bekommen
– setzen um, was sie für richtig halten
Ich persönlich sehe das zwar nicht als skalierbar an…aber, warum nicht?
Versuch macht klu-ch. 🙂
Der Versuch an sich kann schon Erkenntnisse generieren.
Und Nachfrage scheintbes auch zu geben.
Weg genommen wird auch keinem was…ist doch alles ok.
Wie viele andere ist auch dieses reformpädagogische Projekt sehr sympathisch und von Idealismus getragen. Die Abgrenzung gegen die staatlichen Schulen muss natürlich auch sein, um sich profilieren zu können, aber trotzdem überzeugt die Unterstellung, dort würde allein mit “Frontalunterricht” und “Notendruck” gearbeitet, nicht so recht. Auch an einer staatlichen Schule kann guter Unterricht stattfinden – und so ganz blütenweiß ist die Weste der Reformpädagogik zumindest hierzulande nicht.
Komisch. Das gab und gibt es doch alles schon und klappte so wirklich nirgends. Mir fällt Nenas Schulgründung ein. Alles sollte neu und anders sein, vor allem demokratisch. So wirklich demokratisch. Und scheiterte auch kläglich. Kann man bitte mal aufhören mit solchen Illusionen und naiven Ideen an der Realität vorbei?!
Wieso gescheitert? Die Schule existiert nach wie vor: https://www.neue-schule-hamburg.org/
Und offensichtlich läuft sie gut: https://taz.de/Freie-Nena-Schule-etabliert-sich/!5475692/
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Ja und? Es gibt keine frischeren – was nicht darauf hindeutet, dass die Schule gescheitert sei.
Herzliche Grüße
Die Redaktion