BONN. Gute Deutschkenntnisse gelten hierzulande als Schlüssel für Bildungserfolg. Vor allem die Sprachkompetenzen zugewanderter Kinder und Jugendliche stehen seit der jüngsten PISA-Studie im Fokus der Politik. Doch wie lassen sich Schüler*innen dafür begeistern, eine neue Sprache zu lernen? Darüber sprechen im Podcast „Bildung, bitte!“ die Sprachenfans Bennett Iyamu, Englischlehrer und Hamburger Bildungsinfluencer, und Barbara Golini, Russischlehrerin und Mitglied im Bürgerrat Bildung und Lernen, mit Moderator Andreas Bursche. Sie sind sich einig: Fehlermachen ist wichtig und Vokabellernen wird überschätzt.

In dieser Folge des Podcasts „Bildung, bitte!“ spricht Moderator Andreas Bursche mit zwei außergewöhnlichen Gästen: Bennett Iyamu und Barbara Golini. Iyamu ist ein wahrer Sprachenthusiast. Er beherrscht neun Sprachen, darunter Französisch, Niederländisch und Yoruba, das zu den Niger-Kongo-Sprachen gehört. Iyamu unterrichtet Englisch und Sport an seiner alten Schule in Hamburg und ist neben seiner Lehrtätigkeit als Bildungsinfluencer auf TikTok aktiv. Dort erreicht er über 140.000 Follower*innen. Barbara Golini kommt ursprünglich aus Italien, lebt mittlerweile aber in Stuttgart und unterrichtet Französisch, Russisch und Italienisch. Als Mitglied des Bürgerrats Bildung und Lernen der Montag Stiftung Denkwerkstatt engagiert sie sich für innovative Bildungskonzepte.
Motivation ist entscheidend
„Deutschland wird vielfältiger. Bunter, sagen auch einige. Und das ist ja auch häufig für Gesellschaften eine ganz, ganz wundervolle Bereicherung“, leitet Andreas Bursche in das Thema der Podcast-Folge ein. Die Vielfalt bringe aber auch einige Herausforderungen mit sich: Eine zentrale Rolle spiele etwa die Sprache, denn „das Miteinander-ins-Gespräch-Kommen ist so wichtig“, so Bursche und will wissen: Kann jeder Mensch Fremdsprachen lernen? „Ich beantworte die Frage mit einem hundertprozentigen ‚Ja‘“, sagt Bennett Iyamu. Entscheidend sei lediglich die Motivation. „Es ist egal, wie alt du bist, wenn der Wille wirklich da ist, lernt man jede Sprache.“ Das bestätigt auch Barbara Golini. Freude an spanischer Musik könne etwa die Lust auf die Sprache wecken. Viele unterschiedliche Einflüssen könnten den Lernprozess entsprechend anregen.
Moderator Andreas Bursche will diesen Ansatz auf die Schulen übertragen und hakt nach: Wie also können Lehrkräfte Kinder motivieren, die beispielsweise als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind? „Ich bin der Meinung, dass man in dem Fall dem Kind generell auch jüngeren Schülern, erst mal erklären sollte, warum eine Sprache überhaupt einen Mehrwert bietet“, sagt Englischlehrer Iyamu. Auf diese Frage setze er auch in seinem Englischunterricht, um seine Schüler*innen „kognitiv wach zu kriegen“. Gleichzeitig ist es ihm wichtig, ihnen die Angst vor Fehlern zu nehmen. Sie seien normal, wenn man eine neue Sprache lernt. „Fehler sind wirklich die besten Lehrer. Man lernt aus ihnen und wenn man dranbleibt, verbessert man sich.“
„Kultur verbindet, wie auch Sprache verbindet.“
Neben der Motivation ist aus Sicht von Barbara Golini auch die Atmosphäre im Klassenzimmer entscheidend. „Wenn du als Lehrkraft Vertrauen aufbaust und die emotionale Seite einbeziehst, dann wird das Kind oder der Jugendliche Sprache auch nebenbei lernen, ohne sich viele Gedanken zu machen.“ Ein weiterer Faktor laut Iyamu: kulturelles Verständnis. „Selbst, wenn ich die Sprache von einigen Schülern noch nicht kann, kann ich mich ja dennoch mit der Kultur auseinandersetzen. Und das ist so mein Credo.“ Auf diese Weise schaffe er eine Verbindung zu den Schüler*innen, auch ohne eine gemeinsame Sprache. „Kultur verbindet, wie auch Sprache verbindet.“ Im Rahmen seiner Zeit als Lehrer einer Integrierten Vorbereitungsklasse, die vor allem Kinder aus Afghanistan, der Türkei und Syrien besuchten, informierte er sich während des Ramadans beispielsweise zu den damit verbundenen Gebräuchen. „Mit dem kulturellen Hintergrundwissen konnte ich direkt Pluspunkte bei den Schülern sammeln.“
Im Unterricht setzen beide Sprachliebhaber*innen zudem auf spielerische Elemente. Eine Sprache lerne man nicht nur durch das stumpfe Pauken von Vokabeln, sagt Iyamu: „Vokabeln sind richtig und wichtig, ja. Aber damit sollte man nicht anfangen, eine Sprache zu lernen.“ Hilfreicher sei es, häufig verwendete Sätze zu lernen, den Satzaufbau darüber zu erfahren, um dann nach und nach in der Lage zu sein, diese mit neuen Wörtern zu variieren. Ähnlich geht auch Barbara Golini vor. Es gehe darum, sich in der Sprache auszuprobieren. Sie selbst sei nie gut darin gewesen, Vokabeln auswendig zu lernen. Stattdessen setzt sie auf Verbindungen zwischen Wörtern und Situationen, um sich neue Begriffe einzuprägen. Mit Blick auf den Fremdsprachenunterricht in Deutschland kritisiert Golini gerade den Fokus auf das Vokabellernen. Davon abgesehen zeigt sie sich zufrieden: „Generell werden Sprachen gut unterrichtet. Das sieht man am Ergebnis; viele sprechen zum Beispiel sehr gut Englisch oder andere Sprachen wie Französisch.“
Empfehlung des Bürgerrats Bildung und Lernen
Als Englischlehrer kann Bennett Iyamu direkt aus der Praxis berichten; ihm gefällt der Freiraum, den er bei der Gestaltung seines Unterrichts hat: „Vom Curriculum wird uns natürlich vorgegeben, welche Themen wir in welcher Klasse behandeln müssen. Aber, wie ich die Themen an meine Schüler heranbringe, das ist schon mir überlassen. Und das finde ich ganz gut.“ Er nutzt unter anderem Musik, um die Sprache spielerisch und authentisch zu vermitteln. So habe er im Unterricht das Thema „New York“ mit dem Song „Empire State of Mind“ von Jay-Z und Alicia Keys kombiniert. Auch auf Social Media teilt er seine Methoden: „Heutzutage sprechen mich auch Schüler an und sagen zu mir: ‚Ja, wegen Ihnen spreche ich jetzt Niederländisch, Herr Iyamu.‘“
Der Bürgerrat Bildung und Lernen, in dem Barbara Golini aktiv ist, sieht „gute Sprachkenntnisse als Grundlage für die Teilhabe am sozialen Leben und den gesamten Bildungsweg“. Er empfiehlt daher unter anderem „eine Kita-Pflicht in den letzten beiden Jahren vor der Einschulung“, denn im Spiel und durch Interaktion lerne das Kind automatisch und zwanglos Deutsch. Bürgerrätin Golini unterstützt diese Empfehlungen, betont allerdings, dass eine Balance zwischen Muttersprache und Zweitsprache entscheidend sei: „Wenn du deine Muttersprache gut sprichst, kannst du darauf aufbauen. Deswegen ist es wichtig, dass Kinder diese Sprache auch beherrschen.“ Satt die Zweitsprache gegen die Muttersprache auszuspielen, sollten beide zusammen wachsen dürfen. Dies fördere eine nachhaltige Sprachentwicklung. News4teachers
Der Bürgerrat Bildung und Lernen besteht aus mehr als 700 zufällig ausgelosten Teilnehmer*innen aus ganz Deutschland und wurde 2020 von der Montag Stiftung Denkwerkstatt ins Leben gerufen. Sie hat auch den vorliegenden Podcast bereitgestellt.
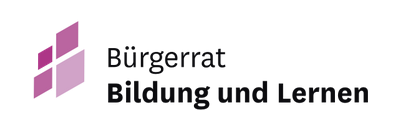
Im Sinne einer lebendigen Demokratie diskutieren die Mitglieder des Bürgerrats gemeinsam über gesellschaftliche und bildungspolitische Fragen. Welche Probleme und Herausforderungen müssen im Bildungsbereich dringend bearbeitet werden? Wie könnten bildungspolitische Reformen aussehen, die Probleme lösen und gleichzeitig in der Gesellschaft mehrheitsfähig sind? Und: Wie soll gerechte Bildung in Zukunft aussehen?
Ein umfassendes Papier mit Empfehlungen wurde unlängst erarbeitet (News4teachers berichtete). Leitthema dabei: „Chancengerechtigkeit: Wie viel Freiheit braucht das Lernen?“
Der Bürgerrat Bildung und Lernen ist aktuell der einzige Bürgerrat, der auf Bundesebene aktiv ist und auch Kinder und Jugendliche einbezieht. Die mehr als 250 Schülerinnen und Schüler kommen über sogenannte Schulwerkstätten der Bundesländer dazu und sind vollwertige Mitglieder des Bürgerrats Bildung Lernen. Darüber hinaus haben sie aber auch eigene Empfehlungen entwickelt sowie einen offenen Brief unter dem Titel „Hört uns zu!“ geschrieben.
Hier geht es zu weiteren Folgen der News4teachers-Podcasts:
Den Podcast finden Sie auch auf


















Ich finde, Kinder mit noch kurzer Migrationsgeschichte sollten den ganzen Tag in die Kita oder Schule gehen, damit sie ihre Muttersprache ordentlich lernen, aber eben auch Deutsch und dann auch noch Englisch. Das alles allerdings ohne Vokabellernen, da das ja gar nichts bringt.
Ach ja, und ämtliches Kita-Personal und alle LK sollten mindestens fünf Sprachen beherrschen.//
Ich hatte immer Probleme mit Fremdsprachen.
Was mir hilft/ geholfen hat:
– vielseitige Vokabelübungen: z.B. Silben zusammensetzen, nach Diktat schreiben, Bilder zuordnen, unter ähnlich ausgesprochenen/ geschriebenen Wörtern das richtige suchen usw.
– Texte gleichzeitig anhören und lesen können, grundsätzlich alles vertont haben
– erst Erklärungen/ Grammatikregeln und dann Übungen, Einsetzen in den Kontext und nicht andersrum (vor B1)
– Übungen mit sofortiger Rückmeldung
Ich war mit Vokabellisten (nur gedruckt/ abgeschrieben) auswendig lernen überfordert. Ich hatte eigentlich kein schlechtes Gedächtnis und ich habe viel geübt.
Genauso mit “Im Englischunterricht 6. Klasse wird nur Englisch gesprochen.” Ich habe oft die Aufgaben gar nicht verstanden. Wörterbücher waren auch nicht erlaubt.
Grammatik aus dem Kontext zu lernen, hat bei mir absolut nicht geklappt.
Sicher ist Kommunikation beim Lernen wichtig. Aber manche Menschen brauchen auch viele sehr gezielte Übungen, eine klare Struktur und lernen eine Sprache nicht so einfach intuitiv. Die Motivation ist sehr schnell weg, wenn man immer der/die Schlechteste ist.
Um durch Musik, Videos, Podcasts ernsthaft sein z.B. Englisch zu verbessern, muss zumindest ich schon ziemlich viel verstehen können. Sonst haben die Wörter nicht mehr Bedeutung als willkürliche Laute.
Außerdem kenne ich absolut niemanden ab Klasse 5, der nicht weiß wozu man Sprachen braucht.
Ich finde es immer komisch, dass es ausgerechnet im Lehrerberuf so viele gibt, die der Meinung sind, dass sie die einzigen seien, die verstanden haben, wie Unterricht sein muss und wie Kinder lernen. „Eine Krähe hakt einer anderen kein Auge aus“ gilt im Lehrerberuf leider häufig nicht, hier wird sich häufig um jeden Preis profiliert, auf auf Kosten der anderen und häufig mit wenig Innovativen und Ideen.
Was die oder der Kollege hier vorschlagen, machen doch vermutlich locker die Hälfte aller Englischkollegen, nur das diese offenbar ihre Leistungen etwas besser einschätzen können und nicht der Meinung sind, dass sie den Schlüssel zum Erfolg gefunden haben.
Ich weiß nicht, aber das fällt mir im Lehrerberuf einfach sehr häufig auf, Lehrer, Schulleitungen und ganze Schulen verkaufen hier oft Dinge, die vollkommen normal sind, als ihre eigene Leistung, auf die sie selbst gekommen sind. Dieses doch häufig realitätsferne Handeln und Denken sorgt natürlich auch dafür, dass der Beruf nicht das ansehen hat, was er haben sollte, weil dadurch andere Kollegen schlecht gemacht werden. Diese Kollegen sind es auch häufig, die gerne mal mit Schülern über andere Kollegen lästern, weil sie ja als einzige die Schüler verstehen.
Ich weiß nicht, ob das nicht auch schon eine Form von zu starkem Narzissmus ist, im Grunde weiß jeder der Lehrer, dass man mit diesem Schulsystem weniger erreichen kann, als man nach der Ausbildung vor hatte (unterbewusst schlechtes Selbstbewusstsein). Wenn man sich jetzt vor Kollegen, Schulleitung, Wissenschaftlern und am Besten noch der Öffentlichkeit als der tolle Typ darstellen kann, bekommt man damit die Bewunderung endlich. Typische Merkmale sehe ich auf jeden Fall als vorhanden an. Interessant wäre in so Fällen das Privatleben zu beobachten.
Breaking News: Man hat nur vier bis fünf Schulstunden die Woche für den Fremdsprachenerwerb.
Interessant, ja, ich habe diese Beobachtung auch gemacht. Wenn die Schüler sich mit mir über Kollegen und deren Unterricht austauschen wollten, dann habe ich NEIN gesagt. Das mache ich nicht, also….andere ( nicht alle) Kollegen machen das, wahrscheinlich um ihre Ego zu stärken. Aus Fehlern lernen …..völlig richtig, machen wir doch auch. Aber in Deutschland ( wie es in anderen Ländern ist, weiß ich nicht) nicht möglich: werden Fehler/ Fehlentscheidungen gemacht wird der ” Schuldige” gesucht, anstatt nach Lösungen zu suchen. Lehrer sind nicht kritikfähig, sie bilden sogar schnell eine Gemeinschaft, wenn diese Kritik von außen kommt, oder von Schülern. Viele Eltern sagen, bloß nichts gegen Schule / Lehrer sagen , “die” rächen sich an den Kindern, haben also Nachteile. Die Schulämter unterstützen das ganze. Schade, Privatschulen sind da auch nicht besser, vielleicht in der Theorie. Privatschulen haben den Vorteil, sich von Problemkindern / Eltern zu trennen, in dem sie den Vertrag kündigen. Ich gehe gedanklich weg von der Schule, …..was machen die Medien ?…sie profitieren ja von Fehlern anderer und berichten, um höhere Einschaltquoten zu erreichen/ mehr zu verkaufen. Und dies wird von den Bürgern angenommen, lenkt ja von einem selbst ab. ….ist ja auch der Grund, warum Menschen lästern, fördert ja sogar die Gruppenbildung. ….Fazit : Wir sind weit davon entfernt aus Fehlern ( gesellschaftlich) zu lernen, uns fehlen die ” Vorbilder ” , im Gegenteil, die Kinder machen genau die gegenteilige Erfahrung.
Ab wann wird denn Vokabellernen zum Pauken?
Das wird mit dem allgemeinen Maßstab gemessen, dem heute alles im “Bildungs”system untergeordnet wird: Kindliche Emotionen.
Daher wird Vokabeln “lernen” zum bösen “Pauken”, wenn Kinder/Jugendliche das halt fühli-fühlen.
Eigentlich frage ich mich, ob da nicht tatsächlich Gefühlsmaßstäbe einiger „Erwachsener“ angelegt werden.
Das auch, ja – legetimiert durch die Behauptung, für Kinder sei dieses oder jenes so.
Als ich im zweiten Halbjahr der 9. Klasse vor einer möglichen 5 in Englisch stand und mir dasselbe in Mathe drohte, die Versetzung also gefährdet war, überlegte ich endlich mal, was ich dagegen tun könnte. Am einfachsten schien mir, fleißig Vokabeln zu lernen und meinen mickrigen Schatz an Wörtern und Redewendungen zu erweitern. Das habe ich dann auch gewissenhaft getan und meine Englischlehrerin immer wieder in Erstaunen versetzt.
Von einer äußerst knappen 4 im Halbjahrszeugnis kam ich noch auf eine gute 3 und die Versetzung war gerettet. Im Abi hatte ich dann sogar eine 2, weil ich aus meinem Fehler gelernt hatte. Mir erzähle also keiner, dass Vokabellernen und sonstiges Üben überschätzt würde. Im Gegenteil, heutzutage wird es oft unterschätzt.
Wenn es heißt “Motivation ist entscheidend” dann möchte ich auch mal eine Lanze brechen für die Motivation “Druck”. Wenn ich nicht Angst gehabt hätte vorm Sitzenbleiben, hätte ich nie gelernt, mich an den Riemen zu reißen und Selbstdisziplin zu üben. Diese Erkenntnis und der wachsende Lernerfolg waren eine nachhaltige Motivation.
Allerdings waren zu meiner Zeit noch Halbtagsschulen die Regel. Ich weiß nicht, ob ich auf einer Ganztagsschule abends noch die Energie zum eigenen Lernen gehabt hätte. Ich bezweifle das eher.
Man kann ein sog. “Lernband” installieren, so dass in der Schule gelernt werden kann.
Man kann sich als Schüler auch auf den Hosenboden setzen und Vokabeln lernen. Wie feli es schrieb, ging mir übrigens auch, in Russisch und Englisch.
Ganz ohne Lernband
? Das geht prima während der Lernbandzeit im Ganztag.
Lernband bedeutet, dass es eine Stunde pro Schultag zum Üben gibt, damit man nicht zuhause noch spät am Nachmitrag/frühen Abend unbedingt etwas tun muss.
@Feli machte sich Gedanken darüber, wie man trotz Ganztag üben kann.
Ich gebe Ihnen Recht. Mir sind Fremdsprachen schwer gefallen, die Naturwissenschaften lagen mir besser. Aber ich wollte ein sehr gutes Abi machen….also: habe ich – unter Druck, den ich mir selbst gemacht habe- fleißig gelernt. Ich kann heute noch kein Englisch, weil ich es beruflich nicht gebraucht habe. Heute sehe ich es jedoch anders. Die Kinder sollten schon eine Fremdsprache beherrschen, denn das Leben ist ” globaler” geworden, ob beruflich oder privat. Ob die Schule das leisten kann, nein, da werden nur die Grundlagen gelegt. Und nicht jeder kann sein Kind für ein Schuljahr nach England oder in die USA schicken….würde ich zum Beispiel schon gar nicht wollen, das hat aber andere Gründe.