WIESBADEN. Der Plan von Rheinland-Pfalz’ Bildungsminister Sven Teuber (SPD), die Prüfungskultur an Schulen grundlegend zu verändern, sorgt im Nachbarland Hessen für deutliche Ablehnung. Während Teuber auf weniger Klausuren, alternative Prüfungsformate und eine KI-gestützte Auswertung von Schülerleistungen setzt, pocht das CDU-geführte Kultusministerium in Wiesbaden auf bewährte Formen – auch unangekündigte Tests sollen bleiben.

„Gerade im Zeitalter von immer mehr KI-Anwendungen kommt authentischen Leistungsnachweisen eine wachsende Bedeutung zu – auch mit Blick auf die Studierfähigkeit und die Vorbereitung auf selbstständiges Arbeiten im späteren Bildungsweg“, erklärte ein Sprecher des Kultusministeriums in Wiesbaden auf Anfrage. Festgelegte Klausurtermine dienten den Schülerinnen und Schülern zur Orientierung und vermittelten ein Gefühl von Verlässlichkeit. „Auch das fördert die jeweiligen Bildungschancen.“
Unangekündigte Tests prüften nach Auffassung des Ministeriums nachhaltig erworbenes Wissen und verhinderten kurzfristiges Auswendiglernen. „Sie helfen ebenfalls, ein kontinuierliches Lernen zu fördern.“ Aus Hessens Sicht sind „einheitliche Prüfungsformate notwendig, um faire und vergleichbare Leistungsbewertungen zu ermöglichen“. Diese bereiteten zugleich auf zukünftige Anforderungen in Studium und Beruf vor, „wo ebenfalls Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt abgerufen werden muss“. Individuelle Lernwege seien zwar wichtig – bei der Bewertung müsse jedoch ein gemeinsamer Maßstab gelten.
Teuber: Weniger Druck, mehr individuelle Entwicklung
Der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber hatte sich unlängst für eine veränderte Test- und Prüfungskultur ausgesprochen (News4teachers berichtete). Leistungskontrollen sollten sich stärker nach dem individuellen Tempo der Schüler richten: „Ich kann mir auch vorstellen, dass sich Kinder und Jugendliche erst dann zu einer Prüfung melden, wenn sie meinen, den Stoff verstanden zu haben.“ Von unangekündigten Abfragen halte er nichts.
Ziel sei es, den Fokus auf die individuelle Entwicklung zu legen – und diese datengestützt zu begleiten. Für die Grundschulklassen in Rheinland-Pfalz gebe es bereits Verfahren, mit denen erhoben werden könne, wo die Kompetenzen der Klasse und jedes einzelnen Schülers lägen und wie die Entwicklung sei. „Dies ermögliche auch Lehrkräften ein Feedback, worauf sie bei wem noch einmal genau achten sollten“, sagte Teuber. Eine KI könne diese Daten auswerten.
Kern seiner Idee: eine Schüler-ID, die eine kompetenzorientierte Darstellung der Entwicklung von Bildungsbiografien ermögliche. „Es ist eigentlich wie ein digitaler Schülerausweis mit Speicherplatz.“ Lehrkräfte, Eltern und Schüler könnten so gemeinsam nachvollziehen, wie sich ein Schüler entwickelt habe, wo er stagniere und wie Defizite ausgeglichen werden könnten. „Da habe ich doch einen viel größeren Mehrwert, als wenn ich sechs oder sieben Klausuren geschrieben habe, die alle von unterschiedlichen Lehrerinnen und Lehrern sind, aber nie nachhaltig werden.“
Alternative Prüfungsformate statt Klausuren-Flut
Teuber betont, dass es nicht um weniger Leistung, sondern um andere Prüfungsformen gehe. „Es müssen nicht alle zur selben Zeit dasselbe machen, sondern wir haben unterschiedliche Entwicklungsfelder für jeden Schüler und jede Schülerin.“ Dazu könnten auch Gespräche, Präsentationen oder kreative Beiträge anstelle von Klausuren gehören. „Das schafft Resilienz, das schafft Stärke und Lust darauf, Lernen als etwas Positives zu erzeugen.“
Auch an den Noten will Teuber festhalten: „Wir wollen alle Noten und wir wollen im Endeffekt gute Noten erreichen.“ Eine Note sei aber vor allem „eine Aussage über die Entwicklung von Kindern“. Wichtig sei, den Kindern diese Entwicklung auch zu ermöglichen. Das bedeute, dass Leistungsnachweise nicht für alle gleichzeitig erbracht werden müssten, sondern zu individuell passenden Zeitpunkten. Entscheidend sei dann das Feedback: „Warum ist das hier eine 1, eine 3 und warum ist das hier mangelhaft? Was musst du und was solltest du weiter lernen und kompetenzorientiert erarbeiten? Das ist das Entscheidende.“
Curricula müssten immer wieder überprüft und erneuert werden. „Die Schüler brauchen Zeit für Entwicklung, Zeit für Bildung“, so Teuber. Seine Überlegungen basierten auf einem gemeinsam mit Bertelsmann und anderen erarbeiteten Papier zu einer neuen Lern- und Prüfungskultur. Im September will er sich zudem in Kanada über datengestützte Schulentwicklung informieren.
GEW: Gute Ansätze, aber schwierige Umsetzung
Unterstützung bekommt Teuber von der Bildungsgewerkschaft GEW. „Es ist pädagogisch sinnvoll, die Zahl formaler Leistungstests in der Grundschule und in den Klassen der Sekundarstufe I deutlich zu reduzieren“, sagte die rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Christiane Herz. Die Grundschulordnung ermögliche schon seit mehr als 20 Jahren, bis zur Hälfte der gruppenbezogenen Leistungsnachweise durch andere zu ersetzen – nur wenige Schulen nutzten diese Möglichkeit.
Herz sieht jedoch auch ein gravierendes Problem: „An unseren Schulen ist aktuell nur dann eine annähernd 100-prozentige Unterrichtsversorgung gegeben, wenn alle Kolleginnen und Kollegen sich im Haus befinden.“ Es gebe keine Vertretungsreserven für Krankheitsfälle und den Besuch von Fortbildungen. „So ergibt sich jeden Tag ein Vertretungsbedarf zwischen fünf und 20 Prozent, der nur kompensiert werden kann, wenn die an der Schule bestehenden pädagogischen Konzepte aufgelöst werden.“
Ihr Fazit: „Wenn flächendeckend eine veränderte Lernkultur erreicht werden soll, müssen die Bedingungen an den Schulen, aber auch schon an den Kitas grundlegend verbessert werden.“ News4teachers / mit Material der dpa



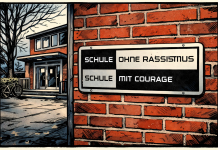






Oh, schönes Bild. Der blutrünstige Exer – seit Jahrzehnten gefürchtet in Klassenzimmern – saugt mit Multiple-Choice-Fängen das letzte bisschen Motivation aus den Schülern. Doch siehe da: Der Reformator tritt ein, das Kreuz der Kompetenzorientierung erhoben, murmelt er die heiligen Worte: „Individualisierung! Entschlackung! Lernfreude!“ – und der Exer beginnt zu zittern.
„Gerade im Zeitalter von immer mehr KI-Anwendungen kommt authentischen Leistungsnachweisen eine wachsende Bedeutung zu“
Das klingt, als hätte dies ein renitenter Oldschool-Lehrer(wie ich) mit Kreide unter den Fingernägeln und einem leisen Lächeln im Gesicht verfasst. Und die Aussage trifft ins Schwarze. Denn während ChatGPT, Grammarly und Konsorten fleißig Hausarbeiten aufpolieren, Referate schreiben und sogar Gedichte dichten, wird die gute alte unangekündigte Leistungskontrolle zum letzten Zufluchtsort echter Denkleistung (AI). Doch was tun das pädagogische Wolkenkuckucksheim und der bildungspolitische Elfenbeinturm? Sie reagieren mit dem Reflex der Zeit: Verständnis. Statt Wissen abzufragen, wird nun „Kompetenzorientierung“ betrieben. Prüfungen sollen vor allem „stressfrei“ und „lernförderlich“ und sein. Am besten mit Bastelanteil, Gruppenfeedback und einem Reflexionsbogen, in dem man sich selbst eine Eins geben darf, weil man sich „bemüht“ hat. Gerade bei unangekündigten Tests, müssen Schülern zeigen, dass echtes Können nichts mit Copy-Paste zu tun hat. Dass Wissen nicht nur gegoogelt, sondern verstanden werden muss. Dass man sich auf einen unangekündigten Mathe-oder Chemietest nicht mit einem Moodboard vorbereitet, sondern mit Übungsaufgaben, Anstrengung und Konzentration.
Also lasst die unangekündigte Leistungskontrolle auferstehen. Sie ist das letzte gallische Dorf im pädagogischen Rom der Wohlfühlformate. Und sie beweist: Nicht alles, was überraschend kommt, muss schlecht sein. Manchmal ist es einfach nur… echt.
Und nun treibt mir den Teufel aus, ihr exorzierenden Wahnsinnigen, Zufälligen und Illuminatoren.
Auf welche Studie beziehen sich die Verantwortlichen in Hessen? Wenn Sie das jetzt nicht auswendig wissen, sollten sie vielleicht ihren Hut nehmen 😉
“Unangekündigte Tests prüften nach Auffassung des Ministeriums nachhaltig erworbenes Wissen und verhinderten kurzfristiges Auswendiglernen. „Sie helfen ebenfalls, ein kontinuierliches Lernen zu fördern.“”
WOW! Wir können also sehen, was Kinder individuell mitbringen und was sie als Nächstes lernen sollten – und ob die Schule/ Schulpolitik dies bereitstellt oder versagt? Kommt bestimmt! 😀
Die Wahl des Titelbildes ist bemerkenswert: Eine Horror-Comic-Ästhetik, die einen bildungspolitischen Meinungsaustausch als dramatischen Kampf zwischen Gut und Böse inszeniert.
Wer ist hier der “Vampir”? Hessen oder Teuber?
Hessen, da es einen “veralteten Bildungsansatz” vertritt, der aus Schülern “Leistung heraussaugt”? Oder Teuber, der in Gestalt des personifizierten Bösen auftritt, und vom Katechon – dem Kultusministerium in Hessen – aufgehalten werden muss?
Solche Visualisierungen tragen wenig zu einer sachlichen Debatte bei und lassen vermuten, dass bereits vor der inhaltlichen Auseinandersetzung eine bestimmte Position bevorzugt wird. Jedenfalls ist es der Redaktion gelungen, den Artikel über Teuber relativ wenig verändert ein zweites Mal unterzubringen.
Bemerkenswert ist auch, wie unkritisch Teubers Reformpläne präsentiert werden, während Hessens evidenzbasierte Einwände als rückständig geframt werden. Eine ausgewogene Bildungsberichterstattung würde beide Positionen an wissenschaftlichen Standards messen, statt eine als progressiv zu glorifizieren.
Eine detaillierte Analyse der neurowissenschaftlichen und pädagogischen Probleme von Teubers Ansatz findet sich bereits in meinem Kommentar zu dem Bericht über die Pläne von Herrn Teuber:
https://www.news4teachers.de/2025/08/weniger-klausuren-mehr-kompetenz-bundesland-will-schule-neu-denken/#comment-713446
“Solche Visualisierungen tragen wenig zu einer sachlichen Debatte bei und lassen vermuten, dass bereits vor der inhaltlichen Auseinandersetzung eine bestimmte Position bevorzugt wird.”
Solche Visualisierungen ironisieren das Geschehen – nennt man Karikatur. “Cartoons und Karikaturen gehören zum Journalismus, seit seinen Anfängen.” Gerne hier nachlesen: https://www.dfjv.de/publikationen/fachjournalist/karikaturen-gezeichneter-journalismus-in-zeiten-von-prinkrise-social-media-und-kontroversen
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Sehr geehrte Redaktion,
vielen Dank für die schnelle Antwort und den Link zum DFJV.
Karikaturen gehören selbstverständlich zum journalistischen Genre – bei dem von Ihnen gewählten Bild handelt es sich allerdings um eine bildliche Metapher.
Ihr Bild verwendet eine generische Schablone (“Gut gegen Böse”), um die Diskussion zu polarisieren. Dem selbst formulierten Anspruch, die Ereignisse zu “ironisieren”, wird es damit nicht gerecht.
Mit freundlichen Grüßen
Das sehen wir naturgemäß anders. Herzliche Grüße Die Redaktion
Verständlich 🙂
Wieso macht man bei den olympischen Spielen nicht unterschiedliche Formate? Ist doch total gemein, wenn einer für die 100m länger braucht. Wievtraurig die dann immer sind. Es könnte doch ein Läufer 120 m laufen und einer 80 m. Oder es könnten doch alle Läufer 10 Sekunden lang laufen und dann bewerten wir noch das Lächeln und die Eleganz beim Start aus dem Startblock. Oder die langsamen Läufer dürfen zusätzlich noch Weitsprung oder Sperrwurf machen um doch noch Punkte zu sammeln. Oder vielleicht ein Mandala ausmalen und der Videoschiedsrichter bewertet die Stifthaltung.
Und warum sollten die alle zum gleichen Zeitpunkt zum Wettkampf antreten?
Würde doch reichen, wenn jeder dann die 100m läuft, wenn er oder sie sich dazu bereit fühlt.
Die Goldmedaille bekäme man dann natürlich auch nicht für die schnellste Zeit im Wettkampf, sondern für die größte Zeitverbesserung im Vergleich zum Vorkampf.
Wichtig ist, dass am Ende jeder Gold erhält.
Genauso wie heute wichtig ist, das jeder versetzt wird und jeder den Abschluss bekommt.
Nein, nein, “wichtig ist, was hinten ‘raus kommt”.
(Nun stelle man sich einen stoff-und energiewechselnden Menschen vor. Der Gestank…)