MAINZ. Immer mehr Schulen schließen sich der Initiative „Schulen der Zukunft“ des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums an, die sich zur größten reformpädagogischen Bewegung im staatlichen Bildungssystem Deutschlands mausert – der Widerstand aus Reihen der Philologen dagegen wird zunehmend wütender. Der Verband der Gymnasiallehrer hat sich nun sogar eine eigene Marke eintragen und mit Copyright-Hinweis versehen lassen: „Schule jetzt!®“

Es sind zwei Bilder, die kaum gegensätzlicher sein könnten. In der Mainzer Pyramide drängen sich Anfang November rund 700 Menschen – Lehrkräfte, Schulleitungen, Schulaufsicht, Bildungsexpertinnen und -experten. Beim Forum „Update Bildung – Ideen, die Schule machen“ präsentieren sie offene Lernlabore, Edu-Talks, World Cafés, diskutieren über neue Prüfungsformate, Lernräume und datengestützte Schulentwicklung. Mittendrin Bildungsminister Sven Teuber, der den 53 neu aufgenommenen „Schulen der Zukunft“ attestiert, sie hätten den Mut, „im Sinne der Kinder von heute die Schule von morgen zu gestalten“.
Nur wenige Tage später trifft sich der Philologenverband im Landhotel Stromberg. Vor knapp zweihundert Gymnasiallehrkräften, Ausbildungsleitenden und Funktionären wird dort ein anderes Label prominent eingeführt: „Schule jetzt!“® – gedacht als „konstruktive Antwort“ auf die Kampagne der Landesregierung. Auch Bildungsminister Teuber sitzt im Publikum, als der Verband sein Gegenmodell zur „Schule der Zukunft“ präsentiert und mit scharfer Kritik am Reformkurs der SPD-Bildungspolitik verbindet.
Der Hintergrund: Rheinland-Pfalz erlebt gerade eine vom Bildungsministerium vorangetriebene pädagogische Reformbewegung, die sich rasch ausweitet. „Schule der Zukunft“ heißt die Initiative, mit der inzwischen 150 Schulen aller Schularten experimentieren, vernetzen und Unterricht neu denken. Während Teuber das Programm zum Herzstück einer gerechteren, kindgerechteren Schule ausbaut, formiert sich der Widerstand: Der Philologenverband Rheinland-Pfalz spricht von „radikalen Experimenten“, fühlt sich diffamiert als Betreiber einer „Schule von gestern“ – und hat als Gegenentwurf die eigene Marke eintragen lassen. Was inhaltlich mit „Schule jetzt!®“ gemeint ist, bleibt allerdings vage.
Was als Beteiligungsprojekt begann, ist heute ein Reformnetzwerk
Formal startete die Geschichte von „Schule der Zukunft“ im Herbst 2021 – noch unter Teubers Vorgängerin Stefanie Hubig (SPD). Inhaltlich beschrieb sie die „Schule der Zukunft“ als Abkehr von einem starren, industriepädagogischen Modell hin zu flexibleren, stärker individualisierten Lernformen. „Die Schullandschaft in Deutschland zeigt noch viel 20. Jahrhundert, aber nicht unbedingt die Schule, wie sie 2030 oder 2050 gebraucht wird“, sagte sie. Die Leitfrage lautete: „Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten brauchen Schülerinnen und Schüler im 21. Jahrhundert?“ Es gehe heute eben nicht nur um Fachwissen, sondern auch um „Kreativität, kritisches Denken, Zusammenarbeit oder Kommunikationsfähigkeit“.
Konkret formulierte Hubig schon damals eine ganze Reihe von Reformlinien: Digitalisierung nicht mehr als reines Ausstattungsprogramm, sondern als Mittel zur individuellen Förderung – mit adaptiven Lernprogrammen, Blended Learning, virtuellen Lernorten. Eine Flexibilisierung der Lehr- und Lernzeiten, „von den Stundentafeln ein Stück weit abzurücken“. „Stundenplan und Noten sind kein Selbstzweck“, so die Ministerin (die mittlerweile als Justizministerin ins Bundeskabinett gewechselt ist). „Den Bildungsstandards bleiben wir verpflichtet, aber in ihrem Rahmen soll es mehr Freiheiten für neue Lernprozesse geben. Wir erkunden gezielt Wege zum selbstbestimmten Lernen.“ Dazu könne auch eine Auflösung der klassischen Stundenpläne gehören und ihre Weiterentwicklung zu Arbeitsfenstern. „Die Lehrkräfte stehen dann vielleicht nicht mehr vor einer Klasse, sondern den Schülerinnen und Schülern in verschiedenen Räumen zu unterschiedlichen Fragen mit ihren jeweiligen Kompetenzen zur Seite.“
Offenkundig stand dabei die Alemannenschule im baden-württembergischen Wutöschingen Pate – eine Lernlandschaft-Schule, Preisträgerin des Deutschen Schulpreises 2019, die bundesweit als Vorzeige-Reformprojekt gilt. Rheinland-Pfalz wollte den Schulen einen ähnlichen Weg eröffnen: Bis zu 100 Pilotschulen sollten sich für den „Zukunftsfonds Schule“ bewerben können, mit zusätzlicher Unterstützung für bauliche Veränderungen, Lernraumkonzepte und neue Formen des Unterrichts.
Schon 2021: Der Philologenverband fühlt sich übergangen und karikiert
Diese Weichenstellungen brachten damals den Philologenverband auf die Palme. Landesvorsitzende Cornelia Schwartz kritisierte nicht nur Inhalte, sondern auch Stil und Verfahren. Während das Ministerium mit Eltern- und Schülervertretungen „breite Beteiligung“ organisierte, fühlten sich die Gymnasiallehrervertreter übergangen. Eltern- und Schülerschaft würden „zuvor ins Boot geholt“, so der Verband, „dann geht man mit den Ergebnissen an die Presse und erwartet, dass die Lehrkräfte hinterher alles abnicken, damit man verkünden kann, man habe die ‚gesamte Schulgemeinschaft … eingebunden‘“.
Vor allem aber wehrte sich Schwartz gegen das Bild einer angeblich veralteten, lehrerzentrierten Paukschule, das im Umfeld der Zukunftsinitiative gezeichnet wurde. „Eine solche Aussage ist ein Schlag ins Gesicht jeder Lehrkraft“, sagte sie mit Blick auf Hubigs Hinweis, es gehe nun um Kreativität, kritisches Denken und Zusammenarbeit. Die Bildungsministerin tue „gerade so, als wäre das etwas ganz Neues und als hätten wir noch nie Kreativität, kritisches Denken, Zusammenarbeit oder Kommunikationsfähigkeit gefördert!“ Das Ministerium wäre gut beraten, „sich einfach einmal in ganz gewöhnlichen Schulen im Land umzuschauen“, um zu sehen, dass Unterricht eben nicht dem „sehr engen und karikaturenhaften Bild von Schule entspricht“, das die Kampagne suggeriere.
Ganz konkret wendeten sich die Philologen gegen jene Reformmodelle, in denen Klassenzimmer durch Lernlandschaften ersetzt und Lehrkräfte primär zu „Lernbegleiterinnen und -begleitern“ umdefiniert werden. Wutöschingen als Vorbild zu nehmen, bedeute, „dass demnächst Klassenzimmer zunehmend durch Lernlandschaften ersetzt werden, Lehrkräfte zu Lernbegleiterinnen und -begleitern werden und Kinder sich weithin nur noch mit den Fächern und Themen beschäftigen, auf die sie gerade Lust haben“. Dass Lehrkräfte Kinder auch für ein Fach begeistern können, werde in diesem Bild ausgeblendet – ebenso der Wert des gemeinsamen Lernens „im geschützten Raum des Klassenzimmers“.
Schwartz warnte bereits 2021 vor nicht reversiblen Experimenten. Wenn man nach einigen Jahren bemerke, „dass ein derartiges Schulmodell vielleicht doch nicht das Richtige war für jeden Schüler und jede Schülerin oder jedes Themengebiet, lässt sich diese totale Umwälzung nur mit großer Mühe wieder rückgängig machen“. Die Kinder, die bei diesem Versuch scheiterten, „haben dann verloren“. Sinnvolle Schulentwicklung bestehe aus Sicht des Verbands eher in kleineren Klassen, besseren Rahmenbedingungen und gezielten Verbesserungen im Schulalltag – nicht in groß angelegten Struktur- und Raumexperimenten.
„Wir wollen Schule nicht neu erfinden, sondern sie mit Augenmaß weiterdenken, so wie das auch bisher schon Kolleginnen und Kollegen getan haben“
Die programmatische Antwort des Verbandes ist „Schule jetzt!®“ – als Weiterentwicklung der Schule „als Ort lebendigen Lernens mit klaren Strukturen, persönlicher Verantwortung und gelebter Beziehungskultur“. „Wir wollen Schule nicht neu erfinden, sondern sie mit Augenmaß weiterdenken, so wie das auch bisher schon Kolleginnen und Kollegen getan haben“, erklärt Schwartz. „Wir wollen bewahren, was gut ist, und nur das verändern, was nicht lernförderlich ist.“ Was genau zu bewahren und was nicht lernförderlich ist? Das bleibt dabei allerdings offen. Allenfalls schlagwortartig ist zu hören: Klarer Unterricht statt diffusen Lernlandschaften, feste Strukturen statt experimenteller Lernsettings, echte Beziehung statt Bildschirmdidaktik.
Unterdessen ist aus Hubigs Zukunftskongress ein weit verzweigtes Netzwerk geworden. Unter ihrem Nachfolger Sven Teuber, einem früheren Gymnasiallehrer, der seit Hubigs Abgang nach Berlin das Bildungsministerium führt, hat „Schule der Zukunft“ nochmal an Tempo zugelegt – und an symbolischer Bedeutung. Der SPD-Politiker nutzt die Initiative, um einen Kurswechsel in der Leistungs- und Prüfungskultur sichtbar zu machen. In einem Streitgespräch mit dem Bildungsforscher Klaus Zierer in der „Zeit“ erklärte er im Sommer: Gerade in den Klassen eins bis acht „braucht es nicht dauernd Tests und Klassenarbeiten“. Statt unangekündigte Spontantests zu schreiben, sollten Lehrkräfte mehr Zeit für „Feedbackgespräche“ und „Persönlichkeitsentwicklung“ haben.
„Benotete Spontantests setzen Schüler unnötig unter Druck. Die Lernforschung weiß seit vielen Jahren, dass Druck und Angst das Lernen erschweren“, sagte Teuber. Exen bereiteten „mit Sicherheit nicht auf den beruflichen Alltag vor“, in dem viele Aufgaben im Team erledigt würden. Kinder seien „neugierig von Geburt an, aber leider unternehmen wir einiges, um ihnen die Freude am Lernen auszutreiben“. Seine Alternative: Prüfungen, zu denen Schülerinnen und Schüler sich anmelden können, wenn sie selbst meinen, den Stoff verstanden zu haben.
Die Initiative „Schule der Zukunft“ dient dabei als Labor – und als politisches Schaufenster. Rheinland-Pfalz gebe seit 2021 den beteiligten Lehrerkollegien größere Freiräume bei der Unterrichtsgestaltung und der Bewertung der Kinder und Jugendlichen, erklärte der Minister. Man müsse „die Schule so verändern, dass es den Schülerinnen und Schülern an diesem Ort besser geht“. Die klassische Leistungslaufbahn mit dicht getakteten Tests und Noten von Klasse 1 an stellt Teuber damit offen in Frage. Noten bleiben für ihn zwar das „gesellschaftlich anerkannte Vergleichsinstrument“, aber: „Was wir aber viel weniger brauchen, sind Noten als Einzelbewertungen über die gesamte Schullaufbahn hinweg, insbesondere in den Klassen eins bis acht.“
Die Reformpädagogik ist damit nicht mehr nur ein Nischenphänomen, sondern in der Mitte des staatlichen Schulsystems angekommen
Genau diese Linie – weniger Druck, mehr individuelle Förderung, mehr pädagogische Freiheit – spiegelt sich in vielen Projekten der „Schulen der Zukunft“: neue Lern- und Prüfungsformate, datengestützte Schulentwicklung, bessere Lernklimata, mehr Beteiligung. Und sie kulminiert an jenem Novembertag in Mainz, an dem Teuber vor Hunderten von Pädagoginnen und Pädagogen die nächste Welle einläutet: 53 weitere Schulen erhalten die Plakette „Schule der Zukunft“.
Dass die Initiative längst mehr als nur ein PR-Projekt ist, belegen die Zahlen. Mit den neuen Mitgliedern wächst das Netzwerk auf stattliche 150 Standorte – quer durch alle Regionen und Schularten, von Altenahr bis Rheinzabern, von der Grundschule bis zur Berufsbildenden Schule. Die Reformpädagogik ist damit nicht mehr nur ein Nischenphänomen, sondern in der Mitte des staatlichen Schulsystems angekommen. Teuber nennt das eine „große Innovationswerkstatt“, in der Ideen „aus der Praxis, mit der Praxis, für die Praxis“ geboren, bearbeitet und verbreitet werden. In Teilen allerdings auch, das ist zu konstatieren – gegen die Praxis. News4teachers







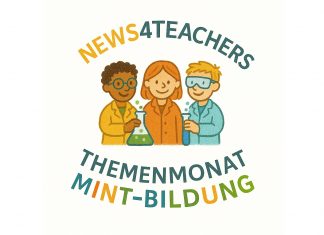


„ Wütende Philologen versuchen zu bremsen“
Wer Kritik übt, ist jetzt also per se „wütend“, am besten noch assoziiert mit dem „Wutbürger“?
„Eine solche Aussage ist ein Schlag ins Gesicht jeder Lehrkraft“ – wenn das nicht wütend klingt…
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Gehören auch Brennpunktschulen zu den Reformschulen? Und falls ja, funktioniert es gut und auf welche Weise?
Würde das neue Konzept in besonders von Gewalt und Hilflosigkeit betroffenen Schulen Anwendung finden können und falls nein, führt diese Reformpädagogik nicht zu Schulen, die eine besonders schwierige Klientel aussen vor lassen muss? Wie ist Reformpädagogik mit dem bisherigen Lehrkräftemangel in allen Schulen, auch im Brennpunkt, machbar?
Eine etwas umständliche Art zu fragen, ob es da erste Ergebnisse gibt, die sich ggf. auf Brennpunktschulen beziehen lassen.
Aber ernüchternd, dass bei “Schule jetzt!” offenbar keine Ergebnisse erwartet werden, nach denen neugierig gefragt wird.
Vielleicht ist “Schule der Zukunft” am Ende doch ein vielversprechenderes Vorhaben, bestehende Probleme zu kösen…
Ich denke, da sind erheblich größere Schnittmengen, als in der öffentlichen Wahrnehmung gezeichnet werden…
Schade, wenn das der Grund seien sollte, wenn zwei Gruppen nicht die gemeinsame Probleme zusammen anzugehen glauben.
Aber vielleicht kennen ja auch alle schon die Lösung und finden erst jetzt, diese für andere sichtbar aufzulösen :/