DORTMUND. Raus aus dem Klassenzimmer, hinein ins echte Leben: Im Projekt „Lernen neu denken“ erkunden die Kinder aus sechs Dortmunder Grundschulen jede Woche einen außerschulischen Lernort. Während die eine Hälfte ihren Schulvormittag etwa im Wald oder auf dem Bauernhof verbringt, erhält die andere Hälfte individuelle fachliche Förderung. Im Interview mit News4teachers erklärt Alma Tamborini, Schulleiterin der Nordmarkt Grundschule und Mitinitiatorin des Projekts, warum die Erfahrungen außerhalb der Schule so wertvoll für die Kinder sind und wie die Umsetzung trotz Lehrkräftemangels gelingt.

News4teachers: Sie haben das Projekt „Lernen neu denken“ mitbegründet. Wieso legen Sie so viel Wert auf Lernerfahrungen an außerschulischen Lernorten?
Alma Tamborini: Das Projekt entstand mitten in der Corona-Pandemie. Die Nachhilfeinstitute überboten sich nach den ersten Schulschließungen mit Programmen, um Kinder zu unterstützen, Lernstoff nachzuholen. Ebenso kursierten unzählige Arbeitsblätter, um Kinder beim „Aufholen“ zu unterstützen. Meiner Kollegin von der Libellen-Grundschule und mir war jedoch schnell klar: Das ist nicht das, was unsere Schülerinnen und Schüler wirklich brauchen. Sie hatten nicht nur Unterrichtsstoff verpasst, sondern vor allem Lebenserfahrungen. Deshalb mussten wir andere Wege finden, um ihnen gerecht zu werden.
Unser Stadtteil, die Dortmunder Nordstadt, gilt als eher anregungsarm. Viele Kinder kennen kaum mehr als den Nordmarkt und die Innenstadt. Wir wollten deshalb außerschulische Lernorte als feste Partner gewinnen, die wir mit den Kindern über ein Jahr hinweg regelmäßig besuchen können. Dabei haben wir uns bewusst auf Lernorte in der Natur konzentriert, da viele unserer Kinder wenig Zeit draußen verbringen. Im Wald können sie den Wechsel der Jahreszeiten erleben, auf dem Bauernhof die typischen Arbeiten wie Aussaat und Ernte kennenlernen.
Ursprünglich hatten wir geplant, die Lernorte alle vier Wochen zu wechseln. Doch es zeigte sich schnell, dass die Kinder erst einmal Zeit brauchen, um anzukommen. Sie kennen sich nicht aus, müssen sich zunächst zurechtzufinden und überhaupt Neugier entwickeln. Das dauert rund sechs Monate; erst danach kann die eigentliche Arbeit beginnen. Deshalb besuchen wir nun ein Schuljahr lang immer wieder denselben außerschulischen Lernort. Im ersten Schulbesuchsjahr steht der Wald im Mittelpunkt, im zweiten folgen außergewöhnliche Natur-Sportangebote mit dem Verein „Erlebt was“ und im dritten geht es um Landwirtschaft, Ernährung und Nachhaltigkeit auf einem Mitmachbauernhof.
Während der Eingewöhnungsphase geben die Pädagoginnen und Pädagogen der Lernorte noch viele Impulse und Aufgaben. Mit der Zeit werden die Kinder jedoch selbstständiger und entwickeln eigene Ideen, was sie vor Ort erforschen möchten.
„Draußen lernen die Kinder mit allen Sinnen“
News4teachers: Welche Vorteile bieten die außerschulischen Lernorte den Kindern?
Tamborini: Die Kinder sammeln vielfältige Naturerfahrungen, können handlungsorientiert lernen und machen Lebenswelterfahrungen, die im schulischen Kontext nur schwer vermittelbar sind. Viele unserer Kinder wissen zum Beispiel nicht, wo ihre Lebensmittel herkommen, was Nachhaltigkeit bedeutet oder welche Tiere in unseren Wäldern leben. Manche suchen im Wald sogar nach Affen. Diese Wissenslücken kann Schule allein kaum nachhaltig füllen. Draußen lernen die Kinder mit allen Sinnen – und das macht nicht nur neugierig, sondern auch Freude. Besonders schön sind die Rückmeldungen der Kinder: Bei der Verabschiedung der älteren Schülerinnen und Schüler vor den Sommerferien erzählten einige, dass das Schönste in ihrer Grundschulzeit die Erlebnisse im Wald oder auf dem Bauernhof gewesen seien. Das spricht für sich.
News4teachers: Was konnten Sie bislang beobachten: Wie wirkt sich das Projekt auf die Kinder aus?
Tamborini: Wir sind gerade dabei, das Projekt von der TU Dortmund und der Fachhochschule Dortmund wissenschaftlich analysieren zu lassen. Da es mit hohen Kosten verbunden ist, müssen wir nachweisen, dass es tatsächlich wirkt. Die Evaluation untersucht unter anderem die schulischen Leistungen der Kinder sowie ihre sozial-emotionale und sprachliche Entwicklung.
Aus meiner Perspektive kann ich schon jetzt sagen: Das Projekt hat Schule grundlegend verändert. Die Zeit an den außerschulischen Lernorten ersetzt regulären Unterricht. Deshalb haben wir gemeinsam mit unseren Partnern geschaut, wie sich unsere Lehrpläne und deren Bildungspläne verzahnen lassen. Auf diese Weise beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler auch an den außerschulischen Lernorten mit Inhalten, die parallel zum Unterricht verlaufen. Ein Beispiel: Im dritten Schulbesuchsjahr behandeln wir laut Curriculum das Thema „Ei und Huhn“. Es macht einen riesigen Unterschied, ob Kinder dieses Thema lediglich mit Arbeitsblättern im Klassenzimmer bearbeiten oder sich damit direkt auf dem Bauernhof beschäftigen. Im letztgenannten Fall verfügen die Schülerinnen und Schüler über deutlich mehr und nachhaltigeres Wissen – und gehen mit einer ganz anderen Motivation an die Sache heran.
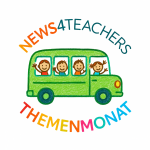 Auch das soziale Miteinander profitiert: In den Klassen, die schon länger im Projekt sind, gibt es nachweislich weniger Konflikte. Das liegt sicher auch daran, dass die Kinder alle zwei Wochen einen Vormittag außerhalb der Schule gemeinsam verbringen und dort viel stärker miteinander kooperieren müssen als im Klassenzimmer.
Auch das soziale Miteinander profitiert: In den Klassen, die schon länger im Projekt sind, gibt es nachweislich weniger Konflikte. Das liegt sicher auch daran, dass die Kinder alle zwei Wochen einen Vormittag außerhalb der Schule gemeinsam verbringen und dort viel stärker miteinander kooperieren müssen als im Klassenzimmer.
Ein weiterer Effekt zeigt sich bei der Schulpräsenz. Normalerweise haben wir in unserem Stadtteil mit hohem Schulabsentismus zu kämpfen. Doch zu den Projektterminen kommen die Kinder sehr regelmäßig – nicht nur, wenn sie selbst mit in den Wald fahren, sondern auch dann, wenn sie in der Schule bleiben und in der Kleingruppe mit ihrer Lehrerin arbeiten. Dort erhalten sie intensivere Unterstützung und mehr Feedback, als das möglich ist, wenn die gesamte Klasse anwesend ist. Das kommt gut an.
Besonders deutlich wirkt sich das Projekt zudem auf die Sprachentwicklung aus. Nach den Ausflügen haben die Kinder unglaublich viel zu erzählen. Die außerschulischen Lernorte schaffen eine Fülle an Gesprächsanlässen, die im klassischen Unterricht so kaum entstehen.
„So gewinnen wir durch das Projekt auch unseren eigenen Nachwuchs“
News4teachers: Wie funktioniert die Umsetzung eines so aufwändigen Projekts in Zeiten des Lehrkräftemangels?
Tamborini: Die Umsetzung gelingt nur, weil die Kinder zu den außerschulischen Lernorten von Teamerinnen und Teamern begleitet werden. Das sind Studierende etwa aus dem Bereich Lehramt oder Sonderpädagogik. Dadurch ist das Projekt zwar sehr kostenintensiv, aber die personelle Unterstützung ist unverzichtbar. Vor Ort übernehmen die Pädagoginnen und Pädagogen der Lernorte die Anleitung der Kinder. Die Klassenlehrkraft bleibt währenddessen an der Schule und kann dort in Kleingruppen individuell fördern. Zu ihren Aufgaben gehört aber auch, sich mit den Teamerinnen und den außerschulischen Partnern abzustimmen. Aufgrund des zusätzlichen Aufwands müssen sie sich daher bewusst bewerben, wenn sie mit ihrer Klasse am Projekt teilnehmen wollen. Im Gegenzug haben sie nicht nur die Möglichkeit, ihre Klasse regelmäßig in einer Kleingruppe zu fördern, sie erhalten auch wertvolles Feedback zu ihren Schülerinnen und Schülern, das ihnen ein umfassenderes Bild der Kinder vermittelt.
News4teachers: Wie haben Sie den Kontakt zu den Studierenden geknüpft?
Tamborini: Am Anfang musste alles sehr schnell gehen: Wir hatten die Idee vor den Herbstferien 2020 entwickelt und über die TU Dortmund in den Ferien einen Aufruf an Lehramtsstudierende gestartet. Daraufhin meldeten sich zwölf Studierende mit Interesse. Einige von ihnen stehen heute kurz vor dem Referendariat und arbeiten inzwischen als Vertretungslehrkräfte an unserer Schule. So gewinnen wir durch das Projekt auch unseren eigenen Nachwuchs.
Die Studierenden erleben die Arbeit als wertvoll und profitieren von den Praxiserfahrungen. Zwischen ihnen und den Kindern entwickeln sich ganz enge Beziehungen. Und wenn die Teamerinnen und Teamer Unterstützung benötigen – etwa, weil ihnen ein Kind etwas anvertraut, das auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung hinweist –, können sie sich jederzeit an unser multiprofessionelles Team wenden, das sie auffängt.
„Und am Ende gilt: nicht zu lange zögern – einfach machen“
News4teachers: Was empfehlen Sie anderen Schulen, die sich von Ihrem Projekt inspirieren lassen wollen?
Tamborini: Sie sollten sich starke Partner suchen. Wir hatten das große Glück, dass das regionale Bildungsbüro der Stadt Dortmund von Anfang an mit am Tisch saß und uns unterstützt hat. Da das Projekt sehr kostenintensiv ist, sollte der erste Fokus unbedingt darauf liegen, die nötigen Mittel zu sichern. In unserem Fall tragen die Stadt Dortmund, die Dortmund Stiftung und weitere Stiftungen zur Finanzierung bei, sodass das Projekt derzeit bis Ende 2026 abgesichert ist.
Ebenso wichtig ist, dass die Schulgemeinschaft hinter dem Projekt steht und es aktiv mitträgt. Nur dann kann es langfristig gelingen. Jede Schule braucht zudem eine eigene Idee, wie das Projekt konkret aussehen soll. In Dortmund beteiligen sich mittlerweile sechs Schulen – und alle setzen unterschiedliche Schwerpunkte und suchen verschiedene Lernorte auf, etwa Theater oder Museen.
Ich würde auch empfehlen, klein anzufangen und das Projekt mit der Zeit auszubauen. Die Organisation und die Spendenakquise sind aufwendig. Am Anfang habe ich das zum Beispiel noch alles allein übernommen, aber inzwischen sind zwölf unserer 18 Klassen beteiligt. Ich kümmere mich nun vor allem um die Fördergelder, während eine Kollegin die tägliche Koordination verantwortet, etwa wenn ein Teamer krank ausfällt.
Und am Ende gilt: nicht zu lange zögern – einfach machen.
News4teachers: Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Tamborini: Mein größter Wunsch ist, dass das Projekt weitergeführt werden kann. Es läuft nun schon seit fünf Jahren – schon allein das ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass viele Projekte nach einem Jahr wieder enden.
Außerdem würde ich mir wünschen, dass wir die Klassen wieder häufiger teilen können. In der Anfangsphase hatten wir die finanziellen Mittel, um die Projektklassen zweimal pro Woche zu teilen. So konnte jedes Kind wöchentlich entweder den außerschulischen Lernort besuchen oder von der individuellen Förderung in der Kleingruppe profitieren. Das war aber auf Dauer zu teuer. Derzeit können wir die Klassen nur noch einmal pro Woche teilen, sodass sich die Kinder wöchentlich abwechseln. Es macht jedoch einen spürbaren Unterschied, ob sie den Lernort jede Woche oder nur alle zwei Wochen besuchen.
Und natürlich wünsche ich mir, das Projekt auf die gesamte Schule ausweiten zu können. Bislang nehmen nur die ersten drei Jahrgänge teil – schön wäre es, den Kindern die Erfahrungen während der gesamten Grundschulzeit zu ermöglichen. News4teachers / Anna Hückelheim, Agentur für Bildungsjournalismus, führte das Interview.







Lebensmittel kommen aus dem Supermarkt, Kühe sind lila, Strom kommt aus der Steckdose und macht aua.
Ah, Sie waren schneller.