BONN. Wie müssen Schulen gebaut sein, damit sie Kinder und Jugendliche bestmöglich auf die Lebens- und Arbeitswelt von heute und morgen vorbereiten? Mit dieser Frage beschäftigen sich Barbara Pampe und Dr. Meike Kricke, Vorständinnen der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft. Unter dem Leitbegriff Pädagogische Architektur treibt die Stiftung seit Jahren den Wandel im Schulbau voran – weg von Fluren und Klassenzimmern nach Schema F, hin zu offenen, flexiblen Räumen, die Ganztag, Inklusion und zeitgemäße Pädagogik ermöglichen. Wir sprachen mit den Expertinnen zum Auftakt des News4teachers Themenmonats „Schulbau & Schulausstattung“.

News4teachers: Frau Pampe, Sie sind Architektin. Wenn Sie sich ein gewöhnliches Schulgebäude anschauen – was denken Sie dabei?
Barbara Pampe: Dass es in der heutigen Zeit kein Lebens- und Lernort ist.
News4teachers: Warum nicht?
Barbara Pampe: Diese Gebäude sind für ein bestimmtes pädagogisches Setting der frontalen Wissensvermittlung konzipiert – und dieses Setting allein entspricht nicht mehr dem heutigen Auftrag von Schule. Wenn Schule Kinder und Jugendliche auf die Welt von morgen vorbereiten soll, passen diese Bauten so nicht mehr.
Die klassische Schule ist geprägt von Klassenzimmern, Fluren und Treppenhäusern. Alles ist darauf ausgelegt, Frontalunterricht optimal zu ermöglichen. Klassenzimmer sind so gestaltet, dass bis zu 30 Schüler*innen an Tischen sitzen können. Fenster sind meistens so gesetzt, dass beim Schreiben kein Schatten aufs Papier fällt. Neben der Tür gibt es Waschbecken, damit man Tafel und Hände reinigen kann.
 Die Abstände im Raum sind so berechnet, dass alle gut an die Tafel sehen und die Lehrkraft hören können. Auch die Flure sind so dimensioniert, dass alle gleichzeitig die Klassenräume betreten und wieder verlassen können – so reicht eine Viertelstunde Pause für den Wechsel. Die Architektur war bzw. ist also exakt auf dieses Lernsetting aus dem 19. Jahrhundert abgestimmt.
Die Abstände im Raum sind so berechnet, dass alle gut an die Tafel sehen und die Lehrkraft hören können. Auch die Flure sind so dimensioniert, dass alle gleichzeitig die Klassenräume betreten und wieder verlassen können – so reicht eine Viertelstunde Pause für den Wechsel. Die Architektur war bzw. ist also exakt auf dieses Lernsetting aus dem 19. Jahrhundert abgestimmt.
Heute aber zeigen Empfehlungen wie z.B. das aktuelle Papier zu einer veränderten Lern- und Prüfungskultur von Expert*innen aus Schul-/Kultusministerien, Landesinstituten und aus der Bildungsforschung, die KMK-Richtlinien für den Ganztag, der OECD Learning Compass, aber auch die pädagogische Praxis an vielen Orten ein völlig anderes Bild: Kinder und Jugendliche lernen den ganzen Tag über in verschiedenen Konstellationen, sie arbeiten alleine oder zusammen, toben, essen, musizieren, spielen Theater, präsentieren, nutzen Rückzugsmöglichkeiten. Wenn ich das als Architektin in Raum übersetze, entsteht etwas völlig anderes als das, was wir in klassischen Schulen sehen.
Hinzu kommt: Qualitativ hochwertige Bildung braucht auch Räume für das (multiprofessionelle) Team: Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen, Psychologinnen, Therapeutinnen und Erzieherinnen. Kurz gesagt: Die Heterogenität – der Menschen wie auch der Angebote – fehlt in den traditionellen, am 19. Jahrhundert orientierten Gebäuden.
“Wir wollen zeigen, dass Raum enormes Potenzial entfaltet, wenn man ihn mit zukunftsgerichteter Pädagogik verbindet – und beides zusammen entwickelt”
News4teachers: Ist das also ein Problem alter Schulbauten, etwa der Gebäude aus den 60er- oder 70er-Jahren? Oder gilt das auch für Neubauten?
Barbara Pampe: Man kann das nicht am Baujahr festmachen. Schon früher gab es Strömungen, die andere pädagogische Ansätze vertraten – und dafür auch andere Gebäude geplant und gebaut haben. Heute ist es so: Viele Kommunen haben verstanden, dass Ganztag, Inklusion, Digitalität und somit neue Lernformen andere Räume erfordern. Manche haben eigene Standards entwickelt, andere setzen auf eine sogenannte „Phase Null“ – eine Entwicklungsphase, in der zunächst geklärt wird, welche Aktivitäten zukünftig in Schule stattfinden und was der konkrete Standort auch unter Einbezug des Quartiers braucht.
Aber es gibt auch Kommunen, die diesen Weg noch nicht gehen – aus Ressourcenmangel, aufgrund von veralteten Vorgaben oder aus mangelndem Bewusstsein dafür, dass Schule sich verändern muss, weil sich auch unsere Lebens- und Arbeitswelt verändert hat. Deshalb werden weiterhin klassische Schulen gebaut. Gleichzeitig stellt sich die Frage: Wie können wir bestehende Gebäude im Zuge von Sanierungen so umbauen, dass sie heutigen Ansprüchen entsprechen?
News4teachers: Wie sieht diese Phase Null konkret aus?
Barbara Pampe: In der Phase Null geht es nicht darum, die Schule zu fragen: „Was wollt ihr?“ Es geht darum, alle Akteure einzubeziehen, um die Anforderungen bestmöglich zu erfassen, abzuwägen und zu definieren: Schulgemeinschaft, Schulaufsicht, Kommune, Politik, Finanzverwaltung, Umwelt- und Verkehrsplanung, Stadtentwicklung, das Quartier. Man schaut dabei auch, welche Ressourcen geteilt werden können – etwa Sporthallen, Bibliotheken oder Werkstätten. Nur in so einem Verhandlungsprozess entsteht ein tragfähiges pädagogisch-räumliches Konzept.
News4teachers: Also gibt es die „ideale Schule“, die überall stehen könnte, gar nicht?
Barbara Pampe: Nein.
News4teachers: Frau Dr. Kricke, Sie haben Lehramt studiert. Aus pädagogischer Sicht: Ist Lehrkräften bewusst, welche Bedeutung der Raum hat, in dem gelernt wird?
Meike Kricke: Meiner Einschätzung nach nicht genug. In meiner Ausbildung gab es dazu kaum Sensibilisierung oder Austausch. Wenn überhaupt, dann eher zufällig. Überblicke ich es richtig, gibt es bisher kein institutionalisiertes Angebot zur Wechselwirkung von Pädagogik und Raum.
Das ist schade. Denn wenn wir immer mehr unterschiedliche Schulgebäude haben, stellt sich die Frage: Wie kann ich – wie können wir im Team mit den Lernenden – diese pädagogisch sinnvoll nutzen? Es reicht nicht, einfach in eine Lernlandschaft oder ein Cluster einzuziehen. Wichtig ist die Reflexion: Welche (zusätzlichen) Optionen bietet mir der Raum für meine pädagogische Herangehensweise? Wie lassen sich Didaktik, Organisation und Raum zusammendenken?
Das sollte im Team reflektiert werden – multiprofessionell, etwa mit Partner*innen aus der Jugendhilfe, und auch mit den Schülerinnen und Schülern: Sie haben in der Regel selbst eine sehr gute Vorstellung davon, wo und wie sie gut lernen.
Bisher geschieht das kaum systematisch. Deshalb haben wir erste Pilotprojekte gestartet: Studierende aus dem Lehramt, den Sozialwissenschaften und der Architektur arbeiten früh in ihrer Ausbildung zusammen. So wollen wir zeigen, dass Raum enormes Potenzial entfaltet, wenn man ihn mit zukunftsgerichteter Pädagogik verbindet – und beides zusammen entwickelt.
Die Hochschulen selbst sehen oft nicht besser aus als Schulen – auch dort fehlt das Bewusstsein. Im Ausland gibt es bessere Beispiele: In Dänemark oder Finnland ist die Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen vielerorts darauf ausgerichtet, dass sie räumliche Erfahrungen mit neuen didaktischen Ansätzen verbinden.
Wir alle waren selbst Schüler*innen. Die meisten kennen vordergründig klassische Pädagogik und die dazu viablen typischen Klassenzimmer. Vielleicht hatten manche das Glück, auf eine reformpädagogische Schule zu gehen. Aber die Verbindung von Pädagogik, Didaktik, Organisation und Raum in einem Gesamtkonzept – das ist bis heute selten als Ausbildungsmodul.
“Wir dürfen es nicht bei reinen Reparaturen und kosmetischen Maßnahmen belassen – bunte Farben oder neues Mobiliar”
News4teachers: Im Moment kommt viel Geld auf die Schulträger zu.
Meike Kricke: Ja, und das ist sehr positiv, aber auch überfällig: mit 67,8 Mrd. Euro ist der Investitionsstau bei Schulgebäuden wieder einmal mit Abstand der höchste in Deutschland. Wichtig ist jetzt: Wir dürfen es nicht bei reinen Reparaturen und kosmetischen Maßnahmen belassen – bunte Farben oder neues Mobiliar. Es braucht kluge, auch einfache Lösungen, die fast überall umsetzbar sind und die die pädagogischen Optionen direkt erweitern: mehr Transparenz, neue Brandschutzkonzepte, durchdachte Möblierung – abgestimmt auf die pädagogischen Bedarfe. Solche Lösungen gibt es bereits.
All das muss mit einem didaktisch-organisatorischen Gesamtkonzept verbunden sein – entwickelt in multiprofessionellen Teams, die auch Schulentwicklungsfragen berücksichtigen. Frau Pampe hat die Phase Null angesprochen: Wenn ich ein Gebäude neu baue, steht es 70 oder 80 Jahre. Deshalb müssen wir in die Zukunft blicken: Wie können wir offen bleiben für Entwicklungen, die Schule in 20 oder 30 Jahren ausmachen? Pädagogische Überlegungen wirken sich unmittelbar auf die Planungen der (Innen-)Architektur aus.
News4teachers: Konkret: Was kann ein gut gestalteter Raum bewirken?
Barbara Pampe: Architektur kann vieles erleichtern und ermöglichen. Ein Beispiel: Glastüren oder Glaswände. Sie ersparen das Klopfen, man sieht sofort, ob ein Raum belegt ist, und muss nicht stören, um es herauszufinden. Transparenz erlaubt, dass Schüler*innen überall arbeiten können – während Lehrkräfte sie im Blick behalten und auch umgekehrt. Geschlossene Türen und Wände erzeugen sofort die Sorge: „Wenn sie rausgehen, machen sie Unsinn.“ Transparenz schafft Vertrauen, erleichtert Teamarbeit und ermöglicht Mehrfachnutzung.
Es geht darum, möglichst viel Fläche zur Lernfläche zu erklären, Sichtverbindungen zu schaffen, unterschiedliche Qualitäten anzubieten. Solche baulichen Maßnahmen müssen von Anfang an mitgedacht werden.
Brandschutz ist ein gutes Beispiel: Flure werden oft ohnehin mitgenutzt. Statt dies aufgrund des Brandschutzes nicht zuzulassen, kann der Brandschutz so geplant werden, dass die Flure als Lernflächen ohne Brandschutzanforderungen genutzt werden können.
Auch die Möblierung muss neu gedacht werden. Kinder und Jugendliche tun nicht immer alle gleichzeitig das Gleiche. Daher braucht es nicht zwingend 30 Stühle und Tische, sondern verschiedene Sitzangebote. Ziel sollte es sein, nicht jeder neuen Anforderung einen neuen Raum zuzuordnen. Stattdessen braucht es Gesamtkonzepte, die eine sinnvolle Nutzung von Flächen über den ganzen Tag für eine inklusive Bildung ermöglichen.
Ein Beispiel aus einem unserer Pilotprojekte „Ganztag und Raum“ in Mülheim a. d. Ruhr – an der Grundschule am Dichterviertel: Dort wurden Klassenzimmer komplett leergeräumt. Es gibt keine Einzeltische mehr, sondern große Forumstische für die Klasse. Dadurch entstehen freie Flächen, die unterschiedlich je nach Bedarf bespielt werden können. Hinzu kommt ein abgestimmtes Farb- und Materialkonzept für Möbel, Wände und Vorhänge. Das Ergebnis: Räume mit spürbar höherer Aufenthaltsqualität – abgestimmt auf die Bedürfnisse der Schule.
News4teachers: Und wenn wir auf ein ganzes Gebäude schauen?
Barbara Pampe: In Weimar wurde gerade die Jenaplanschule fertiggestellt, die wir neun Jahre lang in der Phase Null, in der Planung und im Bau begleitet haben. Ein Geschoss umfasst dort ca. 400 Quadratmeter mit drei Stammgruppen und dem pädagogischen Personal. Die Räume sind offen, können mit Vorhängen abgetrennt und durch Möbel gegliedert werden. Es gibt eine gemeinsame Mitte mit Podesten, einen Teamraum, einen Differenzierungs- und Rückzugsraum und eine große Wohnküche mit einem großen Atelier- und Werktisch. Die Wände sind ab Tischhöhe transparent, so dass sich alle sehen und auch die Mitte mit Tageslicht versorgt wird. Die Fenster sind bodentief und ermöglichen durch große Schiebetüren einen Einbezug der Balkone.
Ein oft unterschätzter Bereich sind die Garderoben – hier wurde ausreichend Platz eingeplant, da die Schule eine „Hausschuhschule“ ist.
Das Ergebnis ist eine Vielfalt von Lehr- und Lernsettings mit wohnlicher Atmosphäre und Werkstattcharakter, die die Nutzenden auffordert, sich den Raum anzueignen und pädagogisch zu bespielen. In den Decken gibt es Haken für Beleuchtung und sonstige Ausstattung wie Blumenampeln etc.
“Schulen der Zukunft müssen Vielfalt ermöglichen – und hier wird das räumlich umgesetzt”
News4teachers: Ein teurer Spaß?
Barbara Pampe: Nein. Schon früh war klar: Der Neubau soll auch wirtschaftlich sein. Ein Großteil der Kosten entfällt normalerweise auf die Haustechnik. Deshalb wurde auf natürliche Lüftung der Lernflächen gesetzt. Fenster lassen sich leicht öffnen, Querlüftung ist möglich. Schiebefenster erlauben die volle Nutzung der Fassadenflächen. Außerdem wird das allgemeine Wohlbefinden in Räumen gesteigert, wenn Fenster einfach geöffnet werden können.
News4teachers: Gibt es dort auch Arbeitsplätze für Lehrkräfte?
Barbara Pampe: Ja. Auf jeder Etage gibt es Teamstationen. Zusätzlich gibt es Arbeitsplätze und Besprechungsmöglichkeiten in der Verwaltungsetage. Die Arbeitsplätze sind in derselben Qualität gestaltet wie die Räume der Schülerinnen und Schüler: viel Holz, Transparenz, Vorhänge, gleiche Möbel.
News4teachers: Frau Kricke, wie bewerten Sie die Schule pädagogisch?
Meike Kricke: Für mich ist sie ein „Chamäleon“. Durch einfache Mittel – Haken, Vorhänge, variable Räume – passt sie sich den Bedarfen an. Und sie unterstützt Zukunftskompetenzen, wie z.B. Kommunikation, Kreativität, Kollaboration, kritisches Denken. Es gibt Möglichkeitsräume: Rückzug, Teamarbeit, Nutzung des Außenraums, Öffnung ins Quartier. Schulen der Zukunft müssen Vielfalt ermöglichen – und hier wird das räumlich umgesetzt.
News4teachers: Viele Lehrkräfte befürchten in solchen offenen Räumen Chaos.
Meike Kricke: Diese Ängste sind nachvollziehbar. Es ist eine große Veränderung, die Anpassung erfordert. Aber sie bringt auch viel Positives und neue Möglichkeiten mit sich. Wichtig ist, dass solche Prozesse mit Schulentwicklung verbunden sind. Wenn alle Beteiligten sich zusammen auf diesen Weg begeben, wird für alle deutlich, dass Pädagogik und Didaktik nicht mehr so weiterlaufen können wie vor 100 Jahren. Schule ist kein Museum. Hier sind Schulleitung und Schulaufsicht gefragt, diesen Weg mitzugehen und die Teams zu unterstützen. Schulen des 21. Jahrhunderts sind Teamschulen – man ist nicht allein!
Wir haben dafür zum Beispiel auch die „Phase Zehn“ entwickelt: Nach Fertigstellung eines Gebäudes begleitet man das gesamte Personal und die Schüler*innen dabei, die Räume zu erobern, zu erkunden und zu gestalten. Und auch danach geht die Reflexion im Wechselspiel zwischen Pädagogik und Architektur weiter – denn Schulentwicklung hört nie auf. News4teachers / Andrej Priboschek, Agentur für Bildungsjournalismus, führte das Interview.
Hier gibt es kostenlose Informationen und Materialien der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft zum Schulbau.
Die Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft unterstützt News4teachers bei der Konzeption und Umsetzung der redaktionellen Beiträge des Themenmonats „Schulbau & Schulausstattung“. Hier geht es zu allen Inhalten.
Und noch ein Rekord… Das neue Redaktionskonzept von News4teachers zieht!





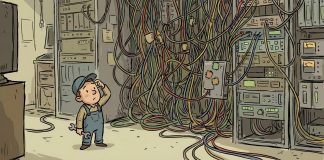




Sie müssen offene Lernformen bieten, Rückzuzgsorte, Computer und technische Ausstattung, Filmkameras usw.
Also wie ein Office heutzutage, wo man sich austauscht. Bei der 4 Tage Woche ist man dann auch nicht immer vor Ort.
Im Grunde klappt dann hier auch der online Unterricht von einigen gewünscht.
oh ja wir auch, 4 Tage +1 freier Projekttag
Seitdem sind die Stundenpläne richtig gut und ich muss nur noch an 4 Tagen in die Schule 🙂
Ja, genau, ich schreibe das mal der Stadt, damit die alle anderen Ausgaben auf Eis legen … Sozialausgaben sind ja auch komplett überflüssig.
Schön wäre es, aber derzeit werden nicht so viele Schulen neugebaut. Und das Geld, das da ist, wird in den Brandschutz gesteckt bzw. in die billigsten Maßnahmen, um Barrierefreiheit hinzuwurschteln.
Bei uns wurden fast 700 000 Euro in den Brandschutz gesteckt. Tja…
würden auch gerne die 4 Tage Woche haben 🙁 🙁
Hatte ich jahrelang, habe meine Stunden auf 20 reduziert. Habe aber die 28 Stunden auch einfach nicht mehr gepackt. Vom Geld her war das kein Problem und die Pension ist mehr als ausreichend. Irgendwie war ich meiner Zeit voraus – bin wohl im Inneren Gen Z.
Bei vollem Lohnausgleich?? 😀 😀
haben andere, sie hatten wahrscheinlich saftige Einbußen!
Pension mehr als ausreichend bei 20 Stunden?
Pfui, Sie Nestbeschmutzerin! Sowas sagt man nicht und schreibt das auch nicht!
Beliebtes Buzzword: “multiprofessionelle Teams”…
Die Wahrheit vieler Schulgebäude ist doch aber, dass nicht einmal die Basics stimmen: Gesperrte Räume, kaputte Fenster, Toiletten mit der Atmosphäre von Bahnhofsklos. Die im Interview genannten Konzepte finden sich allerhöchstens in Neubauten wieder – und manchmal nicht einmal dort.
Alle wie viel Jahre ersetzt eine Kommune ein bestehendes Schulgebäude durch einen Neubau? Ich habe das zeit meines Lebens nach 1990 nicht erlebt. Es gab lediglich Flicken und Reparieren – egal wie ungeeignet das Gebäude ist. Der Raum – der dritte Pädagoge, heißt es. Is halt Lehrermangel, ne?
Man braucht also neue, völlig neu konzipierte Schulgebäude, um Unterrichtskonzepte zu ermöglichen, die aufgrund des Lehrer-/Fachkräftemangels eh nicht umgesetzt werden können? Logik einer Architektin.
Man braucht neue Gebäude, um “moderne” Unterrichtskonzepte zu ermöglichen, für die es kein Personal gibt und die dann auch noch zu noch schlechteren PISA-Ergebnissen führen und unsere Wirtschaft international noch weiter zurückwerfen. Wir müssten Singapur, China, Japan oder Südkorea kopieren und uns nicht irgendeinen Mist ausdenken und dafür dann viel Geld rausblasen. Die gescheiterte Energiewende – die bereits jetzt zu deutlichen Wohlstandsverlusten führt – sollte uns eigentlich eine Lehre sein.
In meiner Schule gibt es einige Ukrainer, die erst seit kurzem bei uns leben. Die sind in Mathematik um Welten besser als unsere Schüler, obwohl die Schulgebäude in der Ukraine nicht top-modern sind. Gute Lehrmethoden sind wesentlich wichtiger für den Bildungserfolg.
Dafür brauchts dann die offenen Räume, am besten mit Fenster und Lautsprecher zum Nachbarklassenzimmer, um die Klasse bei Lehrermangel mal eben mitbetreuen zu können.
Danke für das Eingrenzen meiner pädagogischen Freiheit! Es genügt kein Clusterbau, man braucht Personen, die Verantwortung für die Kinder nehmen wollen und das von klein auf.
Unser Schulgebäude ist über 100 Jahre alt. Wir wären froh, würde der Schulträger sich endlich mal zumindest um die Renovierung der Toiletten (aus den 60ern) kümmern. Sonnenschutz an den Fenstern gibt es nicht (Denkmalschutz) und Akustik und Beleuchtung in den hohen Räumen und kahlen Fluren sind unterirdisch. Aber wenn die Städte nicht in die Gebäude investieren wollen/können, dürfen wir noch lange von transparenten Zimmern, Rückzugsorten und Multifunktionsmobiliar träumen….das ist unser Alltag.
Schallschutz, gute Arbeitstemperatur (nicht zu heiß, nicht zu kalt, große Kubatur), frische Luft! Gibt es selbst bei Neubauten kaum.
Das wäre schon einmal wichtig
rfalio
Das erscheint auch mir als das Wichtigste. Ich habe extra die Kommentare gelesen, ob es jemand vor mir geschrieben hat, also vielen Dank!
Wo genau gibt es diese multiprofessionellen Teams? Ist das der Betreuer der zwei mal in der Woche vorbei kommt um nach einem Kind mit mehrfacher Behinderung zu schauen?
Sonst gibt’s hier nix.
Glastüren und Glaswände? Schon mal was von Schutzräumwn gehört?
Und die Sus arbeiten den ganzen Tag selbständig und frei bestimmt?
Ernsthaft? Wie passt das mit Lehrplänen und Stunden zusammen?
Und was soll bitte die Aussage Lehrer und Lehrerinnen wüssten nicht wie wichtig ein guter Raum ist. Im Prinzip wollen alle einen guten Raum bekommen aber einen schimmligen mit kaputten Fenstern und Wänden bei denen der Putz runter fällt. Dazu furchtbare Akustik und schlechtes Licht. Dazu heiß im Sommer und kalt im Winter.
Wie wäre es dass die Schulträger zu richten?
Oder sollen die Lehrer jetzt umbauen?
Das klingt alles extrem nach Elfenbeinturm…
Die Verantwortung liegt bei allen Beteiligten, aber in unterschiedlichen Bereichen. Die Baumaßnahmen incl. Heranziehen von Fördermitteln und Beauftragubg der notwendigen Experten sind selbstverständlich Aufgabe der Kommunen. Von der Lehrerschaft wird die Offenheit für Veränderungen und die frühe Beteiligung erwartet. Ohne dieses Zusammenwirken kann Schule in unser aller Sinne nicht mehr funktionieren.
Wir haben alle das gleiche Ziel. Lasst es uns mit Mut, Zuversicht und weiterhin von Herzen kommendem Engagement angehen.
Was für Mut?
Ich bin schin lange offen für neue sanierte Räume. Das abgeben von Verantwortung an die lul geht mir aber extrem auf den Sack.
Und welche Beteiligung?
Mich hat noch niemand gefragt was ich will…
Nein, liegt Sie nicht.
Etwas, worüber man keinerlei Macht oder Mitsprache hat, dafür hat man auch keine Verantwortung.
Ist den Lehrkräften bewußt, welche Bedeutung der Raum hat? Unglaublich aber wahr, ja! Man braucht tatsächlich kein ‘institutionalisiertes Angebot zur Wechselwirkung…’, um sich Gedanken zu vorhandenen und wünschenswerten Umgebungen zu machen. Lehrkräfte sind zu eigenem Denken fähig und tun das sogar manchmal. Warum hätten sonst so viele Räume jeweils andere Sitzpläne, sicherlich nicht aus Zufall.
So ganz nebenbei: Glastüren, ab Tischhöhe transparente Wände, bodentiefe Fenster, schön offen und pädagogisch wertvoll, toll, sieht großartig aus. Vorgaben zum Verhalten im Fall eines Amoklaufs: Türen schließen, möglichst unsichtbar bleiben. Zum Glück selten, aber wie heißt es an anderer Stelle: Schulen stehen 70-80 Jahre und nicht nur schulische, auch gesellschaftliche Entwicklungen und Vorstellungen können in viele Richtungen gehen.
Ich wäre übrigens sehr interessiert an den einfachen, schon existierenden Lösungen, die aus einer klassische Flur/Klassenraum-Schule mit stark frequentierten Verkehrsflächen einen jederzeit, für alle Lerngruppen, nutzbaren offenen Raum machen. Schallschutz bzw. -dämmung, gehört auch dazu, schon einmal mit Förderschülern Hören gearbeitet? Rückzugsräume, es soll ja auch Autismusspektrum u.ä. geben? Das alles in vorhandene Gebäude, ich zweifle.
Zur höheren Aufenthaltsqualität gehören auch die Sanitärräume. Irgendeine geniale architektonische Lösung für Toiletten, ohne den Charme von Autobahnparkplätzen nachzuempfinden? Bis zum Neubau unlösbar…?
Es ist sicher schön, bei Einzelprojekten seine Ideen zu verfolgen, als begeistertes Team zusammenzuarbeiten, ‘etwas Neues’ zu machen. Real müssen wir mit wenig Geld und dem Alten leben, Kleinarbeit hat weniger Glamour, findet sie darum so selten statt?
Wir haben vor Jahren einen Anbau mit 2 neuen Klassenräumen mit diesen Fenstern bekommen. Die Kollegen haben sie abgeklebt – die Schüler sind viel zu abgelenkt durch die Bewegungen auf dem Flur. Und das mit dem Verhalten im Amokfall war mein 1. Gedanke, als die Räume fertig waren.
“Vorgaben zum Verhalten im Fall eines Amoklaufs: Türen schließen, möglichst unsichtbar bleiben.”
Wissen Sie, was das traurige ist?
Ich ahtte exakt den gleichen Gedanken, als ich bei diesem Teil Ihres Textes angekommen bin. Eigtl. traurig, dass derart singuläre Ereignisse derartigen Einfluss auf unser Denken haben. 🙁
Das Gebäude wirkt so Richtung Festung oder Vollzugsanstalt.
Die zeitgemäße Pädagogik ist in den letzten 25 Jahren von Erfolg zu Erfolg geeilt. Kein Wunder, kommt ja alles von oben.
Vorwärts immer – rückwärts nimmer!
Die Weltverbesserung in ihrem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf!
Wenn ich mir ein Schulgebäude wünschen dürfte, ich hätte gerne eines, wie es um das Jahr 1900 gebaut wurde, halt mit sehr viel Ziegel-Massivbau, Gewölbedecken und einem Satteldach oben drauf. Diese Gebäude haben gezeigt, dass sie robust genug sind, um auch den Schülern ausreichend Widerstand zu leisten. Außerdem sind diese Gebäude aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer sehr nachhaltig. Was in meinen Augen so gar nicht geht sind Holzbauten mit Flachdach und Innenwänden aus Gipskarton. Solche Gebäude kann man nach spätestens 20 Jahren kernsanieren oder besser abreißen und neu bauen. Die alten Gebäude schaffen hingegen locker 200 Jahre.
Meine Güte, haben wir Probleme. Wo anders laufen die Kinder einen langen Weg in die Schule, wollen was lernen und sind froh, ein Dach über dem Kopf zu haben und freuen sich über eine warme Mahlzeit. In was für einer standardisierten und weichgespülten Welt leben wie eigentlich?
Ist das ein Plädoyer für mehr Armut? Herzliche Grüße Die Redaktion
Für mehr Demut.
Irgendwie logisch, es sieht ja auch kein Supermarkt mehr so aus wie der Dofladen vor 100 Jahren.
Der Dorfladen hat aber die entschieden positivere Ausstrahlung als die heutigen Industriehallen.
So ein Unsinn. Wir erleben seit Jahren, dass die moderne Pädagogik gescheitert ist. Die wichtigen grundlegenden Fähigkeiten der Schüler sind unter aller Sau. Prüfungskriterien werden abgesenkt. Zum Lernen braucht es einen störungsfreien, abgeschlossenen Raum, Leselektüre, Papier und Bleistift. Es hilft nicht mit Geld auf Architektur und Einrichtung/Technik zu werfen.
Unsere Schule ist ein dreijähriger Neubau in Clusterbauweise. Viele Vorteile, aber auch viele Nachteile, z.B. lange Wege. Ob das Kollegium modernen Unterricht macht, liegt nicht nur am Gebäude. Gruppenarbeit verteilt über das ganze Gebäude und den Schulhof hatten wir schon vorher. Und die Glaswände zum Cluster hin sehen toll aus, sind aber nicht sinnvoll. Ständig stehen andere Kinder davor und kaspern rum. Und was wir bei einem Amoklauf in einem rundum verglasten Raum machen sollen, male ich mir besser nicht aus.
Wenn Schulen Zoos wären, würden viele sofort geschlossen werden, wegen nicht artgerechter Haltung.
Aber Kinder kann man ja im Sommer schwitzen und im Winter frieren lassen, mit fettigem, zuckrigen Fertigmist füttern, stinkende Toiletten nutzen und ihre Pausen in Betonwüsten verbringen lassen.
Toll, dass es Architekt:innen gibt, die wunderschöne Lernorte ersinnen! Aber solange die Finanzierung von Gebäuden und Ausstattung bei z.T. völlig verarmten Kommunen liegt, wird es vielerorts sch$$$e bleiben. Zumindest gerecht verteilt, denn Toner für die Lehrerzimmerkopierer gibt’s ja auch nur gelegentlich.