BERLIN. Scharfe Kritik an der Bildungsministerkonferenz im Rahmen der KMK: Die Bundesdirektorenkonferenz (BDK) der Gymnasien wirft der Kultusministerrunde vor, mit ihrem neuen „Zielbild zur Rolle und Arbeit der Schulaufsicht“ die Idee der eigenverantwortlichen Schule aufzugeben. In einer Stellungnahme heißt es, der Beschluss stehe „für eine Rückkehr zu veralteten hierarchischen Steuerungsinstrumenten, die Eigenverantwortung durch Kontrolle ersetzen“.

„Mit dem Beschluss vom 16.10.25 beendet die Bildungsministerkonferenz den Prozess zur eigenverantwortlichen Schule und stellt sich gegen alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie Schulentwicklung und Qualitätssteigerung erfolgreich gelingen“, erklärt Arnd Niedermöller, Vorsitzender der Bundesdirektorenkonferenz. „Mit der neuen Definition der Rolle der Schulaufsicht wird die Gestaltungsfreiheit an den Schulen stark eingeschränkt. Damit werden noch weniger Personen bereit sein, die Aufgaben einer Schulleitung zu übernehmen.“
Auch sein Stellvertreter Heiko Helms spart nicht mit deutlichen Worten: „An die Stelle von Transparenz und professioneller Leitung tritt ein administratives Verständnis von ‚Begleitung und Beratung‘, das Schulen letztendlich zu nachgeordneten Ausführungseinheiten degradiert. Die im ‚Zielbild‘ beschworene ‚gemeinsame Verantwortung‘ bleibt eine rhetorische Floskel, solange Steuerungsinstrumente und Berichtspflichten die pädagogische Gestaltungsfreiheit faktisch einschränken oder gleich ganz zum Stillstand bringen.“ Die Folge, so Helms, sei eine Gefahr für die Effizienz schulischer Arbeit: „Wer Verantwortung tragen soll, muss auch die Möglichkeit haben, sie eigenständig wahrzunehmen.“
Zuständigkeitswirrwarr, Konflikte und Ineffizienz
Die Direktorenkonferenz kritisiert insbesondere, dass die KMK mit ihrem sieben Seiten langen Papier Doppelstrukturen schaffe, die der zuvor beschlossenen 45-seitigen Handreichung „Orientierungsrahmen zur Qualifizierung von Schulleitungen“ widersprechen. Während dort klar definiert sei, dass die Schulentwicklung in der Verantwortung der Schulleitungen liegt, übertrage das Zielbild nun zentrale Steuerungsaufgaben an die Schulaufsichten. „Unterstützung“ von Schulleitung werde darin als „vertikale Beratung“ beschrieben, die mit „Steuerungsinstrumenten“ erfolge. Das, so die Bundesdirektorenkonferenz, führe zwangsläufig zu Zuständigkeitswirrwarr, Konflikten und Ineffizienz.
Die Vorsitzenden betonen: Schulaufsichten sollten „wichtige und qualifizierte Ansprechpartner“ sein, die Schulleitungen bei Bedarf etwa in rechtlichen Fragen oder bei Personalrekrutierung unterstützen. Doch die Schulentwicklung müsse in den Händen der Schulleitungen bleiben. „Die Rolle der Schulaufsicht muss klar von der Rolle der Schulleitung abgegrenzt sein. Die Schulleitung verantwortet, steuert und leitet die Prozesse an der Schule“, heißt es in der Erklärung. Eingreifen dürfe die Aufsicht nur, „wenn bei Schulen unter Berücksichtigung ihrer besonderen Situation der Output nicht stimmt oder nicht rechtskonform gehandelt wird“.
„Wer Verantwortung tragen soll, muss auch die Möglichkeit haben, sie eigenständig wahrzunehmen“
Tatsächlich legt das von der KMK beschlossene „Zielbild zur Rolle und Arbeit der Schulaufsicht“ eine neue Gewichtung fest. Nach Angaben der Ministerinnen und Minister soll die Schulaufsicht zwar künftig „Partnerin der Schulen“ sein – und weniger Kontrolle, dafür mehr Unterstützung leisten. Sie soll, so heißt es im Beschlusspapier, „die Schulen zielorientiert, kooperativ, kommunikativ, ermutigend und wertschätzend begleiten“. In der Praxis soll dies durch regelmäßige Beratung, systemische Zusammenarbeit und gemeinsame Zielvereinbarungen geschehen.
Das Zielbild beschreibt die Schulaufsicht aber als eigenständiges Berufsfeld, das auf vier Säulen ruht: Haltung, Aufgaben, Kompetenzen und Instrumente. Unter „Haltung“ versteht die BMK vor allem eine Steuerungsverantwortung, die auf Kooperation und Vertrauen basiert. Die Aufgaben umfassen nach der Definition der KMK sowohl Kontrolle als auch Begleitung: Die Schulaufsicht soll Qualität sichern, Personalentwicklung unterstützen und Krisenmanagement leisten.
Zugleich sollen die handelnden Personen als Führungskräfte geschult werden. Das Papier nennt eine Reihe von Kompetenzanforderungen – von Kommunikationsfähigkeit über Feedbackkultur bis zu systemischem Denken. Es empfiehlt zudem, die Schulaufsicht mit ausreichenden personellen, räumlichen und digitalen Ressourcen auszustatten und regelmäßig fortzubilden
Die Bildungsministerinnen Dorothee Feller (NRW) und Christine Streichert-Clivot (Saarland) hatten den Beschluss als „wichtigen Schritt für eine moderne Schulaufsicht“ bezeichnet. Schulaufsicht solle, so Feller, künftig „wichtige Begleiterin und Ratgeberin der Schulen“ sein, während Streichert-Clivot betonte, die Aufsicht müsse „handlungsfähig sein, damit Qualität gesichert und Innovation möglich werden“.
Doch aus Sicht der Schulleitungen greift das eklatant in ihren Kompetenzbereich ein. „Wer Verantwortung tragen soll, muss auch die Möglichkeit haben, sie eigenständig wahrzunehmen“, mahnt Direktorenkonferenz-Vize Heiko Helms. „Andernfalls verliert die Schule ihren Gestaltungswillen – und das Vertrauen, das sie für gute Bildung braucht.“ News4teachers
“Kooperativ, kommunikativ, ermutigend”: KMK beschließt Leitlinien für die Schulaufsicht









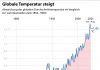
Schafft doch die Schulleitungen ganz ab, dann kann die Schulaufsicht die Verantwortung übernehmen und das Ministerium kann durchregieren.
Im zweiten Schritt müsst ihr nur noch die Lehrer durch KI ersetzen.
So schöne Kennzahlen gab es noch nie!
Alles paletti, Kontrolletti.
Die Schulaufsicht will wohl die Schulen per KI überwachen und mit Ressourcen (Lehrerstellen, …) versorgen.
Wenn dann was schiefgeht, kann man sagen:
“Hat die KI so entschieden. Wird wohl trotzem seine Richtigkeit haben. Kann man nichts machen.”
“Eingreifen dürfe die Aufsicht nur, „wenn bei Schulen unter Berücksichtigung ihrer besonderen Situation der Output nicht stimmt oder nicht rechtskonform gehandelt wird“.”
Und wer bestimmt den “Output” und was “nicht rechtskonform” ist? Die einzelne Schule bestimmt nicht.
Die Zügel werden in Zukunft straff angezogen werden, die Schulleitung zum Leitgaul degradiert, welche die anderen Arbeitspferde mitziehen darf…
Verantwortlich sein ohne verantwortlich handeln zu dürfen. Oder so ähnlich.
“Output”….wenn ich das schon höre. Das hat was von Planwirtschaft. Wenn ihr noch 80 Abiturienten und einen Schnitt von mindestens 2,8 schafft, dann…
Dann kann man wohl die Schulen dichtmachen und Ringelpitz mit Anfassen spielen
Der Artikel beschreibt eine Entwicklung, die ich seit einigen Jahren beobachte (Gymnasium Baden – Württemberg), auch auf der Ebene der einzelnen Unterrichtsfächer. Die Rolle der Fachberater veränderte sich vom kooperativen Gesprächspartner, der Kollegen vor Ort unterstütze, ihre Ideen von Schul – und Unterrichtsgestaltung umzusetzen (und damit Schule insgesamt weiterzuentwickeln) hin zu einer Institution, die das an die Schulen weitergab, was „oben“ beschlossen worden war und dessen Durchführung auch durch die Fachberater zu überprüfen ist. Die Tätigkeit der Fachberater wird immer mehr zur Top – Down Veranstaltung.
Es wird letztendlich nicht der Unterricht in seiner Individualität wahrgenommen und gestärkt, stattdessen kommt es darauf an, dass er in ein vorgefasstes Schema hineinpasst. Das gilt dann auch für die Organisation und Durchführung von Prüfungen. Die Gewährleistung von formaler Vergleichbarkeit und das Verhindern von Möglichkeiten des Einspruchs scheint wichtiger zu sein als alles andere.
Auf Schulleitungsebene scheint sich ähnliches abzuspielen. Auf diese Weise werden sich die einzelnen Schulen immer ähnlicher, weil die immer enger gezogenen Rahmenbedingungen ja für alle Schulen gelten.
Es gibt aber auch nicht nur Vorzeigeschulleitungen. Wer unter solchen “Führungskräften” längere Zeit arbeiten und erleben musste, welche negativen Auswirkung solche Personen auf das Gesamtsystem einer Schule haben können, ist froh über jede zusätzliche Kontrolle durch eine Behörde.
Psst… es gibt auch nicht nur Vorzeige-Schulräte… 😉