BERLIN. Die Integration von Migranten macht in der EU und den Industriestaaten nach einer OECD-Studie deutliche Fortschritte, auch in Deutschland. Insbesondere Kinder holen auf. Das aktuelle Integrationsmonitoring der Bundesländer schlägt in die gleiche Kerbe – beschreibt aber auch Probleme bei der Bildung.

Die Integration von Migrantinnen und Migranten hat sich der Industriestaatenorganisation OECD zufolge in den vergangenen Jahren auf zahlreichen Feldern verbessert. In einer veröffentlichten Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der EU-Kommission werden etwa positive Entwicklungen am Arbeitsmarkt und bei der Bildung genannt. So erreicht mehr als die Hälfte der jungen Menschen in Deutschland mit mindestens einem im Ausland geborenen Elternteil ein höheres Bildungsniveau als seine Eltern. Unter den jungen Menschen, deren Eltern in Deutschland geboren sind, sind das nur etwa 30 Prozent. EU-weit ist der Trend gleich, die Werte für beide Gruppen liegen jedoch näher aneinander.
Die höheren Bildungsabschlüsse führen jedoch nicht zwangsläufig zu Erfolg. Innerhalb der EU sind fast ein Viertel der Menschen zwischen 25 und 34 Jahren mit einem im Ausland geborenen Elternteil für ihren Job überqualifiziert. In Deutschland ist ihre Zahl zwischen 2021 und 2020 deutlich zurückgegangen. Mittlerweile sind hierzulande besonders junge Menschen, die schon als Kinder eingewandert sind, für ihre Arbeit überqualifiziert.
Für Kinder von im Ausland geborenen Eltern gilt nach der OECD-Studie weiterhin ein höheres Armutsrisiko. Besonders ausgeprägt sind die unterschiedlichen Lebensbedingungen im Vergleich zu Kindern von im Land geborenen Eltern in Spanien, Schweden, Frankreich und den USA. In Deutschland ist das Armutsrisiko junger Menschen ohnehin kleiner als in den übrigen Ländern und der Unterschied zwischen Kindern von Migranten und im Land geborenen Eltern geringer, so die Studie. Generell gilt laut Integrationsmonitoring der Bundesländer: „Bundesweit liegt die Erwerbstätigenquote der Bevölkerung mit Migrationsgeschichte 2021 bei 66,6 %, im Vergleich zu 79,3 % bei der Gruppe ohne Migrationsgeschichte.“
Die OECD-Untersuchung kommt außerdem zu dem Schluss, dass in den EU-Ländern die öffentliche Wahrnehmung zum Beitrag von Migranten zur Gesellschaft im Gegensatz zu den verfügbaren Fakten steht. Während etwa der Anteil der Migranten von außerhalb der EU mit hohem Bildungsniveau steigt, wird diese Entwicklung in den meisten Ländern nicht wahrgenommen. Für Deutschland gilt laut aktuellem Integrationsmonitoring: „Im Bundesgebiet verfügt mehr als ein Drittel (34,3 %) der Bevölkerung mit Migrationsgeschichte über eine Hochschulreife. Dieser Wert liegt etwas höher als in der Bevölkerung ohne Migrationsgeschichte (32,5 %).“
„Ausländische Schülerinnen und Schüler der 8. Klassenstufe sind auch im Schuljahr 2021/2022 wie in den Vorjahren in sämtlichen Ländern an den Gymnasien unterrepräsentiert“
Außerdem ist die Öffentlichkeit in klassischen Einwanderungsländern davon überzeugt, dass die schulischen Leistungen von Migrantenkindern zurückgehen, während diese sich tatsächlich im vergangenen Jahrzehnt stark verbessert haben. So gab es bei der Pisa-Schuluntersuchung die größte Steigerung beim Schriftverstehen bei 15-jährigen Migrantenkindern nach den USA in Deutschland.
Trotzdem gibt es weiterhin hierzulande ein Gefälle bei den Bildungschancen, bei der gymnasialen Bildung jedenfalls. „Ausländische Schülerinnen und Schüler der 8. Klassenstufe sind auch im Schuljahr 2021/2022 wie in den Vorjahren in sämtlichen Ländern an den Gymnasien unterrepräsentiert“, so heißt es im aktuellen Integrationsmonitoring der Bundesländer.
Allerdings bieten insbesondere Gesamtschulen für Kinder mit Migrationshintergrund einen Zugang zu höherer Bildung. „In den Ländern Berlin, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig-Holstein bietet die Gesamtschule als Schulform große Chancen für ausländische Schülerinnen und Schüler, die sie überproportional häufig besuchen. In Ländern mit Hauptschulangebot wurde dieses deutlich häufiger von ausländischen Schülerinnen und Schülern genutzt als von deutschen. Am deutlichsten ist der Unterschied in Bayern, wo der Anteil der Hauptschülerinnen und Hauptschüler bei ausländischen Jugendlichen der 8. Klasse bei 64,5 % liegt, der Anteil bei Deutschen dagegen bei 26,3 %“, heißt es.
Andersherum gilt: „Ausländische Schülerinnen und Schüler verlassen 2021 deutlich öfter die allgemeinbildende Schule ohne Abschluss (d. h. nur mit einem Abgangszeugnis) als deutsche. Die höchsten Anteile liegen bei 28,4 % in Sachsen-Anhalt und 25,3 % in Thüringen, die niedrigsten finden sich in Brandenburg (10,3 %) und Hessen (12,7 %).“
Jeder fünfte Migrant in der EU, der selber nicht aus Europa stammt, fühlt sich nach eigenen Angaben diskriminiert. Überdurchschnittlich ausgeprägt ist die Diskriminierung demnach in Frankreich und Belgien, wo sich jeder dritte außereuropäische Migrant diskriminiert sieht. Weniger stark ausgeprägt ist Diskriminierung nach der OECD-Studie in den nordischen Ländern und in Irland. Während die Diskriminierung den Angaben nach in Frankreich und Belgien weiter angestiegen ist, ist sie in Deutschland und Österreich rückläufig. Erstaunlicher Punkt des Integrationsmonitorings: Zwar wird die Bildung in Deutschland generell kritisch gesehen. Menschen mit Migrationshintergrund zeigen sich allerdings zufriedener mit dem Schulsystem hierzulande als die ohne. News4teachers / mit Material der dpa
Hier geht es zum vollständigen Integrationsmonitoring der Bundesländer.









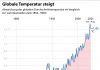
https://www.tagesspiegel.de/politik/man-kann-die-lage-nicht-aushalten-viele-schulen-sind-uberfordert-durch-die-enorme-zahl-gefluchteter-kinder-9958647.html
Das ist leider die andere Seite der Medaille.
In diesem Text wird auch der Grund dafür genannt, weshalb das sog. dreigliedrige Schulsystem nicht funktioniert, wenn man Integration will und diese von diesen Schüler*innen fordert. Im Gegenteil, es fördert die Segregation. Wenn in Bayern 64,5 % der Kids auf die Hauptschule gehen, dann wird Integration erschwert.
Auch wenn mich die Konservator*innen der guten alten Zeit gleich wieder downvoten … Ach ja, das geht ja zum Glück nicht mehr!
Im Ernst, ich finde zwar nicht, dass Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen per se gut laufen, jedoch könnten die Bundesländer mal ihre Arbeit richtig machen und die Bedingungen hier verbessern, anstatt uns andauernd neue “Lebensschulungsfächer”, die wir von gestern auf heute plötzlich aber ohne zusätzliches Personal auch noch unterrichten sollen, aufzudrücken, um irgendwelche gesellschaftlichen Defizite zu beheben.
Ich arbeite an einer sehr bunten Schule mit sehr vielen Kids mit Migrationshintergrund. In meiner Klasse sind Kids zehn verschiedener Ethnien.
Das Problem, das mich am allermeisten umtreibt, ist die Tatsache, dass Kids mit schlechten Deutschkenntnissen nicht gut genug gefördert wurden (in der GS) und auch bei uns nicht genügend Förderung erhalten. DaZ hört quasi nach der sechsten Klasse auf, weil die neu geschaffenen DaZ-Kapazitäten nur den Neuankömmlingen bereitgestellt werden. Mehr ist nicht möglich.
Ich unterrichte in der Oberstufe schlaue Schüler*innen, deren Leistungen nicht so gut sind, wie sie sein könnten, weil ihr Deutsch nicht so gut ist, sie aber etwas zu lange in Deutschland sind, als dass sie einen Anspruch auf Förderung bzw. einen Nachteilausgleich hätten.
Das mangelhafte Deutsch bedeutet hier bei uns in SH oft, dass viele dieser S*S nach der zehnten Klasse an eines der BBZ wechseln, wo sie dann in der Regel ihre Fachhochschulreife erlangen. Daher wundert mich die Überschrift jetzt auch nicht.
Wie sieht es aber mit dem Abitur an den allgemeinbildenden Schulen aus? Das kommt in dem Artikel nicht vor.
Generell muss es eine bessere Deutschförderung geben. Ab drei Jahren mMn., damit alle Kids bessere Chancen haben. Auch unserer Gesellschaft würde das gut tun, denn mehr Menschen könnten teilhaben und außerdem anspruchsvollere Arbeit verrichten.
Bessere Deutsch-Förderung = bessere Integration
Integration hört aber nicht bei den Deutschkenntnissen auf. Außerdem erschließt sich für Kinder die Notwendigkeit nicht, Deutsch zu lernen, wenn sie mit Türkisch, arabisch, Russisch, sonstwas auch durch kommen.
Das ist kein Gegenargument, Georg, sondern quasi eine Bestätigung dessen, was ich schreibe.
Auch wenn Sie das gar nicht realisiert haben.
Es fehlt nur leider eine realisierbare Vorgehensweise, eine für normal fleißige bis faule Schüler etwas durchzudrücken, worauf sie keine Lust haben, schon weil die Notwendigkeit nicht besteht. Kulturelle Differenzen erschweren das alles noch weiter.
Bitte pflegen Sie Ihre Vorurteile woanders.
Aber “Die wollen nicht, fertig,” ist ja schön einfach, weil man dann nie auch nur irgendwas für die tun muss.
Georg, Sie scheinen mir zu der Gruppe von Menschen zu gehören, die sämtliche Möglichkeiten, Integration zu verbessern, ablehnen.
Warum eigentlich? Damit Sie auch in Zukunft schön auf diesen Menschen herumhacken können?
Ich muss hier noch einmal auf die Upvotes reagieren:
Was sind hier eigentlich für Leute unterwegs, die so eine Aussage richtig finden?!
Gebt’s zu, ihr habt einfach Angst davor, dass ihr in Zukunft nicht mehr auf Menschen herumhacken könnt, was?
Ich sehe das anders:
Viele Kollegen erleben TROTZ aller Bemühungen um Deutschunterricht UND Integration täglich, dass Kinder (und ihre Eltern) zwar Forderungen stellen, aber nicht bereit sind, sich selbst zu engagieren oder auch nur bestehende Angebote anzunehmen. Das geht durch alle Ethnien. Viele kommen auch mit Vorstellungen von Schule, Lernen und Zusammenleben, die mit den Bedingungen und Erfordernissen an den Schulen und den Möglichkeiten der Lehrer unter Dauer-Mangelbedingungen wenig zu tun haben.
In den letzten 20 Jahren konnte man beobachten, wie das Anspruchsdenken auch bei vielen Migranten stieg, die Anstrengungsbereitschaft aber im gleichen Maße abnahm. Das hat nichts mit “herumhacken ” zu tun… ist einfach eine ehr frustrierende Beobachtung! In den letzten Jahren kommen auch immer mehr Kinder, die Lücken in ihrer Schulbildung und Bildungsfähigkeit haben – sei es aufgrund Corona und Schulschließungen in anderen Ländern, sei es durch Flucht oder Traumatisierung.
Kollegen, die Jahre/Jahrzehnte enorme Energie in die Integration gesteckt haben, sehen zunehmend, wie wenig Kooperationsbereitschaft (oder auch -fähigkeit?) von der Seite zahlreicher Familien kommt.
NATÜRLICH ist das bei weitem nicht bei allen der Fall!
Viele sind leistungsbereit und integrationswillig; leider gibt es aber immer mehr, die das nicht sind. Und in die stecken wir so viel Energie, um zu verhindern, dass sie komplett aus dem Ruder laufen und das ganze System crashen, dass für die besseren Schüler zu wenig über bleibt.
Übrigens: Lehrermangel überall – in diesem Bereich noch stärker, weil oftmals DaZ-Stunden nur unzuverlässig oder “nebenbei” stattfinden müssen, um andere Lücken zu füllen.
“… Viele Kollegen erleben TROTZ aller Bemühungen um Deutschunterricht UND Integration täglich, dass Kinder (und ihre Eltern) zwar Forderungen stellen, aber nicht bereit sind, sich selbst zu engagieren oder auch nur bestehende Angebote anzunehmen. …”
Das klingt, als fühlten Sie sich durch meine Posts irgendwie angegriffen.
Ich kritisiere aber nicht die Schulen und LK, sondern die Politik. Von daher müssen Sie sich nicht rechtfertigen und irgendwie versuchen, die Schuld auf die Kids und deren Eltern zu schieben.
Allerdings bin ich der Ansicht, dass es viel zu wenig Deutsch-Förderung gibt. Das liegt natürlich auch an den Kapazitäten. Jedoch ist auch von vornherein viel zu wenig vorgesehen (s. meinen anderen Beitrag).
Meiner Meinung nach sollte man in Kitas, Schulen usw. auch andere Arten der Deutsch-Förderung integrieren, für die man keine LK benötigt.
Außerdem: Wenn wir so argumentieren wie Georg, dann bräuchten wir eigentlich auch keine Schulpflicht, weil es ja auch Kinder gibt, die keine Lust haben, oder Eltern, die dagegen sind, und …
Georg ist in Bezug auf Menschen mit Migrationshintergrund sehr ungnädig und Sie assistieren ihm leider auch noch. Schade!
Der Schlüsselsatz ist hier “Das geht durch alle Ethnien”. Da haben sie Recht, denn dieses Anspruchsdenken kommt eben auch von den nicht migrierten, deutschen Kindern und Eltern.
Könnte es sein, dass es am Ende eben um (egoistische) Kinder (und Eltern) und nicht per se um “Migranten” geht?
Sie beschweren sich immer über Upvotes und Downvotes. Mal nachgedacht, ob sie mit ihrer Meinung vielleicht doch nicht in der Mitte der Gesellschaft stehen und viele Menschen gewisse Dinge einfach anders sehen?
News4teachers ist immer wieder Zielscheibe der Mobilisierung von Rechtsaußen (naturgemäß bei Themen wie Migration, Rassismus und Gleichberechtigung) – weshalb wir die Downvotes abgeschafft haben. Mit Repräsentativität hat das nichts zu tun.
Die Strategien sind bekannt: “Sich naiv, unpolitisch und ahnungslos stellen, z. B. Ausländerfeindlichkeit verharmlosen und mit rein persönlichen Erfahrungen begründen, bei argumentativem Widerspruch die „verfolgte Unschuld“ mimen, im weiteren Diskussionsverlauf immer offener die eigenen Standpunkte propagieren, durch ständigen Themenwechsel die Diskussion chaotisieren, bis alle rational argumentierenden „Gegner“ das Forum verlassen haben.” Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsextremismus_im_Internet
Gerne auch hier nachlesen: https://ethik-heute.org/rechte-radikalisierung-im-netz/
Repräsentativ zum Thema Migration sind diese Untersuchungen:
“Einer repräsentativen Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung 2019 zufolge ist die Mehrheit der befragten wahlberechtigten Deutschen Einwanderung gegenüber offen eingestellt. Besonders groß ist die Zustimmung zu Migration, die dem Fachkräftemangel entgegenwirken soll (63 Prozent). Die Hälfte der Befragten gab aber auch an, dass Migration das Land nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich und kulturell bereichere. Als größte Sorge im Hinblick auf Einwanderung nannten die Befragten einen möglichen Anstieg von Rechtsextremismus und rassistischer Gewalt.
Laut Autor*innen der Studie ist die Gesellschaft in der Frage der Migration weniger gespalten als oftmals angenommen. Etwa die Hälfte der Befragten positioniert sich in einer „beweglichen Mitte“: Sie sind offen für Einwanderung, sehen aber auch die Herausforderungen. Starke Befürworter*innen und vehemente Gegner*innen von Migration machen jeweils ein Viertel der Befragten aus.
Eine repräsentative Studie der Bertelsmann-Stiftung, die 2021 zum fünften Mal durchgeführt wurde, zeigt: Die Befragten stehen Migration weniger skeptisch gegenüber als in den vorherigen Umfragen; für immer mehr Menschen stehen die Chancen von Migration im Vordergrund.” Quelle: https://mediendienst-integration.de/integration/einstellungen.html
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Offensichtlich stehe ich doch in der Mitte der Gesellschaft. Danke @Redaktion!
Außerdem ist das, was ich fordere eigentlich nur vernünftig, oder nicht?
Das würde allen helfen. Auch Ihnen, Marc.
Ich bin einerseits froh, dass es Lehrer gibt, die solche verhältnismäßig positiven Erfahrungen beim thema Integration noch machen dürfen. Auf der anderen ist es scheinbar schwer vermittelbar, dass es durchaus an vielen Schulen schlechter geht, dass statt Schulemachen die Polizei vorbeikommen muss und dass jeglicher guter Willen der Lehrerseite mit Anspruchsdenken & Gehtmichnichtsan verhöhnt werden kann, weil ein Nichtmitziehen am gleichen Strang keine relevanten Konsequenzen hat.
Ich möchte nicht Rumhacken, ich möchte eine ehrliche Chance für alle… leider kann man Bildung nicht konsumieren, man muss können und man muss selber wollen (auch in der Familie). Und viele dürfen sich beim Nichtwollen “ausruhen”, inzwischen fasr ohne Konsequenz…es gibt teilweise nicht mal mehr die Chance auf Sitzenbleiben.
Das ist kein schönes Ausruhen und auch kein sinnvolles, es dürfte dieses Ausruhen gar nicht geben…weil es degenerativ wirkt. Den Kindern nimmt es die Chance auf Eigenmotivation und damit auf Zukunft.
? Und DESHALB ja Förderung möglichst früh.
Natürlich bringt es nichts, plötzlich in einer achten Klasse mit Problemfällen mit Deutsch-Förderung zu beginnen, um die auf den richtigen Weg zu bringen.
Ich verstehe euch nicht. Was ist denn die Konsequenz, wenn wir nichts tun? Wird dann irgendwas besser?
“Menschen mit Migrationshintergrund zeigen sich allerdings zufriedener mit dem Schulsystem hierzulande als die ohne”
Der letzte Satz ist der bezeichnende und entscheidende Punkt. Unse Schulsystem in Deutschland wird von allen Seiten schlechtgeredet. Natürlich gibt es auch kritische Aspekte, die man zurecht anprangern darf. Aber diese Aussage zeigt doch, was für ein Privileg wir haben – als Lehrkräfte, die wir Arbeitsmaterial und wetterfeste Gebäude haben. Aber auch Eltern sollten dankbarer sein, für das, was in den deutschen Schulen geleistet wird. Es ist absurd, dass gerade die, die von den nicht zerredbaren Ungerechtigkeiten im Bildungssystem weitgehend ausgenommen sind bzw. gar profitieren, dies am meisten anprangern und die Benachteiligten immer noch sehen, welche Qualitäten es hat.
Wer sich stets am Minimum orientiert, wird dieses irgendwann auch erreichen. Dann sind wir irgendwann froh, wenn es nicht durch das Schuldach regnet. Ein wenig mehr Anspruchsdenken halte ich für angebracht.
Aber was ist denn nun dran an den Behauptungen z.B. der GEW, dass gerade in Deutschland die Migrantenkinder durch unser Schulsystem so stark benachteiligt werden? In Frankreich und Belgien ist es nicht besser nach dem, was oben festgestellt wurde, und die haben nur Gesamtschulen. Gleichwohl schneiden in Deutschland nach den Schulleistungstests die Migrantenkinder immer recht schwach ab, wie passt das dazu?
Wenn doch so viele eine Hochschulreife haben, wieso haben wir einen Mangel an Fachkräften? Das sind ja Fachkräfte in Bereichen, in denen ein Hochschulstudium gar nicht unbedingt sinnvoll ist, eine gewisse Grundbildung aber sehr wohl.
Und welche OECD-Studie ist das genau? Im Internet gibt’s da eher eine gewisse Verwirrung mit zahlreichen Studien.
Hier ist der Link zur Studie: https://www.oecd.org/publications/indicators-of-immigrant-integration-67899674-en.htm
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Danke, aber das ist ein Wust von Daten auf über 300 Seiten. Ich kann nicht recht sehen, dass der obige Text das alles adäquat zusammenfasst.
Man spricht von den Anteilen von “low-educated” und “highly educated”, getrennt nach “native born” und “foreign born”, aber glaubt irgend jemand, dass das weltweit jeweils dasselbe bedeutet? Überhaupt wird offenbar “immigrant” als “foreign-born” interpretiert, z.B auf Seite 50. Für Deutschland wird dieser Anteil mit 15 % angegeben, mehr als in USA.
Innerhalb der EU gibt es eine ständige Migration. Wenn etwa rumänische Ärzte nach Deutschland kommen, weil sie hier mehr verdienen, dann verbessert das die Statistik für Deutschland, verschlechtert aber gleichzeitig die entsprechende Statistik für Rumänien. Ich konnte nicht sehen, wo das mal berücksichtigt wurde. Der Jubel über zugewanderte Fachkräfte hat generell als Gegenseite, dass diese dann in ihren Heimatländern fehlen.
Die Herkunftsregion, die bisherige Dauer des Aufenthalts in Deutschland, ggf. Geburt in Deutschland usw. muss man bei solchen Statistiken berücksichtigen. Schließlich ist die Gruppe der Migranten noch viel heterogene als die der Indigenen.
Diese verklausierte Abwertung von Menschen ist immer wieder erstaunlich Georg. Man merkt richtig, wie du jedes Mal versuchst, irgendwie noch so zu schreiben, dass man nicht direkt merkt, was in dir drin kocht.
Auf Heterogenität hinweisen ist jetzt genau wo eine Abwertung von Menschen?
Treffend festgestellt, danke @ SoBitter.
Es kommt noch eins dazu: Gerade der Aufenthalt einer heterogenen Migrantengruppe in einem bestimmten Gebiet fördert Spracherwerb und Integration, – mehr als wenn 10 Familien aus dem gleichen Dorf zusammen wohnen ( trotz der einschränkenden Faktoren Religion, Stammeszugehörigkeit etc.)
In sämtlichen Ländern an Gymnasien unterrepräsentiert? Liegt dann die MLU Halle, die in einigen BL sogar deutlich höhere Gymnasialquoten ermittelt hat völlig falsch?
https://pressemitteilungen.pr.uni-halle.de/index.php?modus=pmanzeige&pm_id=5465
https://www.news4teachers.de/2022/10/schueler-mit-migrationshintergrund-kommen-in-ostdeutschland-oefter-aufs-gymnasium-als-deutschstaemmige/
Auch wenn in Bayern der Anteil an Mittelschulen (Hauptschulen gibt es dort längst nicht mehr) höher sein mag, bei den IQB-Varianzaufklärungen 9. Klasse 2018 war m.W. in Bayern der Abstand zum Leistungsgrad von Schülern ohne Migrationshintergrund im BL-Vergleich nach Thüringen am niedrigsten. Berlin, Bremen, Hamburg , NRW und Schleswig Holstein lagen bei diesem Kriterium z.T. sehr deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.
Ein höheres Bildungsniveau als die Eltern erreichen…ist das ein sinnvolles Mass? NEIN.
Das Ausbildungssystem gibt es so nur in Deutschland…und es gibt erheblichen Zuzug von bildungsfernen Familien. Da es nun hier eine Schul- und Ausbildungspflich gibt, was wird passieren? Richtig, man wird zumindest eine Ausbildung machen und damit mehr Bildung erreichen als die eigenen Eltern ohne Ausbildung. Alle hier geborenen Eltern sollten mindestens eine Ausbildung haben, die kannman nur mit einem Studium überholen…das ist ein deutlich höherer Anspruch. Also was ein schwachsinniger Äpfel-Birnen-Vergleich.
Thema Internationale Klassen und Deutschkenntnisse:
Drei unserer IK Schüler gaben mir zu verstehen, dass sie erst “so richtig” die deutsche Sprache lernen, seitdem sie (nach ca. 2 Jahren IK) in den Regelklassen unterrichtet werden. In der IK sprachen sie vermehrt Englisch oder ihre Muttersprache.
Als Grund gaben sie an, dass sie in den Regelklassen “nun müssen” und der damit verbundenen Druck ihnen beim Lernen hilft. Außerdem hilft wohl das situative “Drauflossprechen” mit ggf. anschließender Korrektur mehr, als das Lernen über die Grammatik.
Hat jemand ähnliche oder gegensätzliche Erfahrungen gemacht?