MAGDEBURG. Jürgen Böhm war Lehrer, Schulleiter – und Bundesvorsitzender des Deutschen Realschullehrerverbands VDR. Heute ist er Staatssekretär im Bildungsministerium von Sachsen-Anhalt. Als solcher tritt er am 24. Oktober beim EdTech Next Summit 2024 in Bielefeld auf, dem Branchentreffen der Bildungswirtschaft. Im Fokus des Kongresses: digitale Unterstützungssysteme für die vom Lehrkräftemangel geplagten Schulen. Wir sprachen mit Böhm darüber, welche Impulse er sich von den Unternehmen erhofft, was der Stand bei den Verhandlungen zum Digitalpakt 2.0 ist und wie seine Traumschule aussieht.

News4teachers: Welche Voraussetzungen braucht aus Ihrer Sicht eine gute digitale Bildung?
Jürgen Böhm: Für mich ist der Begriff “digitale Bildung” schwierig. Wir sprechen entweder über Bildung mithilfe digitaler Medien oder über Bildung in digitalen Kontexten. Für mich ist Bildung einfach Bildung, und Digitalisierung ist Digitalisierung. Natürlich benötigen wir für eine gute Bildung, die digitale Medien einbezieht, eine solide technische Ausstattung an den Schulen. Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, sowohl in technischer Hinsicht und deren Anwendungsmöglichkeiten als auch in Bezug auf die Kompetenzen der Lehrkräfte. Digitale Medien sollten pädagogisch sinnvoll eingeführt und integriert werden können. Dafür braucht es gut ausgebildete Lehrkräfte. Für die Schülerinnen und Schüler sollte es gar nicht auffallen, ob der Unterricht digital oder analog stattfindet. Diese digitalen Formen müssen zur Normalität werden. Auch die Lehrpläne und Unterrichtseinheiten müssen entsprechend angepasst werden.
News4teachers: Gibt es nicht auch Inhalte, die spezifisch durch die Digitalisierung entstanden sind und sich direkt auf die Digitalität beziehen – wie etwa Medienkompetenz?
Der EdTech Next Summit (am 24. Oktober 2024 in Bielefeld) ist das führende Event für Bildungstechnologien in Europa. Die Konferenz bringt Start-ups, Investor:innen, Bildungsexpert:innen und politische Entscheidungsträger:innen zusammen und liefert Ein- und Ausblicke in den deutschen Bildungsmarkt.

News4teachers – Deutschlands meistgelesenes Bildungsmagazin – ist Medienpartner des EdTech Next Summit 2024. Das bedeutet, dass Newsteachers ausführlich über den Summit berichten wird.
Herausgeber Andrej Priboschek, Leiter der Agentur für Bildungsjournalismus, wird in Bielefeld vor Ort sein. Er spricht dort eine Keynote zum Thema “Strategische PR auf dem Bildungsmarkt” und steht auch als Ansprechpartner parat.
Weitere Referent:innen sind (unter vielen anderen): Jens Brandenburg, Staatssekretär im Bundesbildungsministerium, Ralph Müller-Eiselt Vorstand des Forum Bildung Digitalisierung, Philologen-Landeschefin Sabine Mistler und Anja Hagen, Vorsitzende des EdTech-Verbandes. edtechnext-summit.com
Böhm: Für mich ist es auch eine Voraussetzung, dass wir inzwischen Inhalte und Fächer geschaffen haben, die sich mit digitalen Entwicklungen beschäftigen. Aber das betrifft nicht die Art und Weise, wie diese Inhalte vermittelt werden. Informatik oder Medienbildung sind zum einen eine zentrale bzw. fächerübergreifende Aufgabe und zum anderen sind diese Themen in den Fächern verankert, die mittlerweile, denke ich, in allen Bundesländern eingeführt wurden. Ich streite mich auch schon lange nicht mehr darüber, ob das Fach nun Informatik oder Informationstechnologie heißen muss. Persönlich bevorzuge ich eher fächerübergreifende Ansätze, die diese digitale Entwicklung abbilden. Aber wenn wir über digitale Bildung sprechen, sehe ich das als eine Rahmenbedingung, und würde das Fach Informatik oder Informationstechnologie nicht direkt darunter einordnen.
News4teachers: Wie ist der aktuelle Stand bezüglich der Digitalisierung von Schulen in Sachsen-Anhalt? Was läuft schon gut und wo gibt es Herausforderungen?
Böhm: Wir sind auf einem guten Weg. Dieser Prozess ist natürlich nie abgeschlossen. Wir haben jedoch einige wichtige Meilensteine erreicht: 99 Prozent unserer Schulen sind ans Netz angeschlossen. Wir haben bedeutende Schritte zur Umsetzung der Digitalisierung eingeleitet. So haben wir alle Lehrkräfte und 30.000 Schüler*innen mit digitalen Endgeräten ausgestattet. Als Land haben wir begonnen, diese Geräte zentral zu verwalten. In dieser Hinsicht sind wir schon weit vorangekommen.
Wir haben zudem digitale Projektionsmöglichkeiten in Klassenzimmern geschaffen. Ein Landkreis im Süden unseres Bundeslandes beispielsweise hat alle Schulen mit digitalen Tafeln und Projektionssystemen ausgestattet. In den anderen Landkreisen sind wir auf dem richtigen Weg. Für mich sind jedoch die strukturelle Bildung und die Kompetenzvermittlung an die Lehrkräfte viel wichtiger. Es geht darum, unsere Lehrkräfte für den digitalen Unterricht und die damit verbundenen Möglichkeiten zu sensibilisieren und zu qualifizieren.
Wir haben sogenannte Digitalassistenten eingeführt – eine beachtliche Gruppe von Fachleuten, die die Schulen unterstützen. Derzeit sind es 70 im gesamten Land. Diese Gruppe führt auch Fortbildungen durch und steht den Schulen zur Verfügung, um bestimmte Maßnahmen umzusetzen. In dieser Hinsicht sind wir meiner Meinung nach einigen anderen Bundesländern voraus, da wir systemisch denken und die digitalen Möglichkeiten pädagogisch sinnvoll in den Schulen einsetzen. Wir verfolgen Digitalisierung nicht um ihrer selbst willen, sondern weil wir sie als dringende Aufgabe für die gesamte Bildungskette sehen – sei es im Deutschunterricht, im Sozialkundeunterricht oder in der politischen Bildung.
Darüber hinaus haben wir in unserem Bildungsinstitut LISA in Halle ein eigenes Referat „Leben und Lernen in der Digitalität“ geschaffen. Wir beschäftigen uns intensiv mit den erforderlichen Grundstrukturen, um diese in den Schulen zu implementieren. Aktuell erarbeiten wir eine „Lernwelt Sachsen-Anhalt“, die klar auf digitale Möglichkeiten setzt. Dabei binden wir auch Ideen aus der Bildungswirtschaft und der Technologiebranche ein, um den Unterricht zu verbessern.
News4teachers: Eine digitale Infrastruktur allein reicht nicht aus, um moderne Unterrichtskonzepte umzusetzen. Wie können aus Ihrer Sicht Lehrkräfte bereits in Ihrer Ausbildung adäquat auf den digitalen Unterricht vorbereitet werden?
Böhm: Der Umgang mit digitalen Medien und die Nutzung digitaler Möglichkeiten müssen bereits in der ersten Phase der Lehrkräfteausbildung verankert werden. Dazu gibt es auch Gespräche mit den Universitäten. Ich habe kürzlich ein Gespräch mit der Universität Halle geführt, in dem es darum ging, bestimmte Unterrichtsformen in die Didaktik zu integrieren. Das darf nicht erst irgendwann einmal geschehen, sondern muss eine grundlegende Voraussetzung in der ersten Phase der Lehrkräfteausbildung sein.
Ich bin ein großer Befürworter von Edulabs. Diese bieten hervorragende Möglichkeiten für Erprobungen. Schon vor einigen Jahren gab es an der Universität Bayreuth solche EduLabs, in denen Studierende sich gezielt mit den Potenzialen der Digitalisierung auseinandersetzen konnten. Für mich ist das eine Grundvoraussetzung einer jeden Lehrkraft.
Eine wichtige Rolle spielt der ständige Prozess während der Dienstzeit, also in der Lehrkräftefort- und Weiterbildung. Auch hier muss der Fokus verstärkt auf die Digitalisierung gelegt werden. Daran arbeiten wir bereits. Ich denke, dass dies neben der Vorbereitung auf das Studium oder im Studium selbst der zentrale Inhalt sein muss.
“Ich halte Start-ups und digitale Unternehmen, die sich intensiv mit der sinnvollen Anwendung von Wissensvermittlung im digitalen Bereich beschäftigen, für enorm wichtig, um neue Impulse in die Bildung zu bringen”
News4teachers: Was muss aus Ihrer Sicht passieren, um den Digitalpakt 2.0 voranzutreiben? Wie könnte die Kommunikation zwischen Bund und Ländern verbessert werden, um den Prozess zu beschleunigen?
Böhm: Es gibt einige grundlegende Überlegungen, die hier eine Rolle spielen. Ich halte die Finanzierung des geplanten Digitalpakts im Verhältnis 50/50 zwischen Bund und Ländern für sehr schwierig. Ein zentraler Diskussionspunkt sind die sogenannten Anrechnungsmöglichkeiten. Wir brauchen diesen Digitalpakt 2.0 in den Ländern dringend, der den ersten Digitalpakt ablösen muss. Die Gespräche laufen, und sie werden teilweise kontrovers geführt. Wir sind aber meiner Meinung nach auf einem guten Weg.
Ich hoffe, dass es bald eine Einigung geben wird. Der Zeitpunkt ist ja bereits festgelegt. Nach Aussagen des Bundesbildungsministeriums soll der neue Digitalpakt 2025 in Kraft treten. Das ist nicht mehr allzu lange hin. Es gibt jedoch noch einige grundlegende Fragen, die geklärt werden müssen. Ich bin der Meinung, dass es jetzt enorm wichtig ist, Tempo in diesen Prozess zu bringen. Es geht auch darum, den Ländern und den Schulträgern eine gewisse Planungssicherheit zu geben. Etwas in der Schwebe zu lassen, wäre einfach nicht zeitgemäß und würde den aktuellen Erfordernissen nicht gerecht werden.
News4teachers: Sie sprechen am 24. Oktober beim EdTech Next Summit in Bielefeld. Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht die Bildungswirtschaft, Start-ups im Besonderen, bei der Digitalisierung der Bildung?
Böhm: Ich halte Start-ups und Unternehmen, die sich intensiv mit der sinnvollen Anwendung von Wissensvermittlung im digitalen Bereich beschäftigen, für enorm wichtig, um neue Impulse in die Bildung zu bringen. Für mich ist das ein wesentlicher Faktor, da es nicht möglich ist, alles an den Schulen ausschließlich mit eigenen Mitteln zu bewältigen. Deshalb bin ich ein großer Befürworter des intensiven Austauschs mit diesen Unternehmen und den Kolleginnen und Kollegen, die sich wirklich Gedanken darüber machen, wie man Bildung an die Erfordernisse der neuen Zeit anpasst und die Bedürfnisse umsetzt.
Es ist wichtig, dabei stets zu prüfen, wie die Ansätze der Unternehmen in die Bildungsüberlegungen und das Bildungssystem des jeweiligen Bundeslandes passen. Hier ist es entscheidend, offen miteinander zu kommunizieren und klare Regeln festzulegen, wie die Software und Ideen genutzt werden können. In diesem Sinne sind wir sehr offen und werden beim Aufbau unserer Lernwelt Sachsen-Anhalt auf solche Start-ups, Unternehmer und ihre klugen Ideen zurückgreifen.
News4teachers: Ist diese Wertschätzung, die Sie hier zum Ausdruck bringen, unter den Kultusministerinnen und Kultusministern weit verbreitet? Es werden fröhlich Lösungen entwickelt, obwohl es aus der Bildungswirtschaft längst fertige und marktreife Angebote gibt – sei es Schulplattformen oder, wie wir unlängst berichtet haben, ein Screening-Verfahren für Kinder vor der Einschulung. Wie kann das sein? Warum glaubt der Staat, dass er es besser kann als Unternehmen, die solche Lösungen vielleicht sogar in Zusammenarbeit mit Schulen entwickelt haben?
Böhm: Das meine ich mit Kommunikation. Das muss geklärt werden. Ich glaube, man sollte eine klare Marktanalyse vornehmen und sich überlegen, in welchem Bereich das größere Potenzial liegt. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Ich bin der Meinung, dass man das Rad nicht ständig neu erfinden muss, und ich bin überzeugt, dass wir im Bildungsbereich teilweise auch nicht die Kapazitäten haben, um selbst entwickelte Lösungen anzubieten.
Wir befinden uns im freien Spiel der Ideen, und diese sollte man nutzen. Das ändert nichts an der grundsätzlichen Bildungsstrategie, die man als Ministerium oder Land verfolgt. Es muss einfach passen. Es mag sein, dass an staatlichen Lösungen gearbeitet wird, aber man muss immer abwägen, welche Lösung besser geeignet ist.
Deshalb sehe ich es als sehr wichtig an, solche Ansätze zu unterstützen. Ich habe persönlich auch Start-ups unterstützt. Ich bin zuversichtlich, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren in die richtige Richtung bewegen wird. Wir werden es nicht schaffen, diese Aufgaben zu bewältigen, ohne die Unterstützung der Bildungswirtschaft.
“Doch Start-ups und EdTech-Unternehmen werden ihren Platz finden. Ohne sie kommen wir nicht weiter”
News4teachers: Welche Themen möchten Sie auf dem EdTech Next Summit adressieren? Haben Sie eine konkrete Botschaft?
Böhm: Ich bin schon einige Jahre in diesem Bereich tätig und bin fest davon überzeugt, dass man auf dem EdTech Next Summit deutlich machen muss, dass wir im Bildungsbereich, bei der Gestaltung von Bildung, diese Unterstützung und Ideen brauchen. Man darf sich nicht zurückdrängen lassen und sollte den Mut nicht verlieren. Ich möchte dazu ermutigen, mit den Ministerien und dem Bildungsbereich zusammenzuarbeiten, um die besten Lösungen zu finden und auf neueste Entwicklungen besser reagieren zu können. Darin sehe ich das große Potenzial der Start-ups im Bildungsbereich.
Wir müssen allerdings die rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechend beachten – etwa datenschutzrechtliche Aspekte oder die Vorschriften für Ausschreibungen. Unabhängig davon bleibt die Hoheit über die Bildung immer beim jeweiligen Land. Doch Start-ups und EdTech-Unternehmen werden ihren Platz finden. Ohne sie kommen wir nicht weiter. Diese Unternehmen spielen eine zentrale Rolle dabei, uns bei der Gestaltung der Bildung zu unterstützen. Ich würde sagen: Jeder, der Innovationen der Unternehmen nicht nutzt, vergibt die Chance auf eine bessere Bildung im Land.
News4teachers: Wenn Sie sich Ihre Traumschule der Zukunft vorstellen: Wie würde diese aussehen?
Böhm: Ich selbst war 13 Jahre lang Schulleiter. Man hat immer das Gefühl, Traumschulen zu entwerfen und zu entwickeln. Ich denke, dass eine Traumschule der Zukunft viel mit Raum zu tun hat. Es sollte ein Gebäude sein, das offen, hell und großzügig ist, sodass es den jungen Menschen viel Platz bietet und verschiedene Unterrichtsformen zulässt. Flexible Räume sind entscheidend. Eine vollständige Digitalisierung ist für mich selbstverständlich. Die Schule der Zukunft ist vernetzt, und zwar vollständig. Die Form dieser Vernetzung muss zum pädagogischen Konzept der Schule passen. Sie sollte aber auch andere Möglichkeiten bieten, z.B. die Vernetzung mit der Wirtschaft
In einer Traumschule der Zukunft müsste es auch Bereiche geben, in denen die Schüler*innen haptisch arbeiten können, handschriftlich, kreativ, handwerklich.
Ich stelle mir flexible Präsentationsmöglichkeiten vor, Kommunikationsbereiche für Lehrkräfte und Schüler*innen, klare Zuordnungen und eine Atmosphäre, in der die Schülerinnen und Schüler gerne lernen. Sie sollten die Möglichkeit haben, den ganzen Tag in der Schule zu verbringen, mit Betreuungsmöglichkeiten am Vormittag, einer Mensa und Räumen für die Ganztagsbetreuung.
Es gibt viele Aspekte, die man in so einer Traumschule berücksichtigen könnte. Ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit solchen Gedankenspielen, wie eine Schule aufgebaut sein sollte. Die Möglichkeiten werden immer größer. Was mich allerdings ärgert, ist, dass uns oft die finanziellen Mittel für den Schulbau fehlen. Wir dürfen als Gesellschaft nicht an den Schulen sparen, sondern müssen investieren, um Lern- und Begegnungsräume zu schaffen, in denen sich junge Menschen wohlfühlen.
Ich hatte zwischen 2005 und 2018 die Gelegenheit, eine Schule zu bauen. Damals habe ich viele Ideen gemeinsam mit Kolleg*innen und Trägern entwickelt. Es gelingt einem natürlich nicht immer alle Ideen zu verwirklichen, weil man auf Rahmenbedingungen achten muss. Die Veränderungen im Schulsystem der letzten Jahre, besonders durch Corona, haben uns gezeigt, wie wichtig digitale Kommunikationsmöglichkeiten sind. Wir müssen all das sinnvoll einsetzen. Der Satz „Digitalisierung folgt der Pädagogik“ gilt mehr denn je. Digitalisierung darf nie Selbstzweck sein. Wir müssen uns fragen, warum wir moderne Medien brauchen und wie sie zur Gesundheit unserer Kinder beitragen können. Zu viel Bildschirmarbeit darf nicht die Zukunft sein, und auch über gesundheitserhaltende Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung müssen wir nachdenken.
Für unsere Schulen wünsche ich mir, dass die Lehrkräfte ergonomisch arbeiten können und dass auch die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler im Vordergrund steht. Am liebsten wären mir höhen- und neigungsverstellbare Einzeltische. Wir sollten auch an vielen verschiedenen Orten arbeiten können, zum Beispiel in einem grünen Klassenzimmer, auf Fluren oder in Begegnungsräumen. Diese Vielfalt muss gegeben sein. Wenn z.B. Schülerinnen und Schüler im Grünen auf der Wiese liegen und Bücher lesen, dann ist das für mich ein hervorragendes Beispiel für eine Schule der Zukunft. Nina Odenius und Andrej Priboschek führten das Interview.
Der EdTech Next Summit 2024: Das Branchentreffen der Bildungswirtschaft







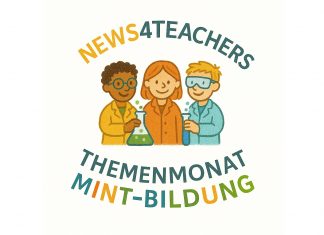


Gut, dass es den Digitalpakt 2.0 gibt, der die Innovationen der Unternehmen auch bezahlt. Sonst müsste man das ja vom kargen Etat abzwacken und andere Dinge dafür unter den Tisch fallen lassen. Puh … Glück gehabt.
Selbst wenn es den Digitalpakt 2.0 geben sollte/wird: Nach dem Digitalpakt ist bekanntlich vor dem Digitalpakt.
Die Geräte haben eine Halbwertszeit von wenigen Jahren. Es reichen ja schon Software-Aktualsierungen, die nicht mehr unterstützt werden usw. Was passiert also, wenn die iPads, Beamer, digitalen Tafeln, Sensoren usw. nicht mehr funktionieren?
Werden wir alle 3-5 Jahre neue Diskussionen über einen neuen Digitalpakt führen (müssen)?
Oder wird man irgendwann feststellen, dass man den jährlichen Etat der Schulen so erhöhen muss, dass davon die Technik und deren Erneuerung bezahlbar ist?
“Es reichen ja schon Software-Aktualsierungen, die nicht mehr unterstützt werden usw.”
Oder die das System unbenutzbar machen. Es scheint, als ob die Hardware bewusst so knapp dimensioniert wird, dass sie beim Verkauf alle Anforderungen erfüllt, aber nach ca. 2 Updateschleifen einige Dinge unbenutzbar macht. Ist mit unseren interaktiven Tafel schon passiert. Da kann man den integrierten PC für viele Dinge mittlerweile vergessen, nur die Software, die direkt auf der Tafel läuft (und deutlich weniger kann) funktioniert noch gut. Kennt man ja von den Smartphones, diese Strategie.
“Oder wird man irgendwann feststellen, dass man den jährlichen Etat der Schulen so erhöhen muss, dass davon die Technik und deren Erneuerung bezahlbar ist?”
Die Kostenentwicklung in Unternehmen bietet hier einen guten Ansatz. Jährliche Kostensteigerungen von 10-20% für den IT-Bereich (Hardware, Software, Support, Personal) sind üblich.
Genau aus diesem Grubd haben wir nur Beamer und Whiteboards umdrehbar als Kreidetafeln….nix Updates…..alles gut
Wenn das alles nicht mehr funktioniert – Jubel! – dann erhöhen wir ad hoc und mit Begeisterung den Anstieg des Elektroschrott-Mount-Everests und kurbeln gleichzeitig die Wirtschaft an, die uns neue Dinger verkauft, die wir nach drei/vier Jahren wieder verschrotten.
Was ist das nur für ein schräges, umweltzerstörendes Denken und Handeln?
Völlige Zustimmung bezüglich der Folgen.
Wenn wir erstmal unseren Unterricht komplett umgestellt haben werden, wird es m.E. kaum noch ein Zurück geben:
Dann siegt Bequemlichkeit (wer will schon zurück zu Büchern und Kopien?), dann werden Gelder eingefordert, dann werden alle die 3-5 Jahre neue Geräte gekauft und die alten Geräte als Elektroschrott entsorgt. Den Energiebedarf für die Herstellung, den Betrieb und die Entsorgung sollte man auch nicht vergessen.
Für die Firmen gleich mehrfach attraktiv:
Regelmäßig planbare Einnahmen durch die Schulen und wer bspw. in der Schule mit einem iPad aufwächst, kauft vermutlich auch eher ein iPhone oder ein anderes Apple-Produkt…
Estland gilt doch als Inbegriff der Digitalisierung, aber aus Lettland hört man dieses:
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/lettland-schule-handyverbot-100.html
Vielleicht muss ja nicht die ganze Welt “im Gleichschritt” dasselbe machen.