DÜSSELDORF. Vor fast genau fünf Jahren begann mit der Entscheidung zu ersten Schulschließungen eine der größten Herausforderungen im Bildungsbereich der letzten Jahrzehnte. Zum Jahrestag des ersten Corona-Lockdowns ziehen eine Elternvertretung und eine Bildungsinitiative aus Nordrhein-Westfalen gemeinsam Bilanz.

Die plötzliche Schließung der Schulen traf Lehrende, Lernende und Eltern gleichermaßen unvorbereitet. Viele Schulen standen vor der Herausforderung, den Unterricht digital fortzusetzen – ein Ziel, das sich in vielen Fällen als schwierig und unzureichend umsetzbar herausstellte.
Meint jedenfalls Harald A. Amelang, Vorsitzender der Landeselternschaft der integrierten Schulen (LEiS) in NRW. „Die Schulschließungen haben in aller Deutlichkeit die Defizite im Bildungssektor aufgezeigt. Vor allem die ungleiche Ausstattung von Schulen und Schüler:innen in Bezug auf digitale Endgeräte und Internetzugang war ein zentrales Problem“, meint er. „Zudem mussten sowohl Lehrkräfte als auch Schüler:innen und Eltern schnell neue Formen des Lernens und der Kommunikation entwickeln, was nicht immer erfolgreich gelang.“
Doch es gab ihm zufolge auch positive Entwicklungen: „Viele Lehrer:innen entwickelten innovative digitale Unterrichts- und Prüfungsformate, die sich auch nach der Pandemie als wertvolle Ergänzung zum klassischen Unterricht etablierten. Das digitale Lernen, das zunächst als Notlösung begann, hat somit in vielen Bereichen nachhaltige Veränderungen angestoßen.“
„Die Auswirkungen der Schulschließungen sind nach wie vor nicht vollständig aufgeholt“, so Sandra Noa von der Initiative „Bildungswende jetzt!“. „Vor allem die Ungleichheit im Zugang zu digitalen Lernressourcen und die sozialen Benachteiligungen, die während der Pandemie noch weiter verschärft wurden, erfordern eine konsequente und nachhaltige Auseinandersetzung. Viele Schülerinnen haben einen erheblichen Bildungsrückstand erlitten, der auch in den letzten Jahren nicht aufgeholt werden konnte.“
Zudem bleiben Familien, die Schwierigkeiten hatten, den veränderten Alltag zu bewältigen, weitgehend allein gelassen. Sozialpädagogische Unterstützung und aufsuchende Begleitung fehlten fast gänzlich. Für Kinder und Familien mit erhöhtem Infektionsschutzbedarf gebe es bis heute kaum Konzepte, wie sie in ihrem sozialen Klassenverbund als auch an Bildungsinhalte angebunden werden können. Es bedürfe einer breiten und systematischen Aufarbeitung der Pandemiefolgen. Ein zentraler Aspekt sei die Förderung von Chancengleichheit – auch bei der Digitalisierung der Bildung.
„Wir haben während der Pandemie erlebt, wie wichtig es ist, flexibel und innovativ zu sein. Diese Fähigkeit zur Anpassung müssen wir auch in die Zukunft tragen“
Fünf Jahre nach dem ersten Lockdown sei das digitale Lernen zwar ein zentraler Bestandteil des schulischen Alltags, werde jedoch nur teilweise flächendeckend umgesetzt. „Auch wenn in vielen Schulen Fortschritte erzielt wurden, zeigt sich weiterhin, dass digitale Infrastruktur und die digitale Kompetenz von Lehrkräften sowie Schüler:innen nicht überall auf einem gleich hohen Niveau sind. Hier muss kontinuierlich investiert und ausgebaut werden“, so fordern die Organisationen. Bedarfsgerechte hybride Unterrichtsformate sollten als Chance gesehen werden für alle, die aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Ort in der Schule sein können.
„Wir haben während der Pandemie erlebt, wie wichtig es ist, flexibel und innovativ zu sein. Diese Fähigkeit zur Anpassung müssen wir auch in die Zukunft tragen“, so Amelang. „Die Pandemie hat gezeigt, dass das Bildungssystem nicht starr, sondern dynamisch auf Veränderungen reagieren muss. Dabei darf der Fokus nie ausschließlich auf der Digitalisierung liegen, sondern es muss grundsätzlich die soziale Dimension von Bildung berücksichtigt werden.“
Zu den Aufgaben für die Politik gehören demnach: „eine konsequente Förderung der digitalen Bildung, die Überwindung sozialer Ungleichheiten, die Verbesserung des Gesundheitsschutzes in Bildungseinrichtungen sowie die Stärkung der Lehrer:innenbildung und die Erhöhung des Personalschlüssels, um den Anforderungen der modernen Bildung gerecht zu werden“. News4teachers


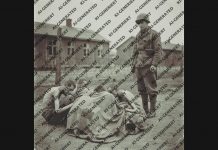







“Es bedürfe einer breiten und systematischen Aufarbeitung der Pandemiefolgen. Ein zentraler Aspekt sei die Förderung von Chancengleichheit – auch bei der Digitalisierung der Bildung.”
5 Jahre und manchmal denke ich: ob wir gelernt haben ? und wenn dann was ? – das nächste Mal nicht mehr ohne erwiesen nüzliche Maßnahmen weiterzumachen ?
Hoffentlich ist da wirklich Zeit zur Aufarbeitung, denn das Camphill – Virus scheint nicht ohne zu sein.
https://thedailyguardian.com/medically-speaking/camp-hill-virus-a-new-threat-to-humanity/
https://www.aend.de/article/233391
Ich habe hier noch mal einen interessanten Link, der die Wirksamkeit der Massnahmen ein wenig praxisnah beleuchtet:
https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Corona-Massnahmen-Was-haben-Isolation-Masken-und-Co-gebracht,coronavirusupdate274.html
Auszüge hieraus:
Masken – lästig oder wirksam? Die britische Royal Society hat auch Beobachtungsstudien aus verschiedenen Ländern zum Tragen von Masken ausgewertet. Bei allen Unschärfen wie unterschiedlichem Studiendesign oder dem Zusammenwirken mit anderen Maßnahmen deutet die Evidenz darauf hin, dass eine Maskenpflicht mehr bringt als freiwilliges Maskentragen und dass FFP2-Masken besser wirken als einfache OP-Masken. Die Braunschweiger Bioinformatikerin Alice McHardy stellt fest: Die Pflicht zum Maskentragen an öffentlichen Orten wie Bus und Bahn hatte einen deutlichen Effekt auf die Eindämmung des Infektionsgeschehens.
…
Epidemiologe zu Masken: Am effektivsten unter Laborbedingungen Entscheidend ist dabei natürlich, dass Masken korrekt getragen werden. Auf dieses Problem weist der Epidemiologe Philipp Wild hin, der die Gutenberg-Gesundheitsstudie und die Covid-19-Studie an der Universitätsmedizin in Mainz leitet: “Das Maskentragen selbst ist effektiv, wenn Sie unter Laborbedingungen die Maske sauber tragen, Ihren Mund und Nase damit sauber abdecken, wenn Sie sie regelmäßig austauschen, nicht in der Hosentasche tragen, nicht die Innenseite mit den Händen berühren, dann haben Sie einen Schutz“, sagt er. Auf Bevölkerungsebene sei das aber oft nicht so gewesen. Das mag auch an mangelnder Aufklärung über die korrekte Handhabung gelegen haben.
Wild stellt jedenfalls fest, dass auf den Intensivstationen die Viruslast beim Personal deutlich geringer gewesen ist als beim Rest der Bevölkerung, “trotz der Tatsache, dass sie dort tagtäglich Menschen mit Sars-CoV-2-Infektionen ausgesetzt waren”.
— Ende Auszüge —
Und hier liegt genau der Haken – wenn sie wie im Artikel erwähnt unter Laborbedingungen getragen werden, kann auch ich mir irgendwann eine Effizienz vorstellen. Laborbedingung bedeutet dass dieses auch sehr strikt angewendet werden muss und keinerlei Fehler zu keinem Zeitpunkt zulässig sind – ansonsten kann man sich das Ganze insbesondere bei jeglichen Treffen von Personengruppen in geschlossenen Räumen sparen und muss den Weg über Kontaktvermeidung gehen, wenn man hier eine Eindämmung vornehmen möchte. Ich stelle mir in einer Standard-Schulstunde vor, wenn von 45 Minuten Unterricht 40 Minuten davon aufgewendet werden müssen, das korrekte Tragen einzufordern, zu kontrollieren und Verstösse zu sanktionieren… Und zudem bewirken Maskenpflichten auch ein Ändern des Verhaltens, dass z.B. weniger Personen den ÖPNV nutzen. Dann hat die Maskenpflicht hier eine Sekundärwirkung, nämlich Eindämmung durch Kontaktvermeidung anstatt Eindämmung durch den eigentlichen unter Laborbedingungen erwiesenen erreichbaren Schutz.
… und im Zuge einer angemessenen Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen dürfen nicht die überproportional gehört werden, die das Prinzip des Präventionsparadoxons nicht verstanden haben oder es trotz besseren Wissens konsequent ignorieren.
z.Z. deutet sich an vielen Stellen der Debatte genau so etwas an – was eine faire Bewertung der damaligen Entscheidungen massiv verfälscht.