BERLIN. Das heute veröffentlichte Deutsche Schulbarometer 2025 der Robert Bosch Stiftung zeichnet ein alarmierendes Bild: Eine von drei Lehrkräften fühlt sich mehrmals pro Woche erschöpft. Als größte Herausforderung nennen die Befragten das Verhalten der Schülerinnen und Schüler – dicht gefolgt von Arbeitsbelastung, Zeitmangel und Heterogenität der Klassen (News4teachers berichtete). Gleichzeitig verweisen die Ergebnisse der Online-Umfrage unter mehr als 1.500 Lehrkräften auf Nachholbedarfe in Sachen Demokratiebildung und Künstliche Intelligenz. Die Reaktionen aus Verbänden und Gewerkschaften fallen entsprechend deutlich aus – mit klaren Appellen an die Politik.

Übereinstimmend stützen die Lehrkräfteverbände und -gewerkschaften das Umfrageergebnis, wonach die zunehmende Zahl auffälliger, unkonzentrierter oder psychisch belasteter Schüler*innen eines der drängendsten Probleme im Schulalltag darstellt. „Lehrkräfte allein können die Vielzahl an sozialen, emotionalen und unterrichtlichen Aufgaben nicht mehr leisten“, warnt etwa Torsten Neumann, Vorsitzender des Verbands Niedersächsischer Lehrkräfte (VNL), und fordert einen deutlichen Ausbau des schulpsychologischen Dienstes und der Schulsozialarbeit sowie multiprofessionelle Teams an allen Schulen. „Wir brauchen dringend mehr Unterstützung für alle an Schule Beteiligten.“
Ähnliche Forderungen stellt auch der Verband Deutscher Realschullehrer (VDR). Dessen Vorsitzender Ralf Neugschwender betont: „Wir brauchen deutlich mehr Schulpsychologen, Schulsozialarbeiter und multiprofessionelle Teams.“
RLV: Verhaltensauffälligkeiten durch Überforderung
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) macht sich vor diesem Hintergrund und den Befunden zum Belastungsempfinden der Lehrkräfte für „gesunde Schulen“ stark. „Das Wohlbefinden der Lehrenden und Lernenden wie auch die Arbeitsbedingungen müssen endlich zu Kriterien für Schulqualität werden“, sagt Vorstandsmitglied Anja Bensinger-Stolze. Sie fordert unter anderem Gefährdungsbeurteilungen, Entlastung durch mehr Personal und eine Senkung der Unterrichtsverpflichtung.
Einen anderen Lösungsansatz verfolgt derweil der Realschullehrerverband Baden-Württemberg (RLV BW). Dieser sieht vor allem in der mangelnden Differenzierung des Schulsystems eine Ursache der Problemlage. Landesvorsitzende Karin Broszat kritisiert: „Verhaltensauffälligkeiten belasten nicht nur die Lehrkräfte, sondern vor allem die Kinder selbst und die Eltern.“ Sie entstünden „überdurchschnittlich oft“ durch Überforderung in zu heterogenen Klassen. Broszat fordert daher ein „vielfältiges, sinnvoll gegliedertes Schulsystem“, das unterschiedliche Leistungsvoraussetzungen besser berücksichtigt.
Einigkeit im Bereich der Demokratiebildung
Einigkeit unter den Lehrkräftevertretungen herrscht auch beim Thema Demokratiebildung. Sie fordern, dieser zentralen Aufgabe schulischer Arbeit mehr Raum und mehr Zeit zu gewähren. „Demokratiebildung findet in den Schulen zu spät, zu wenig und vor allem kaum auf den Unterricht und die Schule selbst bezogen statt“, kritisiert GEW-Vorstandsmitglied Bensinger-Stolze. Sie plädiert nicht nur für mehr Zeit im Schulalltag, sondern auch eine strukturelle Verankerung im Curriculum und mehr Beteiligungsformate für Schüler*innen.
Der VDR formuliert ähnlich: „Demokratiebildung brauche Zeit, Raum und feste Verankerung im Schulalltag“, so Ralf Neugschwender. Schülerinnen und Schüler müssten ihre Schulzeit als „selbstwirksam erleben und aktiv mitgestalten können. Nur so stärken wir nicht nur das Wissen über unsere Demokratie, sondern auch das demokratische Handeln im Alltag.“
Auch der Deutsche Lehrerverband (DL) erkennt einen großen Nachholbedarf: „Mehr als die Hälfte der Lehrkräfte wünscht sich mehr Demokratiebildung an den Schulen, viele wünschen sich dafür mehr Zeit im Unterricht. Das deckt sich mit unseren Beobachtungen, dass das Interesse der Kolleginnen und Kollegen an Fortbildungen, wie Demokratiebildung im Unterricht umgesetzt werden kann, sehr hoch ist“, sagt Präsident Stefan Düll. Er zieht eine Verbindung zur Medienbildung und zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI): Beides müsse als Bestandteil von Demokratiebildung begriffen werden.
GEW: Lieber über statt mit KI lernen
Auf die Skepsis der Lehrkräfte, Künstliche Intelligenz im Unterricht einzusetzen, gehen alle Verbände und Gewerkschaften in ihren Mitteilungen zum Schulbarometer intensiv ein. Der VDR bekennt sich offen für die Nutzung generativer KI wie ChatGPT an Schulen aus, allerdings unter der Voraussetzung, „dass didaktische Konzepte, klare Leitplanken und passende Fortbildungsangebote entwickelt und ausgebaut werden“. Lehrkräfte benötigten zudem mehr Zeit und Ressourcen, um KI gezielt und pädagogisch sinnvoll einzusetzen, so der VDR-Bundesvorsitzende Neugschwender.
Ähnlich klingt die Position des VNL, der ebenfalls Zeit und Ressourcen fordert, um KI gezielt und pädagogisch sinnvoll einzusetzen – „zum Wohle des Lernerfolgs der Schülerinnen und Schüler“.
Deutlich kritischer äußert sich dagegen die GEW: „Die Unsicherheit und Skepsis bei der Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) in der Schule sind berechtigt“, so Bensinger-Stolze. Es fehle an pädagogisch tragfähigen Konzepten und rechtlicher Klarheit. Die Bildungsgewerkschaft warnt vor negativen Auswirkungen – und fordert, KI nicht zu früh an Schulen einzuführen. Statt den Fokus nur auf das Lernen mit KI zu legen, sollte das Lernen über KI gestärkt werden: „Eine souveräne Mediennutzung braucht mehr als Anwendungskompetenz. Das gilt für Lernende und Lehrende gleichermaßen.“ News4teachers



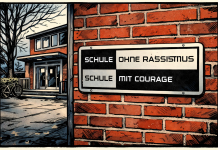






Eine Sternstunde der deutschen Humorgeschichte:
Ein führende GEW-Funktionärin fordert “Entlastung” für Lehrkräfte und “mehr üben” im Unterrichtsalltag.
Irgendwann wird auch der letzte Lehrer oder die letzte Lehrerin erkennen, dass das, was wir heute machen, kaum noch etwas mit dem zu tun hat, wofür wir einst angetreten sind – falls wir überhaupt noch wissen, wofür wir mal da waren. Und schon gar nicht das, was „man“ (Helikoptereltern, Kultusbürokratie, Bildungsideologen, der Elfenbeinturm…) sich darunter vorstellt. Schule ist längst kein Ort mehr des Lernens oder Lehrens, sondern zunehmend nur noch Aufbewahrungsort und Schauplatz für Bevormundung, Einflussnahme und eine systematische Entwertung der pädagogischen und fachlichen Expertise. Statt Wertschätzung für unsere Arbeit zu bekommen, werden wir ständig bevormundet, kontrolliert und in unseren pädagogischen sowie methodisch-didaktischen Freiheiten eingeschränkt. Das Schulbarometer zeigt seit Jahren eine tiefrote Warnstufe – doch anstatt die Ursachen anzugehen, wird nur noch an Symptomen herumgedoktert, mit immer derselben Placebomedizin, die ständig neu bestellt und uns in noch größerer Dosis aufgezwungen wird. Wir kämpfen gegen einen Niveauverfall im Leistungsbereich und in der Werteerziehung, der selbst den stärksten Lehrkörper an seine Grenzen bringt. Die größte Herausforderung: den Unterricht auf einem Niveau zu halten, das immer schwerer als solches erkennbar ist – während sich mancher zum Hampelmann degradierte Leerkörper immer öfter fragt, warum er morgens überhaupt noch aufstehen soll. Burn Out ist was für Anfänger. Viele aus Old School haben bereits Fuck Off.
“Das Schulbarometer zeigt seit Jahren eine tiefrote Warnstufe – doch anstatt die Ursachen anzugehen”
Lehrkräftemangel?
” Burn Out ist was für Anfänger. Viele aus Old School haben bereits Fuck Off.”
Sie hören ja auf. Halten Sie durch!
“Sie entstünden „überdurchschnittlich oft“ durch Überforderung in zu heterogenen Klassen. Broszat fordert daher ein „vielfältiges, sinnvoll gegliedertes Schulsystem“, das unterschiedliche Leistungsvoraussetzungen besser berücksichtigt.”
Ich befürchtete schon, Lehrkräftemangel oder zu wenige Förderstunden wären ein Grund, aber wir müssen nur den Kindern mit Behinderung das Grundrecht auf Teilhabe entziehen und sie in ein Parallelsystem ohne Anschluss an die “normale” Gesellschaft verbannen,
Kinder, deren Eltern kein Deutsch beherrschen, in separate Flüchtlingsklassen/ -Schulen separieren, wo sie möglichst nicht sozialisiert werden, dass wir uns über ihre “Parallelgesellschaft” aufregen können
und – dieser… Logik folgend müssen wir dann wohl auch wieder Jungen und Mädchen räumlich trennen und jüdischen Kindern eine eigene Schulform zuweisen, damit sie keinen Übergriffen ausgesetzt werden…
Oder – nur ein Vorschlag – wir stellen das marode, blutleere, völlig veraltete Schulsystem neu und besser auf
Und das wäre wie?
Gute Frage, aber sogar unsere Schutzbefohlenen entwickeln eigene Ideen, weil Sie die Grenzen des Systems sehen
https://www.news4teachers.de/2025/06/weg-mit-dem-mehrgliedrigen-schulsystem-schueler-in-nrw-streiken-fuer-umfangreiche-bildungsreformen/
Der Kaiser würde das gar nicht gutheißen 😛
Wir können auch auf die Wissenschaft oder – Schmerz – ins EU-Ausland schauen?
Da wir mit dem Föderalismus es nicht mal hinbekommen, uns selbst zu betrachten, wäre mein persönlicher Wunsch dahingehend … Sie wissen schon 😉
“… durch Überforderung in zu heterogenen Klassen.”
Aber heißt es nicht immer, dass das gemeinsame Lernen umso besser gelingt, je heterogener die Schulklassen sind, und dass homogene Schulklassen ganz schlecht sind? Was davon ist eigentlich wissenschaftlich erwiesen, und was ist nur Partei-Propaganda?
Sie fragen, Drohne antwortet:
Da Heterogenität toll ist, kann am Scheitern (das um so stärker ausfällt,je heterogener eine Schule wird, ausser man buttert immer weiter Ressourcen rein) von Heterogenität nur eine finstere, bösartige Macht schuld sein. Denn Heterogenität ist ja toll.
Dies ist in der Regel die Lehrkraft, die die heterogenen Segnungen halt einfach nicht verstanden hat.
Ich wünsche nicht, die realen Kinder auszutauschen, sondern die Bildungspolitik an diesen Realitäten auszurichten.
Leider ziehen viele im Forum das Gegenteil vor 🙁
Aber in 10 Jahren oder so gibt es dann vielleicht weniger Kinder und vielleicht genügend Lehrkräfte (rechnet garantiert niemand nach) und dann kann sich Deutschland endlich auf das geordnete Totschrumpfen einstellen – Hurra für die “Volksdeutschen”! 😀
Der schlaue Beamte organisiert sich seine Unterstützung gegen “zuviel Stress in der Schule” selbst, auf die Idee brachte mich dieser Artikel:
https://www.focus.de/wissen/vielleicht-sage-ich-nach-14-stopp-simone-bekommt-ein-baby-nach-dem-anderen_6ff82783-ccd5-4436-b9dd-a88d4188ea26.html
Man braucht gar keine 14 Kinder, 10 genügen. Dann gibt*s in NRW in A13, Stufe 10, Mietstufe V, Steuerklasse 3, knapp 10.000 Euro netto.
Und wenn man dann noch die Kinderkrankentage konsequent zieht, braucht man bei 10 Kindern auch gar nicht mehr in die Schule kommen.
Ok, dann hat man 10 Kinder zuhause, aber besser als 30 in der Schule. Und die 10.000 Euro netto gibt’s als Bonus obendrauf…