BERLIN / BIELEFELD. Sie entwickeln Apps für inklusiven Unterricht, Plattformen für Feedback-Kultur oder KI-basierte Tools zur Unterrichtsentlastung – und stoßen dabei regelmäßig an die Grenzen des Systems: Die Rede ist von EdTech-Startups, jenen jungen Unternehmen, die mit digitalen Innovationen Schule mitgestalten wollen. Einer, der die Szene wie kaum ein anderer kennt, ist Tobias Himmerich. Als Gründer und Geschäftsführer von EDUvation unterstützt er EdTechs seit Jahren – und warnt eindringlich: „Wir stehen kurz davor, abgehängt zu werden.“
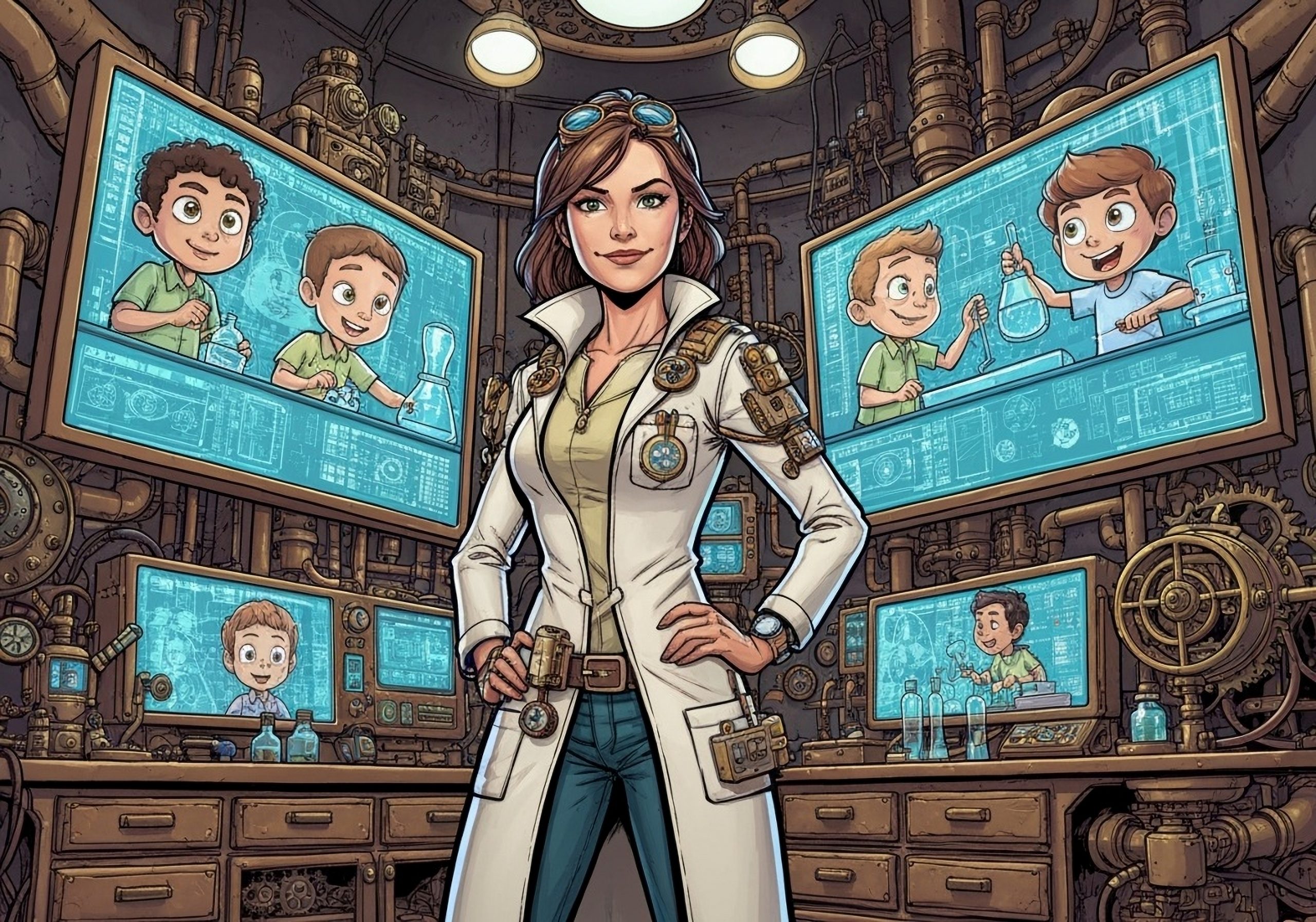
Dass Tobias Himmerich sich überhaupt im Bildungsbereich engagiert, war keineswegs geplant. „Nach meinem Studium arbeitete ich in der Unternehmensberatung – das tue ich teilweise noch heute“, erzählt er im Gespräch mit der Vodafone-Stiftung.
Über ein eigenes Startup, ein Feriencamp-Projekt mit Native Speakern, kam er 2011 mit Schulen in Kontakt – und machte erste frustrierende Erfahrungen: „Damals gab es in ganz Deutschland niemanden, den man hätte fragen können: Wie funktioniert das eigentlich? Wie sieht ein typischer Sales-Cycle aus? Wer darf an einer Schule einen Kaufvertrag unterschreiben? Wer trifft überhaupt Entscheidungen? Es war eine einzige Zumutung. Das war circa 2011, 2012 – niemand konnte einem diese Fragen beantworten. Ich war im nordrhein-westfälischen Ministerium in Düsseldorf, und selbst dort sagte man mir: Wie der Schulträger das macht? Keine Ahnung. Wir setzen zwar die Regeln fest, aber wie das konkret bei den einzelnen Schulträgern läuft (und davon gibt es in NRW über 1000) wissen wir nicht. Es war auch in jeder Stadtverwaltung anders, ein völliges Durcheinander. Kurzum: Es gab keine Ansprechpersonen. Niemand.“
„Der Bildungsmarkt funktioniert nicht wie andere Märkte“
Diese strukturelle Intransparenz war der Anstoß für den Aufbau von EDUvation. „Wir wollten weitergeben, was wir uns damals selbst gewünscht hätten“, so Himmerich. Heute ist EDUvation zur zentralen Anlaufstelle für EdTech-Gründer:innen geworden, mit einem Netzwerk aus hunderten Startups, Förderprogrammen, Messekooperationen – und internationaler Sichtbarkeit. Allerdings ist das Projekt bedroht, weil staatliche Unterstützung gestrichen werden soll.
Wer in Deutschland ein EdTech-Unternehmen gründet, braucht nicht nur eine gute Idee, sondern vor allem einen langen Atem. „Der Bildungsmarkt funktioniert nicht wie andere Märkte“, betont Himmerich. Klassische Investorenlogik – schnelles Wachstum, skalierbares Geschäftsmodell – greife hier nicht. „Du wirst niemals eine exponentielle Wachstumskurve erleben. Kein einziges Startup in Deutschland hat je exponentielles Wachstum im Bildungsbereich hingelegt.“
Der Grund: Die Hürden sind hoch – besonders im sogenannten B2G-Bereich („Business to Government“), also dem Geschäft mit staatlichen Institutionen. Hier ist der Vertriebsprozess nicht nur langwierig, sondern auch politisch aufgeladen. Hinzu kommt die komplexe Entscheidungsstruktur aus Ländern, Schulträgern, Schulleitungen und Lehrkräften. Wer hier erfolgreich sein will, braucht Durchhaltevermögen – und Kapital. An beidem mangelt es häufig.
Was laut Himmerich insbesondere fehlt, ist eine „strukturierte Anschlussfinanzierung“. Zwar helfen Programme wie EXIST beim Start. Doch wenn nach einem Jahr die erste Finanzierung ausläuft, stehen viele Startups mit leeren Händen da – ohne Aussicht auf Investoren. „In anderen Branchen hat man nach einem Jahr oft schon erste zahlende Kund:innen – und kann sich damit auf Investorensuche begeben. Im Bildungsbereich ist das nicht der Fall. Es gibt keinen strukturierten Vertrieb und keinen gewachsenen Kundenstamm, weil die Vertriebszyklen im Bildungsbereich eben Jahre dauern.“ Aber genau in dieser Phase bräuchten Startups Kapital, um durchhalten zu können. „In Deutschland gibt es keinen EdTech-spezifischen Investmentfonds“, kritisiert Himmerich. In Ländern wie Frankreich, der Schweiz oder Großbritannien sei man da deutlich weiter.
Der jüngst veröffentlichte „EdTech Startup Monitor“ der Founders Foundation bestätigt diese Einschätzung. Demnach sehen 65 Prozent der EdTechs den Vertrieb als größte Herausforderung – gefolgt von der Trägheit der institutionellen Kunden (89 Prozent). „EdTech ist ein Spezialsektor mit Eintrittsbarrieren“, so das Fazit der Studie (News4teachers berichtete).
Für Himmerich liegt ein Schlüssel für mehr Innovation auch in klaren Rahmenbedingungen – etwa im Datenschutz. „Lehrkräfte können didaktisch sehr gut entscheiden, was sinnvoll ist. Aber wenn es um technische oder datenschutzrechtliche Aspekte geht, braucht es externe Zertifizierungen.“ Österreich sei hier weiter: „Dort existiert ein Bundes-Siegel, das Klarheit schafft. In Deutschland haben wir nur überkomplexe Kriterienkataloge, die ein junges Startup nicht bewältigen kann.“
„Startups brauchen reale Testumgebungen, in denen sie ihre Tools gemeinsam mit Schulen erproben können – mit wissenschaftlicher Begleitung“
Sein Vorschlag: Ein niedrigschwelliges, bundesweit anerkanntes Zertifizierungsverfahren für EdTech-Tools, das Lehrkräften Orientierung gibt – und Startups nicht abschreckt. Parallel fordert Himmerich eine bundesweite Testbett-Struktur: „Startups brauchen reale Testumgebungen, in denen sie ihre Tools gemeinsam mit Schulen erproben können – mit wissenschaftlicher Begleitung.“
Ein oft gehörter Vorwurf: Der Bildungsföderalismus sei die Innovationsbremse schlechthin. Himmerich widerspricht nur teilweise: „Wer sagt, dass der Föderalismus Geschwindigkeit bremst, liegt nicht völlig falsch. Aber ihn abzuschaffen, ist politisch nicht realistisch.“ Stattdessen plädiert er für mehr Gestaltungsspielräume auf der unteren Ebene – also bei Schulen und Schulträgern. „Nicht weniger Ebenen, sondern mehr Autonomie – gerade bei der Budgetverwendung.“
Diese Einschätzung deckt sich mit den Ergebnissen der Startup-Umfrage: Die EdTech-Szene ist überzeugt, dass Digitalisierung nur mit strukturellen Reformen gelingen kann. 86 Prozent der Gründer:innen sehen gute Bildung heute als untrennbar mit digitaler Ausstattung verbunden. Doch ohne politische Weichenstellungen droht der Innovationsmotor ins Stottern zu geraten.
Was sind die Trends? Himmerich beschreibt „Gründungswellen“ – also thematische Cluster, die sich über die Jahre herausgebildet haben. „Derzeit ist das Thema Künstliche Intelligenz dominant, also die Frage, wie man KI für Korrekturen oder die Erstellung von Aufgaben einsetzen kann. Das ist klar die aktuellste Entwicklung. Wenn man etwas zurückblickt, dann lag vor 10 bis 12 Jahren der Fokus stark auf Video-Learning und YouTube-nahen Lernplattformen. Vor 8 bis 9 Jahren kam dann eine Welle von Tools zur Schulverwaltung und -kommunikation: Schulmanager Online, SchoolFox und ähnliche wurden in dieser Zeit gegründet.“
„Wir brauchen eine bundesweit koordinierte Unterstützungsstruktur für Startups in der Bildung“
EdTechs könnten weiter zentrale Impulse setzen – wenn man sie ließe. „Wir haben viele Ideen, Konzepte, Pläne – aber es braucht Strukturen“, sagt Himmerich. Andernfalls drohe Deutschland, seinen Status als führender Bildungsmarkt Europas zu verspielen.
Himmerich: „Wir brauchen eine bundesweit koordinierte Unterstützungsstruktur für Startups in der Bildung. Das, was wir bei EDUvation in den letzten Jahren aufgebaut haben, ist dafür essenziell. Wenn das wegfällt – und aktuell sieht es so aus –, verlieren wir ein zentrales Element. Fast alle EdTechs, die heute in Deutschland aktiv sind, hatten in irgendeiner Form Kontakt mit uns, sei es über Messeauftritte oder Beratung. Ohne solche Strukturen werden wir in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit weiter zurückfallen.“
Himmerich ist überzeugt: „EdTech ist Wirtschaftsförderung und gleichzeitig Zukunftsvorsorge.“ Was heute in der Schule versäumt werde, zeige sich später auf dem Arbeitsmarkt. Deshalb müsse die Verantwortung für bessere Bedingungen auf Bundesebene liegen – insbesondere beim Wirtschaftsministerium. „Wir sprechen da nicht über Milliarden. Es geht um 500.000 bis 600.000 Euro jährlich – eine lächerlich geringe Summe gemessen an der Wirkung.“ News4teachers










Vielleicht brauchen wir auch Anwendungen, die einen deutlichen Mehrwert für die Lehrkräfte haben. Die auch halten, was auf den Messen versprochen ist und nicht nur BlingBling Marketing bieten. Da ist zuviel Mist auf dem Markt und die Lehrer haben leider nicht die Zeit alles zu testen und zu bewerten.
Lizenzierung ist wichtig. Beim angebissenen Apfel funktioniert das wunderbar über den Apple School Manager und die Schulen können da selber kaufen. Bei Plattformen oder größeren Anwendungen sollte die Authentifizierung irgendwo eingebettet werden können (Stichwort Österreich: z.B. Webuntis).
Wer über Schulträger oder gar Ministerium / BezReg gehen muss, der hat verloren. Die haben eh keine Ahnung, was bei uns ander Basis gebraucht wird. In Teilen ist das auch bei den Bildungswissenschaftlern (internes Schimpfwort im Kollegium) so.
Mimimi… Die Rezepte der Startup-Techs funktionieren im Bildungsbereich nicht, ach ja? Keine Skalierbarkeit, nun, dann könnte die Innovation vielleicht ein modulares, flexibles Angebot sein? Schwieriger auszuarbeiten, schwieriger zu erklären, sicher, aber seit wann ist es vorgeschrieben, dass der Markt es Neubewerbern leicht machen muss? Der Vertrieb und die Trägheit der Kunden sind die Eintrittsbarrieren (?), eigentlich sind das doch Marktbedingungen, die für alle gelten. Zum einen träge Institutionen, andererseits der Wunsch nach einem Zertifizierungssystem, ob das mehr Flexibilität bringt… Könnte man das übersetzen mit ‘ich habe da etwas ganz tolles, bitte garantiert mir Kunden’?
“Startups brauchen reale Testumgebungen, in denen sie ihre Tools gemeinsam mit Schulen erproben können – mit wissenschaftlicher Begleitung” – schon einmal versucht, einem Kollegium (nicht Ministerium!) gemeinsame Erprobung mit wissenschaftlicher Begleitung zu verkaufen? Während der übliche Lehrplan auch noch einzuhalten ist? Hallo, Kosten/Nutzen!
Ich hätte auch gerne etwas Niedrigschwelliges, z.B. Tools, die nicht mit jedem Update komplizierter werden, nur weil Lehrer X in Schule Y zurückgemeldet hat, für ihn wäre dieses Feature schön. Beispiel: Digitalboard, nach dem letzten Update ca. 20 geometrische Formen mehr, 30 statt 4 voreingestellter Farben, Strichdicke nicht per Schieberegler einstellbar sondern vier Voreinstellungen usw. Die tollen digitalen ‘Hilfen’ müssen schnell und einfach zu bedienen sein, aber das sehen Programmierer oft anders: seht mal, wir haben wieder etwas verbessert und hinzugefügt.
86% der Ed-Tech Szene sehen gute Bildung als untrennbar von digitaler Ausstattung an. Das sehen wahrscheinlich ebenso viele LehrerInnen nicht so, die würden eher auf individuelle Neugier setzen, aber jeder hat seine eigene Betriebsblindheit.
Die Firmen wollen ihre digitalen Produkte verkaufen. Natürlich sehen sie diese als untrennbar für gute Bildung an.
Ich selbst plane meinen Unterricht nach wie vor so, dass er im Bedarfsfall auch sehr kurzfristig analog funktioniert.
Die Länder müssen das ja bezahlen und gegen die Vormachtstellung von Klett/Cornelsen/Westermann/Microsoft kommt man als Neuling kaum an.
Primär muss es doch darum gehen, digitale Tools zu haben, die man auch beibehält und die wirklich Entlastung bringen:
Wir haben in den letzten Jahren alle möglichen Tools ausprobiert und wieder verworfen. Während Corona musste plötzlich der Unterricht als Videokonferenz über Zoom stattfinden. Dann sollte plötzlich eine datenschutzkonforme Software verwendet werden, die aber regelmäßig zusammengebrochen ist. Also Wechsel zur nächsten Plattform, weitere Probleme, und schließlich Wechsel zurück zu Zoom…
Später mussten z.B. alle Lehrkräfte an zwei Arbeitstagen ein Tool kennenlernen, bei dem alle Einheiten hinterlegt werden sollten. Die ersten Einheiten wurden umgeplant und hinterlegt. Einen dritten Tag hätte es gebraucht, um das fertig zu haben, den gab es aber nicht. Zwei Wochen später wurde entschieden, dass ein anderes Tool ja viel besser wäre und wir alles verwerfen können.
Dann gab es bspw. Fortbildungen zu einer tollen Mind-Map-Software. Sehr kooperativ und alle könnten gleichzeitig daran arbeiten. Im kleinen Kreis mit fünf Kollegen hat das auch funktioniert. Das geht nur nicht, wenn 30 Kinder gleichzeitig alles reinschreiben, was ihnen einfällt. Eine Kollegin hatte dann die Idee, ein „Placemat“, welches nun mal vom gemeinsamen Arbeiten an einem riesigen Blatt Papier lebt, auf das iPad zu übertragen. Das ist leider völlig schiefgelaufen…
Ich denke, wir alle kennen solche frustrierende Beispiele von purem Aktionismus, und dabei waren alles etablierte Anbieter. Wie soll man dann ein Kollegium davon überzeugen, mit einem Startups zusammenzuarbeiten, welches es vielleicht in 3 Jahren gar nicht mehr gibt?
„Startups brauchen reale Testumgebungen, in denen sie ihre Tools gemeinsam mit Schulen erproben können – mit wissenschaftlicher Begleitung.“
Die Schwierigkeit, die ich hier sehe, ist der Aufwand für die Lehrkräfte. Warum sollte ich für ein Startup meinen Unterricht umwerfen und Zeit für wissenschaftliche Untersuchungen zur Verfügung stellen, wenn ich gar nicht weiß, wie lange es das Startup geben wird? Und warum sollte ich das für etwas machen, das ein Startup, das nicht im Schulsystem steckt, für einen möglicherweise sinnvollen Ansatz erachtet?
Eher müsste ein Startup an die Lehrkräfte herantreten, nach Problemen und Umsetzungswünschen fragen und das so konkret wie möglich umsetzen. Damit könnte man einen deutlichen Mehrwert für Lehrkräfte schaffen.
Die im Artikel genannte Problematik mit der Finanzierung haben wir doch auch bei der Hardware. Was machen wir, wenn die iPads usw. neu angeschafft werden müssen? Was passiert, wenn die grandiosen digitalen Tafeln nicht mehr mit neuer Software oder neuen Geräten kompatibel sind? – Dann haben wir eine riesige Menge Elektroschrott und keine Finanzierung für neue Geräte.
Bei mir an der Schule wurden immer mal wieder Apps zur Generierung von Arbeitsblättern, automatisierten Tests vorgestellt. Auf die Frage, ob sie auch Formeln können, kam meistens die Antwort “nein” oder “nur bedingt”, weshalb sie für mich schon ausschieden.