BERLIN. Frühstart mit Risiko? Die Bundesregierung plant, den Bildungsweg künftig bereits im Kita-Alter zu sortieren: Alle Vierjährigen sollen einem verpflichtenden Sprach- und Entwicklungsscreening unterzogen werden – mit potenziellen Folgen wie Vorschulklassen für Kinder mit Förderbedarf. Was auf den ersten Blick nach gezielter Frühförderung aussieht, ruft in der Wissenschaft massive Bedenken hervor. Eine neue Stellungnahme von Bildungsforscher:innen warnt vor den Gefahren früher Selektion – und zeigt auf, was wirklich helfen könnte.
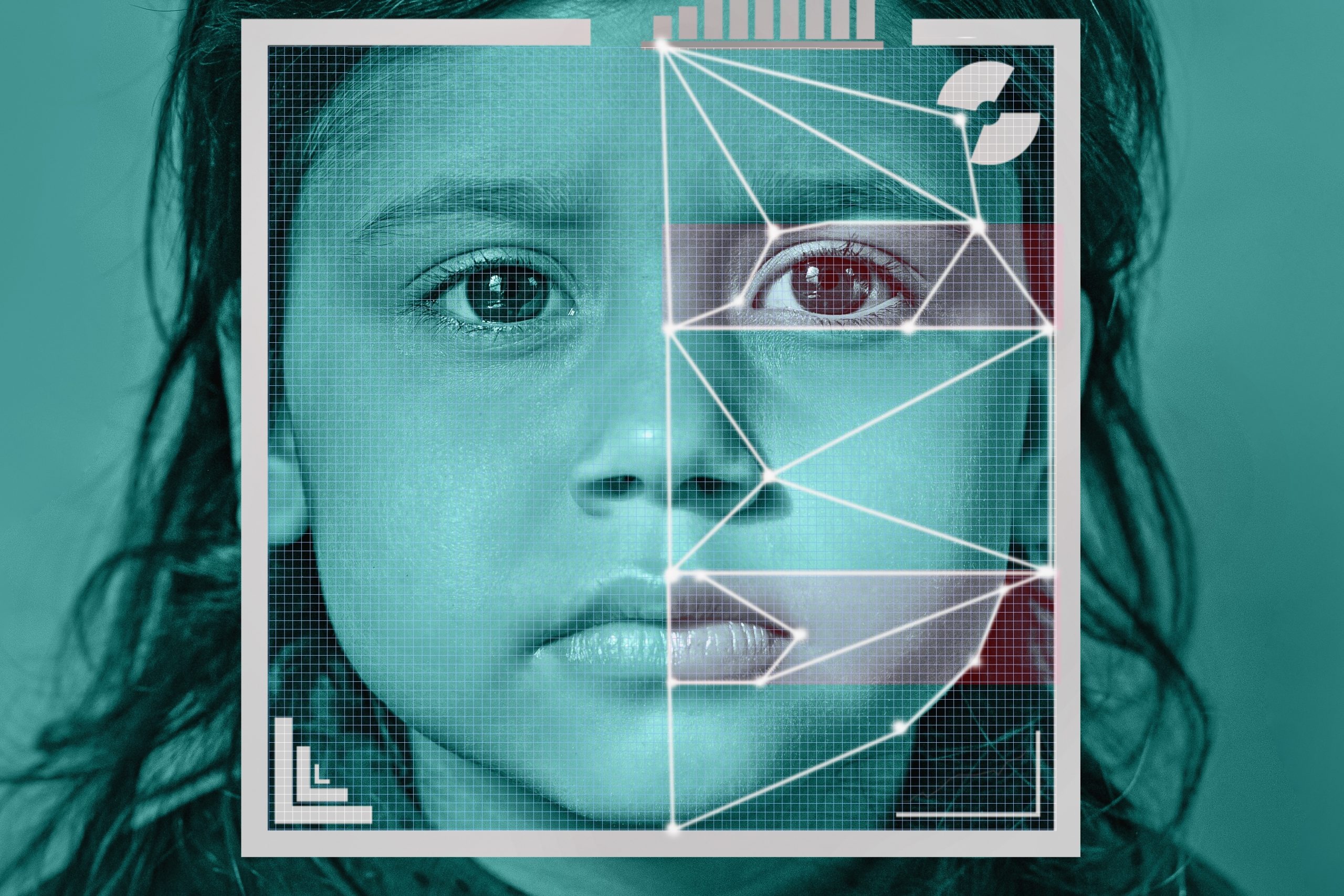
Dass Karin Prien die Kitas in den Blick nehmen will, um die Schülerleistungen in Deutschland zu verbessern, machte die heutige Bundesbildungsministerin – damals noch als Schleswig-Holsteinische Bildungsministerin – im Januar in einem bildungspolitischen Papier für die Wübben Stiftung deutlich. Eine der wichtigsten kulturellen Veränderungen, die in diesem Land erforderlich wären, ist ein Umdenken in Bezug auf die Rolle der Kitas“, schrieb die CDU-Vize-Vorsitzende.
Sie betonte: „Kitas müssen in Deutschland endlich vom ersten Tag an als Bildungseinrichtungen anerkannt und auch tatsächlich genutzt werden. Die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher ist keine Kinderbeaufsichtigung, sondern eine elementar wichtige pädagogische Begleitung in den ersten Lebensjahren. In der Kita werden Sprachdefizite schneller und einfacher behoben als in jedem anderen Lebensbereich. Kulturelle Integration und Hinführung zu Neugier und basalen Kompetenzen müssen als Vorbereitung auf die Schule in der Kita erfolgen. Im Sinne einer Priorisierung sollte ab sofort eine nationale Agenda für Kinder im Alter von 0 bis 10 Jahren im Mittelpunkt stehen – mit verbindlichen Bildungsplänen für dieses Alter und der Entwicklung eines gemeinsamen Bildungsverständnisses für Kita und Grundschule sowie einer erleichterten Kooperation der Hilfesysteme, einschließlich Datenübermittlung, die hier bildungskompensatorisch wirken sollen.“
Was das konkret meinte, lässt sich mittlerweile im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD (Punkt 4.1) nachlesen: „Für gutes Aufwachsen und Chancengerechtigkeit für alle Kinder in Deutschland werden wir die verpflichtende Teilnahme aller Vierjährigen an einer flächendeckenden, mit den Ländern vereinbarten Diagnostik des Sprach- und Entwicklungsstands einführen. Bei ermitteltem Förderbedarf erwarten wir von den Ländern geeignete, verpflichtende Fördermaßnahmen und -konzepte“, so heißt es in dem Grundlagendokument der Bundesregierung.
Doch daran regt sich jetzt Kritik: In einer umfassenden Stellungnahme warnen die Bildungswissenschaftler:innen Prof. Timm Albers und Dr. Seyran Bostancı, unterstützt von über 30 renommierten Professorinnen und Professoren, eindringlich vor der geplanten Sprachstandserhebung im Vorschulalter. Sie kritisieren, dass diese auf eine defizitorientierte Selektionsdiagnostik hinauslaufe – mit der Folge, dass Kinder aus benachteiligten Lebensverhältnissen weiter stigmatisiert und segregiert würden.
„Die angestrebte Diagnostik läuft Gefahr, bestehende Ungleichheiten nicht zu verringern, sondern zu verstärken“
Die Autor:innen monieren, dass der Ansatz des Koalitionsvertrags einer „Vorverlagerung schulischer Selektion“ gleichkomme – insbesondere, wenn Vorschulklassen als Konsequenz drohen. Bereits heute hätten Kinder mit Migrations- oder Fluchthintergrund sowie aus sozial benachteiligten Familien einen erschwerten Zugang zu früher Bildung. Statt diese Hürden zu beseitigen, berge das geplante flächendeckende Screening das Risiko, die Chancenungleichheit weiter zu verstärken. „Die angestrebte Diagnostik läuft Gefahr, bestehende Ungleichheiten nicht zu verringern, sondern zu verstärken, da sie mit einem weiteren Selektionsrisiko in der Biografie von Kindern verbunden ist“, so die Stellungnahme.
Statt individueller Tests empfehlen Albers und Bostancı, soziale Rahmenbedingungen als Grundlage für die Ressourcenverteilung heranzuziehen – etwa über Sozialraumindikatoren.
Bereits in der Vergangenheit eingeführte Sprachförderprogramme, vor allem additive Maßnahmen, hätten die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. Studien zeigten enttäuschende Ergebnisse in der Sprachentwicklung geförderter Kinder. Besonders kritisch bewerten die Autor:innen separierende Maßnahmen: „Vorschulklassen und Schulkindergärten tragen im ungünstigen Fall zur Verstärkung der Unterschiede in den Bildungsvoraussetzungen bei“, heißt es.
„Nur wenn alle Kinder frühzeitig Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung erhalten, können gerechte Startvoraussetzungen geschaffen werden“
Zudem verweisen sie auf eine diskriminierende Wirkung der aktuellen Sprachstandserhebungen, die meist einsprachig normiert seien und die Mehrsprachigkeit vieler Kinder nicht angemessen abbildeten. Stattdessen brauche es prozessorientierte Beobachtungsverfahren, die Sprache in authentischen Interaktionen erfassen.
Ein zentrales Argument der Forscher:innen: Der Zugang zur frühkindlichen Bildung sei für viele Familien mit Migrationshintergrund nach wie vor erschwert – etwa durch bürokratische Hürden, mangelnde Informationen oder institutionelle Diskriminierung. Statt an späterer Stelle zu selektieren, müsse früher Zugang zur Kita sichergestellt werden: „Nur wenn alle Kinder frühzeitig Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung erhalten, können gerechte Startvoraussetzungen geschaffen werden.“
Dabei liefern die Autor:innen auch konkrete Perspektiven für eine wirksame und inklusive Sprachbildung:
- Alltagsintegrierte Sprachbildung stärken: Programme wie „Sprach-Kitas“ hätten gezeigt, dass sie bei guter Umsetzung positive Effekte auf die Sprachentwicklung haben.
- Professionalisierung des Fachpersonals: Frühpädagog:innen müssten für den Umgang mit sprachlicher Vielfalt qualifiziert sein – auch im Hinblick auf Diagnostik und Mehrsprachigkeit.
- Systemische Veränderungen statt Kindzentrierung: Nicht die Kinder müssten schulfähig werden, sondern Bildungseinrichtungen müssten kindfähig sein. Es brauche diversitätssensible und sprachlich anregende Umgebungen – idealerweise auch in der Familiensprache.
- Stärkung dialogischer Methoden: Formate wie dialogisches Lesen oder Translanguaging seien nachweislich wirksam – insbesondere für Kinder mit wenig Kontakt zur Umgebungssprache Deutsch.
Die klare Botschaft der Stellungnahme: Standardisierte Sprachtests und Vorschulklassen seien der falsche Weg. Es brauche keine selektiven Sondermaßnahmen, sondern hochwertige, inklusive und empowernde frühkindliche Bildung für alle. Fazit der Autor:innen: „Eine gute Kita ist eine gute Kita für alle Kinder. Sie braucht keine separierenden Sondermaßnahmen, sondern gut ausgebildete Fachkräfte, vertrauensvolle Beziehungen zu Familien und ein Bildungssystem, das Vielfalt als Ressource begreift.“ News4teachers
Hier lässt sich die vollständige Stellungnahme herunterladen.
Diese Wissenschaftler:innen unterstützen die Stellungnahme:
- Prof. Dr. Juliane Karakayalı, Evangelische Hochschule Berlin
- Prof. Dr. Peter Cloos, Stiftung Universität Hildesheim
- Dr. Till Julian Nesta Wörfel, Mercator Institut, Universität zu Köln
- Prof. Dr. Katja Gramelt, Hochschule Düsseldorf
- Prof. Dr. Nadine Madeira Firmino, Hochschule Bielefeld
- Prof. Dr. Susanne Miller, Universität Bielefeld
- Prof. Dr. Yvonne Decker-Ernst, IU Internationale Hochschule
- Prof. Dr. Katharina Gerarts, IU Internationale Hochschule
- Prof. Dr. Brigitte Kottmann, Universität Paderborn
- Prof. Dr. Katrin Velten, Alice Salomon Hochschule Berlin
- Prof. Dr. Aysun Doğmuş, Technische Universität Berlin
- Prof. Dr. Vassilis Tsianos, Fachhochschule Kiel
- Prof. Dr. Tina Friedrich, Katholische Stiftungshochschule München
- Prof. Dr. Sven Lindberg, Universität Paderborn
- Prof. Dr. İnci Dirim, Universität Wien
- Prof. Dr. Renate Zimmer, Universität Osnabrück
- Vertr. Prof. Dr. Yasemin Uçan, Universität zu Köln
- Prof. Dr. Claudia Hruska Alice Salomon, Hochschule Berlin
- Dr. Reyhan Kuyumcu, Christian-Albrechts-Universität Kiel
- Prof. Dr. Susanne Schwab, Universität Wien
- Prof. Dr. Regine Schelle, Hochschule München
- Prof. Dr. Petra Büker, Universität Paderborn
- Prof. Dr. Natascha Naujok, Evangelische Hochschule Berlin
- Prof. Dr. Bedia Akbaş, Fachhochschule Kiel
- Prof. Dr. Rahel Dreyer, Alice Salomon Hochschule Berlin
- Prof. Dr. Sarah Fürstenau, Universität Hamburg
- Prof. Dr. Maisha-Maureen, Auma Humboldt-Universität Berlin
- Prof. Dr. Hans Brügelmann, Universität Siegen
- Prof. Dr. Mona Massumi, Fachhochschule Münster
- Prof. Dr. Manfred Liebel, Technische Universität Berlin
- Prof. Dr. Anne Piezunka, Hochschule für Soz. Arbeit und Pädagogik Berlin
- Benedikt Wirth, DeZIM Berlin
- Prof. Dr. Karin Kämpfe, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd
- Prof. Dr. Emra Ilgün-Birhimeoğlu, Fachhochschule Dortmund
- Prof. Dr. Nina Hogrebe, Technische Universität Dortmund
- Dr. Kevin Niehaus, Universität Duisburg-Essen
CDU will verpflichtende Sprachförderung in Kitas (das hat allerdings einen Haken)










Was ist eine kindfähige Schule?
Wenn die Bildungssprache in Deutschland deutsch ist, müssen die Kinder spätestens mit Schuleintritt Deutsch können.
Das mit der deutschen Sprache dürfte je nach Stadt in der Kita schon heute schwierig sein, weil es dort nur noch so vergleichsweise wenige rein deutschsprachige Kinder gibt und die sich naturgemäß auf wenige Kitas konzentrieren.
“Wenn die Bildungssprache in Deutschland deutsch ist, müssen die Kinder spätestens mit Schuleintritt Deutsch können.”
Und was passiert, wenn Kinder das nicht können? Und was passiert mit Kindern, die erst nach dem Schuleintritt nach Deutschland kommen und kein Deutsch sprechen?
Man kann ja gerne Prinzipien aufstellen. Die müssen dann aber auch zur Wirklichkeit passen.
Es spricht nichts dagegen, dass Kinder schulbegleitend Deutsch lernen.
Sinnvoll sind verpflichtende Kita- oder Vorschlujahre für alle, in denen auch Sprachdefizite abgebaut werden können. aber wie oben geschireben, erreicht man damit trotzdem nicht alle Kinder.
Außerdem verfügen viele Kitas hauptsächlich über Personal mit Migrationshintergrund, das auch kein einwandfreies Deutsch spricht.
Fazit: die Sprache ist nicht mehr das ausschlaggebende Element für Kommunikation und Lernen. Soll man das so verstehen?
“Außerdem verfügen viele Kitas hauptsächlich über Personal mit Migrationshintergrund, das auch kein einwandfreies Deutsch spricht.”
Das ermöglicht dann aber zumindest eine individuelle Förderung in der ‘Familiensprache’ einzelner Kinder.
Aus dem Artikel:
“Es brauche diversitätssensible und sprachlich anregende Umgebungen – idealerweise auch in der Familiensprache.”
Auf die Spitze getrieben wäre es aus der Sicht der Verfasser logischerweise ideal, wenn in der Kita ein babylonischer Sprachwirrwarr herrscht…
Rein fachlich haben die gut bestallten Honorationen (m/w/d) sicherlich gute Argumente für ihre These. Wie wäre es, wenn sie für A 12 bis A 13 einmal für vier Jahre bis zu 30 konkrete Kinder aus einem repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung durch die Grundschulzeit begleiteten?
Zudem: Wo bleiben die konkreten Vorschläge, wo die geforderten “Ressourcen” herkommen sollen?
Ich finde ihren Vorschlag sehr gut. Während meiner Zeit als Lehrkraft habe ich mich dazu entschlossen, in einem anderen Bereich tätig zu werden.
Ihren Vorschlag finde ich sinnvoll und kenne das aus der Wirtschaft. Habe im Produktmanagement für eine Firma, die sich u.a. auf Gemeinschaftsverpflegung spezialisiert hat gearbeitet. Um nicht an der Operativen vorbei zu planen, sind regelmäßige so genannte Front Days Pflicht.
Ja, es ist schon verwunderlich, dass dies im Bereich der ach so wichtigen Bildung nicht passiert.
Bei den Medizinern würde man einen Professor oder eine Professorin, die nicht regelmäßig selbst am Patienten arbeitet, z.B. selbst im OP steht, überhaupt nicht ernst nehmen.
Bei den Bildungswissenschaften haben dagegen die reinen “Elfenbeintrum-Pädagogen” einen Status,der sie jeder Kritik aus der Praxis entzieht. Ich kann nur spekulieren, woran das liegt, vermute aber, dass derartige Theoretiker äußerst nützlich für Politiker und Ideologen sind…
„Eine gute Kita ist eine gute Kita für alle Kinder. Sie braucht keine separierenden Sondermaßnahmen, sondern gut ausgebildete Fachkräfte, vertrauensvolle Beziehungen zu Familien und ein Bildungssystem, das Vielfalt als Ressource begreift.“
Mein Fazit: an der schlechten sprachlichen Bildung der Kinder vor dem Schuleintritt sind anscheinend die Erzieherinnen und Erzieher schuld, weil sie das derzeitige Bildungssystem nicht als Vielfalt der Resource begriffen haben. Durch Schulungen wird sich das natürlich ändern. Dann hat die Fachkraft Zeit und Muße und kann trotz Unterbesetzung und mitten in der Vielfalt der Kinder jedes einzelne Kind sprachlich da abholen, wo es gerade steht und es liebevoll fördern.
Was es tatsächlich bräuchte, wäre Stimmbildung für Erzieherinnen. Manche schreien auch nach Feierabend im normalen Gespräch weiter. Sie kommen häufig nur noch mit erhobener Stimme in diesem Gewusel durch, in dem viel zu viele Kinder viel zu lange mit viel zu wenig Ruhe in einem viel zu ausufernden Bildungsprogramm bei viel zu wenig Personal täglich ausharren müssen.
Ich kenne viele hoch motivierte und gut ausgebildete Erzieherinnen. Aber in einer Gruppe mit über 20 Kindern, in der teilweise noch gefüttert und gewickelt werden muss, ist individuelle Förderung kaum möglich.
Oje. Mein Text ist missverständlich. Ich korrigiere sofort direkt darunter.
Ich fand Ihren Text nicht missverständlich. Und den Text von Ulla habe ich eher als Zustimmung und Ergänzung verstanden, nicht als Kritik.
Vielen Dank, Cornelia
Die Arbeit in Kitas müsste viel mehr wertgeschätzt und aufgewertet werden.
Mich stört zum Beispiel im Artikel der Satz von Frau Prien: “Die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher ist keine Kinderbeaufsichtigung,…..”
Ist sie doch. Natürlich nicht ausschließlich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich irgendwo auf Beaufsichtigung reduziert. Die Aufsichtspflicht hat man immer irgendwie im Hintergrund, wenn man mit Kindern umgeht, und wehe, wenn mal ein Kind zu Schaden kommt. Dann wird doch klar, was Erzieher, Lehrer, auch Eltern, täglich leisten, noch bevor die Pflege und pädagogische Arbeit beginnt. Und vor allem bei unter Dreijährigen, die sich sprachlich kaum oder gar nicht ausdrücken können, muss man vieles, zum Beispiel gesundheitliches, durch Beobachtung erkennen.
Auch ist im Artikel nie von Bindung die Rede, aber Erzieherinnen und Erzieher sind unter anderem auch wichtige Bezugspersonen , vor allem für die ganz Kleinen. Bindung kommt vor Bildung. Im Artikel heißt es ” Kinder von 0 bis 10 Jahren”….,aber Kinder im ersten Lebensjahr sollten nach Möglichkeit ( und Ansicht unserer früheren Familienministerin Ursula von der Leyen) gar nicht in Frühbetreuung gegeben werden.
Erzieherinnen und Erzieher sollen, wie Lehrer, immer mehr leisten, aber die Kernaufgaben sind eben auch da . Und alles trotz Fachkräftemangel.
Sie haben vollkommen Recht, TaMu, und bringen alles sehr gut auf den Punkt.
Mein Beitrag ist leider sehr missverständlich. Ich habe geschrieben, mein Fazit sei, dass an der Misere anscheinend die Erzieher und Erzieherinnen schuld seien.
Richtigerweise hätte ich schreiben müssen: mein Fazit aus diesem Artikel ist, dass die Autoren zu meinen scheinen, die Erzieherinnen und Erzieher seien schuld, weil sie anscheinend nicht in der Lage seien, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Familien aufzubauen und Vielfalt als Resource zu begreifen.
Dieser Absatz war mir besonders unangenehm aufgefallen: „Eine gute Kita ist eine gute Kita für alle Kinder. Sie braucht keine separierenden Sondermaßnahmen, sondern gut ausgebildete Fachkräfte, vertrauensvolle Beziehungen zu Familien und ein Bildungssystem, das Vielfalt als Ressource begreift.“
Als ob die vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht von allen Kitas angestrebt würde!
Bisher hat erst Ulla auf meinen Text geantwortet und ich habe dabei bemerkt, wie missverständlich und dadurch auch entgegen meiner eigenen Meinung ich mich ausgedrückt hatte. Bei Ulla hatte ich noch Glück. Ihr leiser Tadel hat mich irritiert und auf meinen Fehler aufmerksam gemacht. Wahrscheinlich kriege ich in weiteren Kommentaren mehr auf die Mütze.
Ich entschuldige mich bei allen Erzieherinnen und Erziehern, euch habe ich wirklich nicht gemeint. Ich meinte lediglich den Text aus dem Elfenbeinturm.
Ich habe Ihren Beitrag von Anfang an exakt so verstanden, wie Sie es in Ihrer jetzigen Klarstellung noch mal erläutern.
Ich glaube da machen Sie sich unnötig Sorgen.
Danke Ihnen, Marion
“Sie kritisieren, dass diese auf eine defizitorientierte Selektionsdiagnostik hinauslaufe – mit der Folge, dass Kinder aus benachteiligten Lebensverhältnissen weiter stigmatisiert und segregiert würden.”
Jetzt hab ich Kaffee auf der Tastatur. Und erst nachdem ich die “konkreten Perspektiven” gelesen habe – Buzzword Bingo vom Feinsten.
Liebe Bildungswissenschaftler, schaut euch einfach mal die Lage vor Ort an.
Die Diagnostik muss ja sein, zur Defitzitdiagnostik wird sie ja nur dadurch, dass die benötigten Mittel – zeitliche, personelle, materielle, finanzielle Ressourcen – nicht zur Verfügung stehen.
Ist halt wie die Mängelrüge beim TÜV, solange die Knete oder die notwendigen Mittel zur Beseitigung des Mangels nicht vorhanden sind, fehlt die Plakette auch weiterhin.
Der TÜV ist ja auch so eine Defizitdiagnostik, die mich und mein schönes Auto stigmatisiert und aus dem Straßenverkehr segregiert.
Stattdessen sollte man lieber die alltagsintegrierte Betriebssicherheit stärken. Außerdem ist mein Auto ja gar nicht kaputt, sondern das überprüfende Fachpersonal sollte mal ordentlich geschult werden. Desweiteren fordere ich eine systemische Veränderung beim TÜV, statt Autozentrierung. Und zuletzt sollte auf dialogische Methoden gesetzt werden. Das ist nachweislich wirksam bei Leuten, wie mir, die nur wenig Kontakt zu Autosicherheitsthemen haben. Das alles natürlich bei gleichbleibenden Kosten für mich, ist ja klar.
Wer unterzeichnet mit?
Bereits das Feststellen eines Defizits scheint mittlerweile diskriminierend zu sein. Dabei ist das Testen, Prüfen und Untersuchen eines persönlichen Defizits die beste Möglichkeit, dieses Defizit auszugleichen, zu beseitigen oder zu integrieren. Je stärker das Defizit, umso weniger diskriminierend ist es doch, wenn zunächst ohne große Masse Menschen, die dieses Defizit nicht haben, in einem geschützten Raum unter gleichartigen Defizitären an den Grundlagen üben zu dürfen. Wenn eine gewisse Sicherheit und Übung vorliegt, integriert man sich damit in die allgemeinen Gruppen. Das kann Reha sein oder die Grundlagen irgendeiner Fertigkeit, zum Beispiel ein Musikinstrument, oder eben der Spracherwerb.
Bevor ich in einem Raum voller Menschen kein Wort verstehen und mitreden könnte, würde ich gerne Unterricht haben und gemeinsam mit anderen in meiner Situation separat von den Überforderungen draußen die Grundlagen üben.
Stellt es nicht auch eine Diskriminierung dar, einen sprachlich oder anderweitig überforderten Menschen in der Menge mitzuschleppen, nur damit er sich nicht ausgegrenzt fühlt?
Gerade wenn man ein Defizit hat, grenzt man sich zum Selbstschutz bereits aus. Wer aufgrund einer Verletzung oder Behinderung nicht gut laufen kann, schließt sich nicht einer Wandergruppe an. Wer die Sprache nicht beherrscht, möchte sie in Ruhe konzentriert lernen und erst dann gleichberechtigt in der Schule Leistung bringen.
Kitas sind ein Ort, wo Kinder am besten unter allen anderen die Sprache lernen. Diejenigen, die im Vorschuljahr noch kein Deutsch können, müssen aber während ihrer Kita-Zeit konzentriert einige Stunden wöchentlich sprachlich gefördert werden, was eine Separierung während dieser Zeit zur Folge hat.
Was ist daran schlimm? Wer ein Instrument lernt, separiert sich ebenfalls stundenweise zur Musikschule und zum Üben. Das macht man doch auch nicht nebenher im laufenden Betrieb, nur damit sich niemand außen vor fühlt.
Was ist so schlimm am Benennen eines Defizits und an der ruhigen Übung im geschützten Raum?
@TaMu
Danke.
Volle Zustimmung.
Sehe ich genauso.
“Bereits das Feststellen eines Defizits scheint mittlerweile diskriminierend zu sein.” Danke dafür und auch für den übrigen Kommentar!
Diesen Eindruck habe ich inzwischen auch.
Aber wie will man etwas gezielt fördern, wenn man nur schemenhaft erahnen kann, wo die Defizite liegen?
Ich bin sicher, jeder Erzieher und jeder Lehrer wäre hellauf begeistert, wenn er zum Beispiel je eine Woche eine Kleingruppe von drei, vier Kinder entspannt und spielerisch, weitab von einer Art Prüfungssituation, mit ihren Schwächen und Stärken kennenlernen könnte.
Ach ja, wie schön wäre das…
Was ist denn mit dem Neugeborenenscreening und den U-Untersuchungen? Nicht, dass dort noch gravierende Devizite (z.B. Behinderungen oder Krankheiten) festgestellt werden und das betroffene Kind zwecks medizinischer Maßnahmen, wie z.B. einem Krankenhausaufenthalt, glattwegs von seinen Altersgenossen “separiert” wird.
Okay, das Beispiel war jetzt sehr polemisch, ich weiß(war Absicht), allerdings fordert so ein Artzwie der obrige eine solche Reaktion geradezu heraus.
Danke und mir ging es wie Ihnen. Ich wollte auch polemisieren, weil ich mich so sehr über viele Einstellungen der Autoren geärgert hatte. Immer wieder tauchen Experten auf, die Theorien aufstellen, die sich sehr gut anhören und dabei diejenigen negativ aussehen lassen, die sich in der Praxis täglich unter schwierigen Umständen bemühen, Bindung zu den Kindern aufzubauen und achtsam umzugehen.
Wenn das häufig nicht gut gelingt, liegt es bestimmt nicht daran, dass Erzieherinnen und Erzieher nicht wüssten, wie es theoretisch sein müsste. Viele müssen sogar aus psychischen Gründen ihre Arbeit in der Kita aufgeben, weil sie zu sehr darunter leiden, unter den gegebenen Bedingungen nicht optimal mit den Kindern umzugehen und arbeiten zu können.
Dazu schreiben die Autoren kein Wort.
„Bereits das Feststellen eines Defizits scheint mittlerweile diskriminierend zu sein.“ Na ja, wenn es um Aussetzung von Noten geht, sind Eltern auf einmal ganz wild nach einer Defizitfeststellung….
Wohl wahr! Desgleichen, wenn es “nur” um diverse Nachteilsausgleiche ohne Notenaussetzung geht! Da ist dann nix mehr wichtig, von wegen Stigmatisierung oder Ausgrenzung… Man staunt!
Je größer die Diskrepanz zwischen Realität und Ideal, desto stärker muss das Idealbild durch Sprechakte vor der Realität geschützt werden.
Großartig beschrieben. Danke, TaMu !!!
Ihr Kommentar, der breite Zustimmung erfahren hat, hat mich persönlich tief getroffen. Als Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin sowie als schwerbehinderte Person mit Autismus-Spektrum-Störung, ADHS und Legasthenie habe ich die Auswirkungen eines selektiven Bildungssystems selbst erfahren.
Meine „Andersartigkeit“ wurde früh erkannt, jedoch nicht differenziert diagnostiziert. Statt einer fundierten psychiatrischen Abklärung erfolgte lediglich eine sonderpädagogische Einordnung. Anstelle der Regelgrundschule wurde ich in eine schulvorbereitende Einrichtung (SVE) angegliedert an einer Förderschule eingeschult. Auch dort blieb eine spezialisierte Diagnostik aus. Entscheidend für meinen weiteren Bildungsweg war letztlich meine überdurchschnittliche Intelligenz, die es mir ermöglichte, mich mithilfe von Masking an äußere Erwartungen anzupassen. So war ich das einzige Kind der Einrichtung, das nach einem Jahr in die Regelgrundschule wechseln durfte – alle anderen Kinder wurden ins Förderschulsystem überführt.
Erst im Rahmen eines universitären Seminars zur Autismus-Spektrum-Störung ließ ich eine gezielte Diagnostik durchführen, die mir erstmals eine Erklärung für meine langjährige Erfahrung von Fremdheit und Überforderung bot.
Die langfristigen Folgen früher schulischer Segregation werden häufig unterschätzt. Einmal im Förderschulsystem verortet, verbleiben viele Kinder dort dauerhaft – unabhängig von ihren tatsächlichen Potenzialen. Das Stigma wirkt weit über die Schulzeit hinaus. Kinder merken früh, dass sie ausgegrenzt werden. Die Zuweisung zur Förderschule ist im sozialen Umfeld häufig mit Abwertung verbunden („Deppenschule“), was das Risiko sozialer Isolation, eines niedrigen Selbstwertgefühls und psychischer Belastung erhöht – wie u. a. das Forschungsprojekt PEARL belegt.
Eine frühe Separation von Kindern mit Förderbedarf ist daher keine tragfähige Lösung. Erforderlich sind stattdessen inklusive Bildungsangebote – besonders in sozial benachteiligten Stadtteilen. Dazu gehören kleinere Gruppen (maximal 15 Kinder), ein besserer Betreuungsschlüssel (zwei Fachkräfte plus Ergänzungskraft) sowie sonderpädagogisch qualifiziertes Personal.
Der oft beschworene Fachkräftemangel greift zu kurz. In mehreren ostdeutschen Bundesländern etwa stehen qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung, die aufgrund sinkender Geburtenzahlen und geringer Auslastung sogar von Entlassung bedroht sind. Diese Ressourcen nicht zu nutzen, sondern zu verlieren, wäre bildungspolitisch fahrlässig. Statt auf quantitativen Ausbau zu setzen, sollte die Politik nun konsequent in Qualität investieren: bessere Personalschlüssel, kleinere Gruppen und stabile Arbeitsbedingungen.
Von der Inklusion an Regelschulen die flächendeckend unzureichend umgesetzt ist und gravierende strukturelle Defizite aufweist, will ich erst gar nicht anfangen. Ein Desaster.
Mit zwei Fachkräften plus Ergänzungskraft auf 15 Kinder würde ALLES funktionieren, keine Frage. Tatsache ist, bei uns an der Schule gibt es, in etwa, pro 20 Kinder, davon vielleicht 1/3 mit Förderbedarf, eine Fachkraft und manchmal (Teilzeit) eine Ergänzungskraft. Dadurch bleibt jede Förderung auf der Strecke, es sei denn die Fachkraft ist da und muss nicht gerade die Unterrichtsvertretung spielen. Und nein, es findet sich nicht genug geeignetes Personal (Ost).
Es tut mir leid, dass Sie sich von meinem Beitrag persönlich sehr getroffen fühlen.
Gleichzeitig wundere ich mich, dass Sie aus diesem heraus gelesen haben, dass ich anscheinend die dauerhafte Ausgrenzung von vor allem sprachlich förderbedürftigen Kindern in Förderschulen gefordert haben könnte.
Hier ging es besonders um den Erwerb der deutschen Sprache und ich hatte geschrieben, dass diese besonders im Vorschuljahr einige Stunden Sprachunterricht gemeinsam mit anderen Kindern mit sprachlichen Defiziten gezielt unterrichtet werden sollten. In der restlichen Zeit sollten sie mit den Kindern ihrer Gruppe in der Kita zusammen sein.
Im laufenden Betrieb in der Kita ist eine Förderung der Sprache auf Grundschulstandard nicht möglich, weil es zu wenig Fachkräfte gibt.
Gerade Kinder mit der Intelligenz, von der Sie profitiert haben, sollten die zu dieser Intelligenz passende sprachliche Ausdrucksfähigkeit besitzen, wenn Sie in die Schule kommen. Nur so können sie sich gut entwickeln.
Ich stimme völlig mit Ihnen überein, dass bei sinkenden Geburtenzahlen die Fachkräfte erhalten bleiben sollten, damit Förderung für alle Kinder wieder besser wird, ganz besonders aber für besonders förderbedürftige Kinder.
Auch für Qualität statt Quantität spreche ich mich durchgehend seit Jahren hier im Forum aus.
Vielleicht finden Sie, wenn Sie meinen Beitrag nochmals anschauen, unsere überwiegenden Übereinstimmungen und fühlen sich hoffentlich nicht mehr so stark davon belastet.
Ich wünschte, es gäbe genügend Fachkräfte, aber auch genügend psychiatrische Ärzte, um Menschen mit Ihren Voraussetzungen frühzeitig eine ordentliche Diagnose und entsprechende Inklusion anzubieten.
Aus eigener Erfahrung im direkten Umfeld weiß ich, dass bereits die Diagnostik ein jahrelanger Kampf ist. Ich weiß aber auch, dass Rückzug und kleine Gruppen häufig hilfreich sind, um nicht ständig überfordert zu werden, selbstverständlich ohne den Zwang zu dauerhaftem Rückzug in ein abgeschlossenes Fördersystem, wenn es anders machbar und gewünscht ist. Bei Sprachförderung gehe ich davon aus.
Translanguaging als sprachliche Methode stelle ich mir spannend vor in einer Schulklasse, in der die Schüler schon von Haus aus mindestens 20 verschiedene Sprachen sprechen….
Erstmal schön reingrätschen und mit Reizwörtern framen. Für die einen ist es böse, böse Separation, für die anderen zweckdienliche äußere Differenzierung.
“Sie kritisieren, dass diese auf eine defizitorientierte Selektionsdiagnostik hinauslaufe – mit der Folge, dass Kinder aus benachteiligten Lebensverhältnissen weiter stigmatisiert und segregiert würden.”
No way, Sherlock!
Und jetzt folgt das Verleugnen und Herunterspielen der Sorge der Expert*innen -__-
Niedersachsen hatte genau das: ein Screening für alle Schüler:innen, nachfolgend eine Förderung, die in Kleingruppen organisiert werden konnte, sodass die Kinder täglich eine Stunde zusätzliche Förderung in einer Kleingruppe erhielten, wenn möglich in der KiTa.
Dadurch bekam man über ein Jahr die Möglichkeit, Fähigkeiten genauer einzuschätzen, die Entwicklung zu beobachten, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen und weitere Maßnahmen anzuraten, sich mit den Erzieher:innen auszutauschen, die Entwicklung mit den bereits erfolgten Fördermaßnahmen abzugleichen…
Aber Niedersachsen hat Lehrkräftemangel, also wurde diese Förderung eingestampft, dafür sollen es Erzieher:innen nebenbei schaffen, trotz Fachkräftemangel.
Die Bedenken der Wissenschafter:innen hinsichtlich der Segregation teile ich, die ergibt sich aber häufig schon durch private/kirchliche Träger der KiTa oder durch Wohngebiete. Ich teile auch, dass man entsprechend nachsteuern müsste, wie bei Schulen auch, und das die Einrichtungen, die benachteiligte Kinder aufnehmen und fördern, dafür ausgestattet sein müssen. Aber am Ende spart man genau dort. Das aufgelegte Startchancen-Programm ist ein Tropfen auf den heißen Stein und erreicht viele Schüler:innen nicht.
Vermutlich braucht es vielfältigere Programme, über die man diskutieren kann:
Die Ausgestaltung wird sich je nach Stadt/ Land/ Einzugsgebiet verändern bzw. anpassen müssen
Die Signale für eine bessere Förderung müssen von der Politik kommen, die mit der Umsetzung der Ausstattung den Stellenwert zeigt:
Man fordert mehr und mehr von KiTa und Schule, ändert die Ausstattung aber nicht entsprechend. Das Personal, das es bräuchte, um Vorklassen auszustatten, könnte man ebenso zur Förderung in die KiTa geben. Eine Debatte um die Umsetzung braucht es, sie muss aber die Bedingungen vor Ort (im ganzen Land) in den Blick nehmen. Zudem darf diese Diskussion nicht dazu führen, dass die Umsetzung auf die lange Bank geschoben wird. Gleiches gilt für die Debatte um die Finanzierung.
So läuft die Forderung der Wissenschaftler:innen ins Leere, Politiker:innen freuen sich, können sie doch aus diesem Papier Argumente für den Sparplan rechtfertigen und nach der nächsten Testung wieder einmal fordern, was KiTa und Schule alles leisten sollen.
Ich habe jetzt mal erinnert, welche Kinder, die nach den Sommerferien bei uns eingeschult werden, einen erkennbaren Förderbedarf (keinen sonderpädagogischen) haben werden. Dazu zählen Kinder mit Sprachförderbedarf und / oder Kinder ohne hinreichende Vorläuferfähigkeiten.
Es sind durchweg Kinder (ausgehend von 50), die
– keine Kita besucht haben (3 Kinder). Diese Kinder haben sowohl Sprachförderbedarf als auch sonstigen Förderbedarf.
– Kinder, die zwar einen Platz im Kindergarten hatten, aber nur sehr unregelmäßig dort hingegangen sind (8 Kinder).
– Kinder, denen trotz des Alters die nötige Reife fehlt und denen eigentlich ein weiteres Jahr im Kindergarten gut getan hätte. Die Eltern haben sich mit Händen und Füßen gegen eine Rückstellung gewehrt (3 Kinder)
Das heißt, dass bei uns demnächst 14 Kinder aufschlagen werden, die eine ganz intensive Begleitung und Förderung bedürfen. Hinzu kommen noch die Kinder, bei denen sich erst noch der Förderbedarf herausstellen wird, die aber in der Schuleingangsphasediagnostik noch im unteren Mittelfeld mitgeschwommen sind und die als Empfehlung von der Schulärztin nur Zahlen, Mengen, Vorlesen, Spiele spielen mitbekommen haben.
Bei 11 von den 14 Kindern wäre ein Förderbedarf vermutlich weniger groß gewesen, wenn sie vorher einen Kindergarten regelmäßig besucht hätten. Und dabei wäre es m.M.n. nicht wesentlich darum gegangen, sie speziell zu fördern, sondern nur so weit, wie alle anderen Kinder auch.
Für mich ist der Dreh- und Angelpunkt, dass alle Kinder überhaupt einen Kindergarten regelmäßig besuchen. Und wenn sie das tun, muss eine spezielle Sprachdiagnostik eigentlich nicht sein, denn ich denke, dass die Erzieherinnen sehr gut einschätzen können, wie es sich mit dem Sprachstand des einzelnen Kindes verhält. Auch die weiteren Fähigkeiten können Erzieherinnen professionell einschätzen.
Fazit: eine Sprachdiagnostik reicht bei Kindern, die nicht den Kiga besuchen und Maßnahmen müssen nur bei diesen Kindern ergriffen werden und verpflichtende!
Also Kindergartenpflicht:
Am besten ab 3 Jahren, aber mindestens ein verpflichtendes Vorschuljahr.
Der Haken: Das müsste dann ohne Elternbeiträge laufen, wie die Schule und jemand müsste die Pflicht einfordern und kontrollieren. Außerdem müsste die Qualität stimmen. Gut ausgebildetes, motiviertes und gerecht bezahltes Personal. Kleine Kindergruppen!!!
Daran anscheinend:
Viel bessere Ausstattung der Grundschulen!!!!!!!!
Übrigens: Unsere”STARTCHANCENSCHULE” hat seit 2 Jahren ein Schild an der Wand. Gelder sin bisher aber kaum geflossen, Projekte wie Schulbibliothek,… hängen in der Warteschleife der Kommunen….
Ein Trauerspiel
Da ja der Kiga als Bildungsanstalt gesehen wird, würde ich mir wünschen, dass es ein oder zwei verpflichtende Kindergartenjahre für alle gäbe. Und ja, einhergehen müsste eine entsprechende Ausstattung. Damit wäre schon viel gewonnen….
Ich empfehle den ganzen Professoren, die die Stellungnahme unterstütrzen, selber erst einmal inkognito in die Erziehung zu gehen und zwar für mindestens ein Jahr, um am eigenen Leib zu erfahren wie das so läuft. Als ich im Lehramtsstudium war, habe haben wir unseren Fachdidaktik-Prof. mal gefragt wie lange er selber an einer Schule (nicht Universität) unterrichtet hätte. Er kam auf eine Erfahrung von insg. 14 Wochen in seinem ganzen Leben, natürlich vor vorher ausgesuchten Klassen unter paradiesischen Verhältnissen, was die Personal- und Materialverfügbarkeit angeht. Man will ja nicht, dass die Systemsprenger die ganze wissenschaftliche Studie kaputtmachen. Das hat alles mit der Realität rein gar nichts mehr zutun.
Nein
Oh, dann trifft das ja auf mehr als einen Didaktik-Prof zu 🙂
Es ist interessant, wie sehr das Wort ‘Selektion’ inzwischen zur Abwertung bestimmter Abläufe verwendet wird. Passt es nicht zur eigenen Meinung, heißt es Selektion, im anderen Kontext wird daraus ‘Diagnose’.
Soziale Rahmenbedingungen als Indikatoren, das ist ja eine geniale Idee! Dann selektieren wir nicht mehr nach Ergebnissen des einzelnen Kindes, sondern verteilen die Mittel und Förderungen nach Wohn- und Familienumfeld? Klingt wirklich wie eine große Verbesserung und absolut nicht selektierend.
Das Problem der Normierung der Tests ist nicht neu, wird auch versucht zu berücksichtigen, aber wo kommen bitte Zeit und Personal für prozessorientierte Beobachtungsverfahren her?
Es geht hier um zwei Alternativen, zum einen Kinder mit potentiellen oder vorhandenen Schwierigkeiten identifizieren und gezielt fördern, da ist dann die Frage, wie diese Förderung bestmöglich aussehen sollte. Die ist jetzt sicherlich nicht optimal, es wird also ein defizitärer Ist-Zustand als Maßstab für diesen Weg genommen. Andererseits mit der Gießkanne alle besser fördern, Rahmenbedingungen in Institutionen und Familien ändern, Migrantenfamilien besser und schneller integrieren, dabei deren eigene mentale Hürden berücksichtigen. Das alles unter Berücksichtigung der Ressourcen, finanziell, personell und gesellschaftlich. Stellt sich die Frage, nein, eigentlich ist sie schon beantwortet, was ist finanzierbar, gesellschaftlich durchsetzbar und treibt nicht 30% des vorhandenen Personal in die Frührente? Diese Realitätsferne muß noch nicht einmal Schuld der Autoren sein, aber irgendwann sollte man anfangen, vor Studien, Stellungnahmen, Gutachten usw. die realisierbaren Randbedingungen festzulegen, das würde viel Papier sparen.
@vhh
Ja, es ist absurd … seit vielen Jahren!
Würde die Medizin so arbeiten, dann müsste jemand mit auch für Laien klar erkennbaren offenen Brüchen beider Beine … genau: Erstmal mehrere Jahre lang untersucht werden! 🙁
Eine Behandlung zwecks Heilung stet noch gar nicht mal zur Debatte – es fehlen doch noch Studien; Vergleichsstudien, Langzeit(!)studien und auch Bürgerräte sollten gehört werden, vielleicht sogar Verwandtschaft bis zum 5. Grad, denn das genügt ja um den Unglücklichen mit 2 gebrochenen Beinen einschätzen zu können, man habe ihn ja schonmal irgendwo gesehen … und wisse daher so viel von ihm!
Während das alles nicht kostenlos zu haben ist, spart man sich frohgemut das Geld für die Heilbehandling – man kann ja wirklich noch gar nicht wissen, was da zu tun sei!
Jahrelang kann man dem Unglücklichen aber Mut machen, z.B. “Na, wie geht’s uns heute?” (Kleine Heiiterkeit am Rande bei offenen Brüchen hilft bestimmt zur Aufmunterung und Resilienz Kompetenz-Förderung 😉 ).
Und zur Ablenkung vom Elend gibt es einfach ein paar Tätigkeiten, welche das sind ist völlig wumpe!
Aber wenn es eben nicht gut geht mit den gebrochenen Beinen, dann bleiben ja noch bodennahe Tätigkeiten, da kann man sich im wahrsten Sinne des Wortes noch lange “dahinschlepoen”. 🙁
Die gute Nachricht? – Man bleibt als “Experte” beschäftigt und im Gespräch, ebenfalls in jeder Hinsicht … 😉
Das derzeitige Fördersystem im Bereich der sonderpädagogischen und sozialpädagogischen Unterstützung weist erhebliche strukturelle Schwächen auf. Es mangelt an Effizienz, Transparenz und einer konsequent evidenzbasierten Ausrichtung. Statt klar strukturierter Förderketten entstehen häufig parallele Maßnahmen ohne abgestimmte Zielsetzung, wodurch finanzielle Mittel unsystematisch gebunden werden – teils in enormem Umfang.
Einzelfallbezogene Überversorgung ist dabei ebenso problematisch wie strukturelle Unterversorgung an anderer Stelle. In meiner beruflichen Praxis als studierte Pädagogin mit fachlicher Spezialisierung auf Autismus-Spektrum-Störungen habe ich ein besonders aufschlussreiches Beispiel erlebt: Ein neunjähriger Schüler an einer Förderschule mit dem Schwerpunkt emotional-soziale Entwicklung wurde mit einer Vielzahl an kostenintensiven Maßnahmen gleichzeitig gefördert – darunter eine tägliche Betreuung in einer Tagesgruppe, Autismustherapie, fachliche Schulbegleitung sowie ein individueller Fahrdienst. Die Gesamtkosten beliefen sich auf über 200.000 Euro jährlich. Zugleich stellte sich die Frage, ob Umfang und Kombination der Maßnahmen tatsächlich zielführend und im Sinne des Kindeswohls waren – oder ob sie primär auf strukturelle Fehlanreize und ineffiziente Steuerung zurückzuführen sind.
Ein zusätzlicher Aspekt ist die Diagnostikpraxis. Eltern bemühen sich teils gezielt um bestimmte Diagnosen – etwa aus dem Autismus-Spektrum – da diese mit einem besseren Zugang zu Hilfesystemen und weniger stigmatisierender Wirkung verbunden sind als etwa die Diagnose einer Störung des Sozialverhaltens (so was es auch bei dem Jungen aus meinem Beispiel: Seine Eltern sind mit ihm solange von einem Diagnostikzentrum zum nächsten, bis ihr Sohn die Diagnose ASS erhielt, die nicht nur ich anzweifelte). Das verweist auf ein größeres Problem im gegenwärtigen System: Förderressourcen sind nicht bedarfs-, sondern diagnosegesteuert.
Aus professioneller Sicht – auch als selbst von Autismus-Spektrum-Störung betroffene Fachkraft – sehe ich die gegenwärtige Förderlogik kritisch. Der inflationäre Einsatz von Einzelmaßnahmen, deren Wirksamkeit nicht immer nachgewiesen ist, führt dazu, dass Träger teilweise wirtschaftliche Interessen über fachliche stellen. Es entsteht ein Markt an Hilfsangeboten, der sich nicht primär an inklusiver Teilhabe, sondern an Finanzierungslogiken orientiert.
Langfristig ist es notwendig, weg von defizitorientierter Einzelfallförderung hin zu strukturell gestärkter, inklusiver Bildung für alle Kinder zu denken. Eine systematische Umverteilung der Mittel zugunsten eines inklusiven, sozialraumorientierten Schulsystems würde es ermöglichen, vielen Kindern frühzeitig wirksam zu helfen – statt wenigen, unverhältnismäßig aufwändig.
Das Problem ist, dass von der individuellen Förderung immer dann abgewischen wird, wenn man Geld sparen will.
Beispiele wie Ihres kenne ich gar nicht, Kinder sind in der Regel eher unterversorgt. Es ist jedes Mal ein Kampf, überhaupt eine Förderung zu erhalten.
Und Kinder, deren Eltern es nicht schaffen oder wollen, einen Termin beim Arzt, die langen Wartezeiten beim SPZ oder beim Facharzt auf sich zu nehmen und sich schlicht um eine Diagnose zu kümmern, bleiben ohne individuelle Förderung, weil das System hier keinen Förderbedarf sieht.
Inklusion ist in NDS weit umgesetzt, die Ressourcen sind aber minimal und reichen überhaupt nicht aus. Das Land setzt viel zu wenig Personal ein, die Kommunen sind zwar für die Jugendhilfe und damit für Einzelfallhilfen zuständig, wollen aber nicht das strukturelle Defizit des Landes aufarbeiten (müssen).
Dies führt zu der Überlegung, dass Einzelfallhilfen im Pool eingesetzt werden sollen (um Kosten zu sparen), den Kindern selbst also weniger Zeit zusteht oder enge Betreuung nur erschwert zu bekommen ist – was wieder bestimmte Kinder benachteiligt.
Von einem Markt an Hilfsangeboten kann ich wenig erkennen.
@Salia@Palim
Meine Erfahrung aus 40 Dienstjahren als Sonderpädagoge: Sie haben beide Recht. Es gibt Unter- und Überversorgung. Das hängt zum einen vom Engagement, der Ausdauer, den sozialen Netzwerken, dem Bildungsniveau … der Eltern ab und zum anderen von den zuständigen Experten/ Entscheidern/ Behörden …
Einführung des Erzieherstatus für Fachkräfte die als Kinderpflegerin/Spa mit jahrelange Berufserfahrung die in der Kita arbeiten und Fortbildung z.B. Sprachföderkurse ohne Erzieherprüfung einzustellen.
Gehälter erhöhen.
Bezahlte Ausbildung von Fachkräften.
Dann haben wir auch noch das Personal zur Verfügung, dass des Lehrkräftemangel mildern könnte.
Sollte man in 10 Jahren zurückrudern, können diese Personen mit Schulerfahrung zurück in die Erhebung/Forschung gehen.
So wie sich Ihre Beiträge hier lesen: Es fühlt sich wohl gut an, einen Prügelknaben gefunden zu haben, der einmal nicht dem eigenen Wirkungskreis zuzuordnen ist?
Auf wen prügelt @Mika denn Ihrer Meinung nach ein?!
Ob die aktuellen Gehälter auf die geforderten multilingualen Highperformer anziehend wirken? Zweifelhaft. Dieser Plan der Regierung zielt wohl eher darauf ab, durch sinnlose Maßnahmen wie Sprachtests Aktivität im Apperat zu simulieren, um die längst bekannten Probleme nicht angehen zu müssen und in die Zukunft zu verschieben.
// Fazit der Autor:innen: „Eine gute Kita ist eine gute Kita für alle Kinder. Sie braucht keine separierenden Sondermaßnahmen, sondern gut ausgebildete Fachkräfte, vertrauensvolle Beziehungen zu Familien und ein Bildungssystem, das Vielfalt als Ressource begreift.“ //
Wohlfeiles Wohlfühlblabla. Was wissen diese Professorinnen (Mehrheit überraschend weiblich) denn schon von der Praxis?! Eigene Erfahrungen an Schulen oder KiTas haben sie nicht gemacht und die eigenen Kinder sind an Vorzeigeeinrichtungen mit homogener Schülerschaft untergebracht.
// Dabei liefern die Autor:innen auch konkrete Perspektiven für eine wirksame und inklusive Sprachbildung: //
Die darauffolgenden vier Anstriche sind wirklich der BS-Gipfel: Alltagsintegrierte Sprachbildung, Systemische Veränderungen, kindfähig, diversitätssensibel, Translanguaging… ohne Worte!
Nur typisches Blabla aus dem linken Elfenbeinturm – wenn jegliche Unterscheidung in Förderbedürftigkeit schon als Diskriminierung gesehen wird! Spezifische Hilfe und passgenauer Sprachunterricht geht doch nur, wenn man über den Lernstand oder über die eben nicht vorhandenen Sprachfähigkeiten Bescheid weiß, sonst ist das nicht zielführend. Wenn solche Ideologen die Maßnahmen der Bildungspolitik bestimmen, ohne einen Hauch von Ahnung, was in der Realität Sache ist, und ohne jemals vor Ort mit Kindern gearbeitet zu haben, ist es kein Wunder, wenn unsere Bildungsqualität exponentiell abnimmt. Wenn ich schon lese, dass Brügelmann zu den Unterzeichnern gehört, der Erfinder des Schreibens nach Gehör, das – Gott sei Dank – immer weniger in Grundschulen praktiziert wird, dann weiß ich, welche Art von “Experten” hier am Werk sind… Seine Methoden waren unterlassene Hilfeleistung am Kind!
Achtung vor dem Troll-Post von der pädagogischen Fachkraft!
Wo kommt die Wut nur her?
Lasst euch nicht verängstigen. Nie wieder ist jetzt, um auch mal politisch zu färben.
Gegenrede fördert Aufklärung.
Ein weiters Praxisbeispiel für notwendige Online-Sozialarbeit.