BAMBERG. Kinder aus bildungsnahen Haushalten sprechen im Alter von zwei Jahren im Schnitt 60 Wörter mehr als Gleichaltrige aus benachteiligten Familien. Dies zeigt eine neue Studie und macht damit deutlich: Die Weichen für Bildungserfolg oder Misserfolg werden schon in den ersten Lebensjahren gestellt – lange bevor ein Kind eine Schule betritt.

Wichtige sprachliche und soziale Kompetenzen werden schon frühzeitig in der Interaktion zwischen Eltern und ihren Kleinkindern angelegt – und damit auch Bildungsungleichheiten. Ein neuer Transferbericht beleuchtet wichtige Einflüsse der frühen familiären Lernumwelt auf die Entwicklung von Kindern in ihren ersten Lebensjahren. Die Analysen von Daten der Langzeitstudie des Nationalen Bildungspanels (NEPS) zeigen, dass ungleiche soziale und ökonomische Startbedingungen im Elternhaus hierbei eine bedeutende Rolle spielen, und können helfen, früh entstehenden Bildungsungleichheiten durch gezielte Unterstützungsmaßnahmen entgegenzuwirken.
Bereits im Alter von zwei Jahren zeigen sich bedeutsame Unterschiede im Wortschatz und der Grammatikkompetenz von Kindern – beeinflusst durch den sozialen und ökonomischen Hintergrund der Eltern. So verfügten die zweijährigen Kinder aus benachteiligten Familien über rund 97 Wörter (aus einer Liste von 260 Wörtern). Gleichaltrige Kinder aus ressourcenreicheren Haushalten verwendeten nach Angabe ihrer Eltern hingegen bereits 158 dieser Wörter.
Die Autorinnen des Berichts, Dr. Manja Attig (LIfBi – Leibniz-Institut für Bildungsverläufe) und Prof. Dr. Sabine Weinert (Otto-Friedrich-Universität Bamberg) betonen, dass Unterschiede in sprachlichen und sozial-emotionalen Kompetenzen und hiermit zusammenhängende Bildungsungleichheiten nicht erst im Vorschul- oder Schulalter entstehen, sondern ihre Wurzeln bereits in den allerersten Lebensjahren haben.
Qualität der Eltern-Kind-Interaktion: Sensitivität und Anregung als wichtige frühe Einflüsse
Feinfühlige und anregende Interaktionen zwischen Eltern und Kindern haben eine große Bedeutung für die sprachliche und sozial-emotionale Entwicklung der Kinder. Besonders hilfreich sind auch gemeinsame Aktivitäten wie das Betrachten von Bilderbüchern. „Gute sprachliche Fähigkeiten ermöglichen den Kindern bessere soziale Kontakte, bessere soziale Problemlösungen und eine bessere Steuerung eigener Emotionen“, so Professorin Sabine Weinert, Mitautorin des Transferberichts. Die Forschungsergebnisse zeichnen dabei ein differenziertes Bild der verschiedenen Merkmale der frühen Lernumwelt (anregendes und sensitives Interaktionsverhalten; gemeinsames Bilderbuch betrachten), die Kinder erfahren, und der Wirkungen, die diese haben. Jedoch sind bereits im ersten Lebensjahr bedeutsame Zusammenhänge mit den sozialen und ökonomischen Ressourcen der Eltern beobachtbar – auch wenn es innerhalb der sozialen Gruppen jeweils große Unterschiede gibt.
Häufung von Stressfaktoren ist besonders kritisch
Die Analysen der NEPS-Daten legen nahe, dass es Eltern mit sozio-ökonomischen Belastungen – wie geringem Einkommen, niedrigem Bildungsniveau – oft weniger gelingt, entwicklungsförderlich auf ihre Kinder einzugehen. Besonders kritisch wird es, wenn mehrere Stressfaktoren zusammenkommen. In diesen Fällen gelang es den Eltern nur noch sehr eingeschränkt, auf Kinder mit einem herausfordernden Temperament feinfühlig und anregend einzugehen.
Die Autorinnen weisen darauf hin, dass diese Problematik sogar noch unterschätzt sein könnte, da die NEPS-Stichprobe nicht schwerpunktmäßig risikobehaftete Familien untersucht hat. „Unsere Studie zeigt deutlich, dass Unterschiede in der kindlichen Entwicklung schon in frühester Kindheit entstehen. Ziel muss es sein, allen Kindern gerechtere Bildungschancen zu ermöglichen und deshalb Eltern in Risikosituationen so frühzeitig wie möglich Unterstützung zukommen zu lassen, um ungleiche Startbedingungen auszugleichen“, so Dr. Manja Attig, Mit-Autorin der Studie.
Weichenstellung für Bildungserfolg – zahlen sich frühe Unterstützungen aus?
Die Erkenntnisse, die mit Daten aus Beobachtungen und Erhebungen von 3.500 Säuglingen mit ihren Eltern über zwei Jahre hinweg entstanden, unterstreichen die Bedeutung von Maßnahmen, die Familien und ihre Kinder frühzeitig unterstützen. Projekte wie die Bremer Initiative zur Stärkung frühkindlicher Entwicklung (BRISE) schließen an die Erhebungen des Nationalen Bildungspanels an und untersuchen, wie Förderprogramme gezielt auf Risikogruppen wirken können. Die Ergebnisse bieten wertvolle Einblicke, um Bildungsungleichheiten in Deutschland entgegenzuwirken.
Gerade vor dem Hintergrund des schwachen Abschneidens von deutschen Schulkindern in internationalen Vergleichsstudien wie PISA sei es laut Weinert und Attig wichtig, schon in den ersten Lebensjahren für die Familien Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten zu schaffen. News4teachers
Der komplette Transferbericht ist hier zu finden: www.lifbi.de/NFK/02
Das Nationale Bildungspanel (NEPS) ist die größte Langzeit-Bildungsstudie in Deutschland. In 7 Startkohorten werden die Kompetenzentwicklungen und die Bildungsverläufe von insgesamt über 70.000 Teilnehmenden begleitet – von der frühen Kindheit bis ins hohe Erwachsenenalter. Zusätzlich werden etwa 50.000 Personen aus deren Umfeld, wie z.B. Eltern und pädagogisches Fachpersonal, befragt.Getragen wird das NEPS von einem interdisziplinären, deutschlandweiten NEPS-Netzwerk, in dem renommierte Forscherinnen und Forscher mit ihren Teams aus 13 Forschungsinstituten und Universtäten in den verschiedenen NEPS-Bereichen zusammenarbeiten. Beheimatet ist das NEPS am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) in Bamberg. Die Gesamtleitung obliegt Prof. Dr. Cordula Artelt.





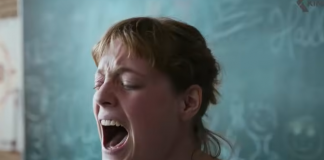




Einmal mehr bestätigt sich die Theorie von Bourdieu, nach der die soziale Herkunft als grundlegendes Element der Bildung und der daraus folgenden Ungleichheiten ausmacht.
Wird sich am Meritokratieprinzip etwas ändern?
Ganz sicher nicht in Deutschland.
Ach… “Die Weichen für Bildungserfolg oder Misserfolg werden schon in den ersten Lebensjahren gestellt...”
Das ist ja ganz was Neues! 🙂
Stimme zu: “Der Ball ist rund” – nee, echt jetzt ?
Dazu fällt mir nix Vernünftiges mehr ein. All diese Plattitüden. schulterzuck.
Jedes Kind hat durch seine Gene spezielle Begabungsfelder, aber die kommen nicht unbedingt von allein zum Vorschein, man muss sie fördern, anregen, Interessen wecken, Erfahrungen ermöglichen. Manche Eltern tun das mehr, andere weniger, die Kita soll ausgleichen, selbstverständlich, aber im Massenbetrieb ist das nicht so gut möglich als bei individueller Fürsorge, egal ob durch Eltern, Tagesmutter oder so. Aber wenn den Sorgeberechtigten alles egal ist, ist es sehr schwierig, das auszugleichen – die Gesellschaft muss sich überlegen, wieviel Geld sie in kleine Kita-Gruppen und Grundschulklassen steckt und wo sie auch massiven Zwang, norfalls gegen die Eltern, ausübt, z. B. durch Kitapflicht oder die Verpflichtung zur Teilnahme an Sprachförderung, besonders wenn zuhause kein oder nur rudimentäres Deutsch gesprochen wird.
kleine Nachtrag:
Georg Schramm wusste es 2008 schon
Loriot hätte gesagt: “Ach was!”
Wieder mal eine Studie, die genau das zeigt, was jede Erzieherin seit 20 Jahren weiß.
Nicht erst seit 20 Jahren, sondern schon wesentlich länger!
…seit 35 Jahren! 🙁
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wenn die Tochter von zwei großen blonden Ärzten groß und blond wird, wundert das niemanden. Dass das die Gene sind weiß jeder und würde auch niemand leugnen.
Aber dass sie Mitte Zwanzig ihren Dr. med. macht liegt daran, dass sie von ihren Eltern besser gefördert wurde? Falsch. Auch das sind überwiegend die Gene. Sie sind im Erwachsenenalter der mit Abstand wichtigste Faktor für die Unterschiede in Intelligenz.
Förderung, auch frühkindliche, erlaubt es den Kindern ihre Potentiale besser zu entfalten. Vergessen dürfen wir dabei aber nicht, dass die Potentiale sehr heterogen verteilt sind. Sonst setzen wir manche Kinder einem Druck aus, dem sie nicht gewachsen sind.
Deutsches Ärzteblatt :
Übersichtsarbeit
Genetik der Intelligenz
https://www.aerzteblatt.de
Sehe ich auch so. Kenne zwei Familien mit mehreren Adoptiv – und Pflegekindern sowie eigenen Kindern, alle wurden sehr gut gefördert . Unter großem Aufwand! Trotzdem, leider, die Unterschiede im Erwachsenenalter könnten größer kaum sein.
Muss noch dazu sagen, dass die angenommenen Kinder ein sehr gutes Sozialverhalten entwickelt haben und, hätte man sie in ihrem Milieu belassen, wesentlich schlechter dran wären.
Aber auch “gute” Gene verkümmern, wenn man Kinder nicht entsprechend fördert und gute Förderung kann auch Gene “optimieren”. So einfach ist das dann doch nicht, alles auf die biologische Schiene zu schieben. Natürlich gibt es biologische Grenzen, doch das Umfeld entscheidet, in welche Richtung eine Entwicklung läuft. Außerdem müssten ja dann alle schlauen Eltern schlaue Kinder haben und dummen Dumme. Wobei man schlau und dumm ja erstmal definieren müsste. Ist aber nicht so, somit scheint Entwicklung möglich. Also sollten die die Eltern vielleicht nicht auf die Kita oder gar die Einschulung warten, sondern vorher selbst schon Mal auf die Beschäftigung mit dem eigenen Kind setzen. Wäre mal eine Maßnahme. Dann klappt es auch mit dem Sprechen.
… im Schnitt 60 Wörter mehr als Gleichaltrige aus benachteiligten Familien.
…beeinflusst durch den sozialen und ökonomischen Hintergrund der Eltern.
Unn nu?
In Deutschland wird doch genau dieser Punkt ( u. a. Bildungsferne der Elternhäuser,…) immer wieder angeprangert, weil die soziale Herkunft nur in Deutschland angeblich eine Rolle spielt, dass unsere SuS bildungstechnisch “abgehängt” werden. Andere Länder gehen mit diesem Problem scheinbar viiiieeel besser um (wie auch immer…?).
Da aber nun (eeeendlich!) feststeht, dass die schulischen Voraussetzungen offensichtlich doch schon quasi “ab Geburt” geschaffen werden, treibt mich die Frage um, ob es denn in den “anderen Ländern” (wo ja scheinbar die schulische Bildung soooo viel toller ist, als bei uns), es da nur Eltern gibt, deren sozialer und ökonomischer Hintergrund
“auf Rosen gebettet” ist, dort keine Armut und Bildungsferne vorhanden ist? Und falls doch:
Was machen die “Länder” mit den Kindern und deren Familien in den ersten 2 Lebensjahren anders bzw besser als Deutschland?
Es gibt auch Latetalker, die mit zwei Jahren kaum Wörter können und dann plötzlich im dritten Jahr in ganzen Sätzen sprechen.
Abgesehen davon verstehe ich nicht, warum man viel Geld benötigen soll, um sein Kleinstkind sprachlich zu fördern. Für Bücher gibt es die Bibliothek, für alles andere die freie Natur, Feste, gemeinsames Einkaufen und viele kostenlose Erlebnisse
Die grundlegenden Kompetenzen gehen aber auch daher zurück, weil viel mehr Frauen immer früher (wieder) arbeiten gehen und die Betreuungseinrichtungen diese Mutter-Kind 1:1 Betreuung, die es früher sehr viel häufiger gab, mit dem ganzen Personalmangel gar nicht ersetzen können, auch wenn die Erzieherinnen tolle Arbeit leisten. Einige Kinder gehen ja schon mit 4-6 Monaten, viele mit 1 Jahr in die Fremdbetreuung. Nach der Arbeit fehlt dann oft die Lust, sich noch viel mit dem eigenen Kind zu beschäftigen, Hauptsache das Kind funktioniert und nervt nicht.
Zum anderen schauen viel mehr Mütter lieber auf ihr Handy als ihren Kindern ins Gesicht. Die Interaktionen kommen gar nicht mehr zustande, die früher normal waren, und so geht viel Entwicklungspotenzial verloren.
Diese Kinder kommen zu den Kindern aus bildungsfernen Familien noch dazu.
100 oder 160… für ein normales Gespräch A1 Niveau sind 450 Worte angesetzt. Heißt das die getesteten Kinder sich im Alter von 2 Jahren nicht normal mit Ihnen Eltern Unterhalten konnten. Wenn es sich nicht um eine Aufnahme und reales durchzählen der Wörter, sondern um einen Ankreuzbogen für Eltern handelt, zeigt das wohl eher, das gebildete Eltern einfach mehr Wörter anhaken.