Das neue Schuljahr startet. Zeit, sich zu fragen, wie es eigentlich weitergehen soll mit der Bildung in Deutschland. Wie soll die Schule der Zukunft aussehen? Was muss sich ändern? Der Bürgerrat Bildung und Lernen diskutiert seit Jahren über diese Frage, immer mit der Beteiligung von Schülerinnen und Schülern. Dabei zeigt sich, dass es Kindern und Jugendlichen vor allem darum geht, selbstbestimmt und mit Freude lernen zu können. Damit sind sie gar nicht so weit weg von dem, was auch manche Politiker inzwischen fordern: Weniger Druck an Schulen!

Die Mitglieder des Jungen Bürgerrats Bildung und Lernen machen im Gespräch eines ganz deutlich: Sie wollen nicht nur unterrichtet werden – sie wollen mitbestimmen, mitgestalten, mitentscheiden. Es geht ihnen darum, nicht die Freude am Lernen zu verlieren. Die Schülerin Gemma aus Ingelheim bringt es auf den Punkt: „Ich stelle mir die Schule der Zukunft so vor, dass Schüler*innen mehr Mitsprache bei den Lerninhalten haben.“
Ihr Bürgerratskollege Luis ergänzt: „Für mich wäre eine Schule der Zukunft eine Schule, in der jeder Schüler und jede Schülerin individuell lernt, so wie er oder sie es am besten kann. Und wo Schülerinnen und Schüler in die Entscheidungen darüber, was sie lernen sollen, involviert werden – entsprechend ihrem Alter und ihrem Lernfortschritt.“
Minister Teuber: Druck und Angst erschweren das Lernen
Der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber (SPD) hat während der Sommerferien in seinem Bundesland eine ähnliche Debatte angestoßen. Er kritisierte den hohen Leistungsdruck in der Schule und sprach sich für eine veränderte Test- und Prüfungskultur aus. „Die Lernforschung weiß seit vielen Jahren, dass Druck und Angst das Lernen erschweren“, sagte Teuber in einem Streitgespräch mit der Wochenzeitung „Die Zeit“, in dem es unter anderem um unangekündigte Tests ging. Weiter kritisierte er: „Kinder sind neugierig von Geburt an, aber leider unternehmen wir einiges, um ihnen die Freude am Lernen auszutreiben.“
Er spricht damit ein Thema an, das Schülerinnen und Schüler in allen Bundesländern derzeit umtreibt: Die Frage nach der mentalen Gesundheit. Die Empfehlung des Ministers lautet daher: noch mehr Beziehungsarbeit und eine zeitgemäße Feedback- und Prüfungskultur in Schulen etablieren. In Rheinland-Pfalz können Schulen im Rahmen der Initiative „Schule der Zukunft“ seit 2021 beispielsweise größere Freiräume erhalten, um neue Lehr- und Lernformen oder alternative Leistungsfeststellungen und Leistungsbeurteilungen auszuprobieren. Teuber: „Wir müssen die Schule so verändern, dass es den Schülerinnen und Schülern an diesem Ort besser geht. Nicht weniger Leistung, sondern das Entfalten, Fördern und Entwickeln von Potenzialen zu Kompetenzen ist unser Ziel.“
Zukunftskongress: Wie könnte Schule im Jahr 2040 aussehen?
Die Initiative „Schule der Zukunft“ und der Bürgerrat Bildung und Lernen haben bereits im Rahmen des Zukunftskongresses eine gemeinsame Aktion durchgeführt, bei der die Visionen junger Menschen im Mittelpunkt standen. Im Workshop „Zukunft – Bitte kommen!“, organisiert vom Bürgerrat Bildung und Lernen, trafen sich rund 30 Schülerinnen von „Schulen der Zukunft“ mit Vertreterinnen der Landesschüler:innenvertretung sowie des jungen Bürgerrats zu einer „Reise in die Zukunft“. Gemeinsam entwickelten sie Ideen, wie Alltag und Schule im Jahr 2040 aussehen könnten.
Für die Schülerin Milla, die seit Jahren aktiv im Bürgerrat Bildung und Lernen mitarbeitet, gehört zu einer Zukunftsschule vor allem mehr Lebensnähe: „Man sollte in der Schule nicht nur Sachen auswendig lernen, sondern auch Dinge fürs Leben lernen, zum Beispiel, wie man mit Geld umgeht, wie man sich selbst besser versteht oder wie man gut mit anderen zusammenarbeitet.“ Sie plädiert außerdem für mehr Projektarbeit und mehr Möglichkeiten, um kreativ sein zu können. „Und dass man nicht nur still rumsitzen muss, sondern sich auch mehr bewegt oder draußen lernt.“
Mina aus Berlin wünscht sich außerdem kleinere Klassen. Dann säßen „keine 30 Schüler (oder wie bei mir 33) in den Klassen, sondern nur noch maximal 20, sodass jedem auch geholfen werden kann, sobald Probleme beim Verstehen entstehen“. Auch sollte es in Zukunft modernere Schulgebäude geben und das Lernen mit digitalen Unterrichtsmaterialien sowie mit Künstlicher Intelligenz zum Standard gehören.
Insgesamt zeigen diese Stimmen aus dem Jungen Bürgerrat und die bildungspolitischen Signale von Minister Teuber, dass die Zeit für Veränderungen gekommen ist. Beide Seiten setzen sich für ein selbstbestimmteres Lernen mit weniger Druck ein. Ihre Aussagen zeigen: Es lohnt sich, Schule neu zu denken – und zwar im Sinne derer, die sie jeden Tag erleben.
Hintergrund:
Der Bürgerrat Bildung und Lernen
Der Bürgerrat Bildung und Lernen wurde von der gemeinnützigen und unabhängigen Montag Stiftung Denkwerkstatt ins Leben gerufen. Seit 2021 haben bereits 700 zufällig ausgeloste Menschen an den Sitzungen des Bürgerrats teilgenommen. Gemeinsam haben sie Empfehlungen für ein gerechteres und zukunftsfähigeres Bildungssystem entwickelt. Auch Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren arbeiten aktiv im Bürgerrat mit, indem sie ihre Perspektiven in die Beratungen des Bürgerrats einbringen.
Weitere Informationen zum Bürgerrat: www.buergerrat-bildung-lernen.de
Über die Montag Stiftung Denkwerkstatt
Die Montag Stiftung Denkwerkstatt ist eine unabhängige gemeinnützige Stiftung und gehört zu den Montag Stiftungen in Bonn. Im Sinne des Leitbilds der Stiftungsgruppe „Handeln und Gestalten in sozialer Verantwortung“ übernimmt sie die Aufgabe, gesellschaftlich relevante, zukunftsweisende Themen aufzuspüren, den konstruktiven Austausch mit Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten zu suchen und soziale Veränderungsprozesse anzustoßen. Die Montag Stiftung Denkwerkstatt konzipiert, moderiert und organisiert Veranstaltungen, Dialogforen und Werkstätten für unterschiedliche Teilnehmerkreise, für Expertinnen und Experten verschiedener Fachgebiete ebenso wie für die allgemeine Öffentlichkeit.
Dies ist eine Pressemitteilung der Montag Stiftung Denkwerkstatt.
Bürgerrat-Talk über Schulnoten: Gerechter bewerten – oder bewährtes System behalten?






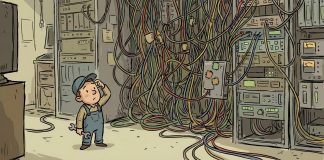



Ich übersetze das mal: Schüler möchten machen, was sie wollen und alle nur möglichen Freiräume, damit die mentale Gesundheit nicht leidet. Um die Freude am “Lernen” aufrecht zu erhalten, müssen “Chillen am Handy”, “Fortnite” und “Influencertum” mit in die neuen Lehrpläne.
Muss “Lernen” denn immer Freude bereiten? Im Idealfall tut sie das. Aber ich hätte ohne Druck nie Fahrradfahren oder Schwimmen gelernt. Irgendwann waren die Stützräder und die Schwimmflügel weg. Zähneputzen? Mag ich nicht, nur mit Druck der Eltern (und des Zahnarztes) erkennt man die Notwendigkeit. Schüler haben in der Regel überhaupt keine Lust aufs Lesen. In bildungsfernen Familien findet sich kein einziges Buch zuhause. Wenn die Leselust ausbleibt, wie soll Schule dem begegnen? Ich hoffe auf eine adäquate Antwort des Bürgerrates.
Teuber: „Wir müssen die Schule so verändern, dass es den Schülerinnen und Schülern an diesem Ort besser geht. Nicht weniger Leistung, sondern das Entfalten, Fördern und Entwickeln von Potenzialen zu Kompetenzen ist unser Ziel.“
Ja, da kommen einem wirklich fast die Tränen, was für grausame Orte Schulen inzwischen doch geworden sind. Manches Potenzial wird nunmal nur durch Druck zur Kompetenz. Ansonsten bekommen wir genau das, was Herr Teuber nicht möchte: Weniger Leistung.
Der 12-jährige Sergio will unbedingt Fußballer werden und interessiert sich nicht für Mathe, Englisch, Physik oder Bücher. Der macht dann nur noch Sport oder wie stellt sich Herr Teuber das vor?
In Rh-Pf sind im kommenden März Landtagswahlen.
Die Eltern lesen/hören das doch gern, da es genau den Weg weiter verfolgt, der bereits eingeschlagen wurde:
Individuelle (gern auch sofortige) Bedürfnisbefriedigung und bloß kein Druck oder Zwang, selbstständiges Arbeiten ohne Pflicht oder Verantwortung.
“Das ist doch dann schön für meine Kinder.”
Gibt doch genug Schulen wo sowas schon praktiziert wird.
Ist für Lehrer auch deutlich entspannter als konstant Druck auf dem Kessel und am Abend mit Tränen in den Augen das Elend mit Schnaps und Bier verdrängen.
Warum Fragen wie Herr Teuber sich das vorstellt, einfach selber in diesem “Neuland” informieren!
Mentale Gesundheit leidet unter der Schule? Aha. Ansonsten gibt es wohl keine Probleme, so mit Handy, Freizeit, Eltern usw.? Nur die Schule ist der Ort massiver Traumatisierung?
Wenn dann mal alle Schulen so sind, wie vom Bürgerrat gewünscht, wenn alle Noten und Zeugnisse und Hausaufgaben abgeschafft sind, wenn jeder lernt was er will und wann er will und alle Kinder gemeinsam nur noch eine Schulart besuchen, wird man feststellen, dass sich nichts verbessert hat: Es wird dieselbe Anzahl an psychischen Problemen und Diagnosen geben, die Aufmerksamkeitsspannen werden nicht gestiegen und Bildschirmzeiten nicht gesunken sein, Lesen wird den meisten Schülern noch immer keinen Spaß machen – nur die Forderung wird gleich bleiben: “Schule muss sich verändern!”
Ach Rüdiger, die Jugend wird halt immer schlimmer! Früher war alles besser!!!111
Welch “fundierter” Komnentar!
(Ist da etwa jemand angep*ßt” ob des mangelden Zuspruchs des “Fußvolkes”?)
Ach, Sven… (Ich darf doch so vertraulich, oder?)
Welch’ fundierter Kommentar!
Oder höre ich da etwa leichte Indigniertheit ob der Ignoranz des Fuß-(um nicht zu sagen “Front-“)Volkes heraus?
Im Zusammenhang fällt mir noch ein schönes anderes Beispiel ein: Fahrschulen. Immer mehr Fahrschüler schaffen die Prüfungen nicht mehr. An was mag es liegen? Arbeiten die Fahrschulen nicht mehr gut genug? Oder liegts vielleicht doch an den Schülern (die heute dank Internet und KI wesentlich mehr Möglichkeiten zum Lernen haben als wir früher)?
Das Lernen der Verkehrsregeln machte mir im Übrigen auch keinen Spaß – das Autofahren hingegen schon. So wie der Bürgerrat bisher argumentiert, kommt er nun gewiss auf die Idee, die Verkehrsregeln abschaffen zu wollen.
“Die hohe Durchfallquote bei Führerscheinprüfungen lässt sich auf verschiedene Ursachen zurückführen. Zum einen sind die Prüfungsanforderungen in den letzten Jahren deutlich gestiegen. (…) Ein weiterer Grund für das Scheitern vieler Fahrschüler liegt in der mangelhaften Vorbereitung in den Fahrschulen.” Quelle: https://www.meg-denkwelt.at/blog/warum-so-viele-fahrsch%C3%BCler-durch-die-f%C3%BChrerscheinpr%C3%BCfung-fallen
Manchmal lohnt es sich, Kurzschlüsse wie “junge Menschen sind doof und faul” zu hinterfragen.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Sie führen hier als Quelle eine Seite auf, die Lern- und Prüfungscoachings verkauft und dort Türen einrennt, wo jeder über gestiegene Anforderungen klagt/jammert.
Und was heißt hier mangelhafte Vorbereitung der Fahrschulen? Für die theoretische Prüfung muss ich die Bögen und somit die Verkehrsregeln auswendig lernen. Dazu muss ich mich halt selbst damit befassen und auf den Hosenboden setzen.
Ich seh halt nach wie vor die Eigenverantwortung. Wenn ich eine Prüfung nicht bestehe, bin primär ich schuld und nicht die Schule, nicht der Lehrer und auch nicht die Prüfung selbst.
Das sehen Sie vollkommen falsch! Denn Fahrschule, Fahrlehrer und Fahrprüfung – da ist doch klar, wer Schuld hat! Die armen Schüler können nichts dafür! 🙂
Funfact: Ich bin im Alter von 17 Jahren und als Schüler der Oberstufe auch einmal durch die Theorieprüfung gefallen. Grund: Ich hatte mich nicht gut genug darauf vorbereitet und mich darauf verlassen, dass es schon irgendwie klappen würde. Den zweiten Anlauf habe ich dann mit 0 Fehlern bestanden, aber auch wesentlich mehr Zeit ins Lernen investiert. Klausuren in der Schule hatte ich ganz nebenbei im Übrigen auch noch. Und um es komplett zu machen: Ich stamme aus einer reinen Arbeiterfamilie.
Machte das alles immer Spaß? Nein. Aber man lernt, dass man auch mal Täler durchschreiten muss, ehe man auf dem Gipfel ankommt.
Das ist doch das beste Argument für freies lernen. Aus Fehlern lernen anstatt durch Druck und Zwang.
Die Verkehrsregeln sind eben bis zum Führerschein vielen unbekannt, weil man ja auf der Reise und im Auto nur aufs Tablett glotzt und nicht aus dem Fenster. So wie wir früher, Kennzeichen gucken, Schilder gucken, Verkehr beobachten. Und alleine zur Schule gehen, ohne Elterntaxi. Hilft schon Mal für die Grundlagen.
Statt schwarz und weiß gibt es ja auch Grautöne: Ja, die Anforderungen sind gestiegen, andererseits können ein paar Wochen Fahrschule nicht ausgleichen, was man an Gefühl und Umsicht für Verkehrssituationen nicht entwickelt, weil man beim Mitfahren jahrelang nicht aus dem Fenster guckt, nicht wie nebenbei den Verkehr beobachtet, sondern einfach nur die Augen auf die kleine Daddelkiste richtet. Gegen Dummheit, äääh Smartphones kämpfen Fahrschulen selbst vergebens…
Nach meiner Erfahrung werden die Fahrschüler nicht nur in den Fahrschulen, sondern mithilfe einer ziemlich gut funktionierenden App auf die Theorieprüfung vorbereitet – oder nein, sie bereiten sich zum großen Teil selbst vor.
Sie müssen sich mit den denkbaren Prüfungsfragen intensiv befassen, sie wiederholen und so von “Rot” über “Gelb” nach “Grün” schaffen, jedenfalls so in etwa. Dann gelten sie als gelernt.
Dafür muss der Fahrschüler SEHR viel Zeit mit diesen Fragen verbringen.
EIGENTLICH doch das, was von den Aggressiv-Progressiven immer propagiert wird: Eigenständiges Lernen.
Wer es schafft, besteht auch die Theorieprüfung.
Das ist das, was die Firmen in der aktuellen Lage machen:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/arbeitsmarkt/auszubildende-lehrstellen-fachkraefte-rezession-ausbildung-100.html
Knapp 500 Lehrlinge von über 8000 Bewerber bei BASF dürfen die Lehre aufnehmen.
Da wird sicherlich der junge, “überforderte” Jammerlappen genommen (Scherz).
DIHK: grundlegende Fähigkeiten (ich ergänze mal “und Fertigkeiten, Wissen und Können”) werden verlangt… Pünktlichkeit, Freundlichkeit,… Mathe, Deutsch, das wird von den Lehrlingen verlangt.
Und nun?
Ein weiteres Zitat aus dem verlinkten Artikel:
Aber es fehle laut DIHK nicht nur an Quantität von Azubis, sondern auch oft an deren Qualität. “Es mangelt an Basiskenntnissen: Zuverlässigkeit, Lernbereitschaft, Einsatzwille und Lesen, Schreiben, Rechnen. Wer das nicht mitbringt, wird es im Berufsleben insgesamt schwer haben”, sagt Dercks. “Wir brauchen in den Schulen wieder einen Fokus auf die grundlegenden Fähigkeiten.”
Das, was die Wirtschaft braucht und möchte, klingt nach dem genauen Gegenteil von dem, was Bürgerrat und einige Politiker sich für Schulen vorstellen. Wohlstand und Sozialsystem müssen irgendwie erarbeitet werden, auch wenn heuer viele so tun, als seien sie Grundrecht und vom Himmel gefallen.
Wer ist denn “die” Wirtschaft? Es gibt Unternehmen, die Menschen lediglich dafür beschäftigen, Maschinen zu bedienen, und es gibt Unternehmen, die Menschen dafür beschäftigen, Lösungen zu finden – die werden schon mal sehr unterschiedliche Ansprüche an den Berufsnachwuchs stellen.
Und: “Eine aktuelle Auswertung von Stellenausschreibungen zeigt, dass Teamfähigkeit mit Abstand an erster Stelle der Bewerberanforderungen steht” – also eine Kompetenz, die bislang gar nicht in der Schule vermittelt wird. Quelle: https://www.personalwirtschaft.de/news/recruiting/die-wichtigste-soft-skill-anforderung-von-unternehmen-an-bewerber-ist-teamfaehigkeiten-vor-allem-teamfaehigkei-98260/
Soll heißen: Die Realität ist nicht immer so platt, wie sie das Vorurteil gerne sieht.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Mit “die” Wirtschaft sind unter anderem jene Firmen und Personen gemeint, die in dem Artikel zur Sprache kommen. Die zeigen ja ganz eindeutig, in welche Richtung es gehen soll, wenn es um das Thema “Ausbildung” geht.
Teamfähigkeit spielt in Schulen doch in Gruppen- und Projektarbeiten durchaus eine Rolle. Wenn allerdings jeder, wie in Gemeinschaftsschulen, an seinem individuellen Lernwegeplan arbeitet, gerade das macht, worauf er Lust hat und Einzelcoachings bei den Lernbegleitern besucht, findet doch noch viel weniger Teamarbeit statt als in einem Klassenverband.
Noch immer frage ich mich zudem, was die fordernden Schüler im Gegenzug anzubieten haben. Wenn sie sich beispielsweise verpflichten, die Bildschirmzeiten von 7 Stunden am Tag auf 2 Stunden täglich zu reduzieren, könnten ja Zugeständnisse gemacht werden. Ich sag es immer wieder: Probleme entstehen nicht (nur) in der Schule, auch wenn dies gerne suggeriert wird.
Wir sind auch Wirtschaft – und sehen das ganz anders. Wir benötigen junge Menschen, die es gelernt haben, teamfähig zu sein (nicht nur in zwei Projekten während einer ganzen Schullaufbahn), die kreativ sind und selbstständig denken und gut kommunizieren können – also vieles mitbringen, was Regelschulen nicht vermitteln.
Und nun?
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Offensichtlich vermittelte Schule in all den Jahren zuvor aber genug, um eine funktionierende Wirtschaft (inkl. Ihrer) am Laufen zu halten. Mit all den Bildungsexperimenten und Kompetenzausrichtungen der letzten begann der Abstieg doch… Zumindest kam es seitdem zu keinem Aufstieg mehr.
Von meinen Kindern kann ich durchaus sagen, dass sie teamfähig sind, sowohl als Geschwisterpaar, als auch im Umgang mit anderen. Kommunizieren? Ja, neuerdings kann jeder sehr gut seine Bedürfnisse und Forderungen kommunizieren. Das scheint also wenigstens zu funktionieren. Kreativität und selbstständiges Denken? Das lassen sich die Kids inzwischen von sozialen Medien und der KI abnehmen. Schule tut da noch ihr Möglichstes.
“Mit all den Bildungsexperimenten und Kompetenzausrichtungen der letzten begann der Abstieg doch… Zumindest kam es seitdem zu keinem Aufstieg mehr.”
Steile These – die Modernisierung der Lehrpläne seit dem PISA-Schock aus dem Jahr 2000 ist Schuld daran, dass die deutsche Industrie die Digitalisierung verschlafen hat und an überkommenen Produkten (wie dem Verbrenner) klebt? Dass aufgrund der Demografie immer weniger Fachkräfte zur Verfügung stehen? Dass die deutsche Autoindustrie geglaubt hat, folgenlos ihre Kunden auf der ganzen Welt bescheißen zu können? Dass die Führungsetage des ehemaligen Weltkonzerns Bayer mit ihrer desaströsen, umweltfeindlichen Einkaufspolitik (Monsanto) das Unternehmen an den Rand des Zusammenbruchs geführt hat? Dass ein Konzern wie die Deutsche Bahn keine zwei Züge mehr hintereinander pünktlich in einen Bahnhof bekommt?
Wir dachten immer, dass die saturierten, denkfaulen, mit wenig Weitblick ausgestatteten, nur an kurzfristigen Gewinnen und doch eher älteren Manager der Großindustrie den Karren in den Dreck gesteuert haben – aber wenn’s die paar wenigen Schulreformen waren, na dann.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Um was genau gehts denn jetzt hier? Ich dachte, primär um Schulen. Alle Entwicklungen der letzten Jahre führten weder zu leistungsfähigeren oder psychisch stabileren Schülern, noch zu entlasteteren Lehrkräften. Aber man macht munter so weiter und jagt eine Reform nach der nächsten durch insgesamt 16 verschiedene Bildungssysteme, die allesamt dazu führten, dass die Anforderungen sanken. Und da kommt nun der Bürgerrat und fordert mittendrin das weitere Absenken von Anforderungen und mehr Mitbestimmung für Schüler, die jedoch immer weniger “auf die Kette kriegen”.
Natürlich haben wir es gesamtgesellschaftlich mit verschiedensten Phänomenen zu tun. Was ich mir ehrlich wünsche – und das lasse ich in vielen meiner Kommentare der letzten Tage anklingen – eine Rückkehr zu Eigenverantwortung und Disziplin und somit zu dem, was auch Sie fordern: Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, kreatives Denken bei Problemlösungen. Dies erreichen Sie nicht, wenn immer andere (die Gesellschaft, die Schule, der Staat) für Sie die Probleme lösen sollen oder wenn sie gerade lieber etwas anderes tun möchten, was mehr Spaß und Freude bringt. Um teamfähig zu werden, muss ich zunächst Verantwortung für mich selbst übernehmen können, ansonsten klappt auch das nicht.
“Um was genau gehts denn jetzt hier? Ich dachte, primär um Schulen.”
Genau, um ein Schulsystem, das Schülerinnen und Schüler auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet – was ohne Freude am Lernen zu vermitteln kaum machbar sein wird. Dass die Rezepte von gestern “Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, kreatives Denken” gefördert haben, wagen wir zu bezweifeln.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Kopf Kratz… jetzt interessiert mich schon, was Sie meinen, was Regelschulen noch vermitteln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Großteil ihrer Leserschaft aus Drillmonstern besteht, die jede Kreativität, jeden originellen Gedanken, ein echtes Miteinander. jede Kommunikation gleich im Keim ersticken wollen – im Gegenteil! Und genau dafür reißen wir uns nämlich täglich den Allerwertesten auf.
“Kreatives Denken ist an Schulen in Deutschland seltener gefragt.” Gerne hier nachlesen: https://deutsches-schulportal.de/unterricht/pisa-kreatives-denken-ist-an-schulen-in-deutschland-seltener-gefragt/
Und Teamwork? Oder die anderen Future Skills? Wäre uns neu, wenn diese Kompetenzen in den Lehrplänen tatsächlich eine Rolle spielen würden. Gibt aber tatsächlich Schulen, die hier vorangehen: https://www.change-magazin.de/de/future-skills-im-unterricht-diese-schule-zeigt-wie-es-geht
Ist übrigens eine Kritik am System, keine an der Arbeit von Lehrkräften: Wenn am Ende doch nur Einzelleistungen zählen, nützt der teamorientierteste Unterricht wenig.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Danke für die Artikel, aber so richtig schlau werde ich aus ihnen irgendwie auch nicht.
Die Schule im zweiten Artikel setzt also auf schauspielerische Darstellungen von Filmszenen, auf den Einsatz von iPads, auf ChatGPT und auf Präsentationen, die benotet werden. Gut, das alles tun die mir bekannten Schulen ebenfalls, vor allen Dingen in den Nebenfächern und das in verschiedenartigstem Umfang. Manche mehr, manche weniger. Hängt auch von der jeweiligen Lehrkraft ab. Projekte und Projekttage gehören ebenfalls zum Schulalltag. Warum wird hier immer noch so getan, als fände an den Schulen der meiste Unterricht frontal und mit dem Schulbuch statt? Meine Tochter hatte an der Realschule und hat jetzt am beruflichen Gymnasium ebenfalls verschiedene Prüfungsformate. So ganz ist mir also nicht klar, was besagte Schule so anders macht als andere.
Bei Gruppenpräsentationen möchte am Ende aber doch jeder seine individuelle Note. Mein Sohn musste im letzten Schuljahr sein Praktikum in einer Gruppe vor der Klasse präsentieren. Einige seiner Mitschüler machten jedoch in der Vorbereitung wenig bis gar nichts. Nicht umsonst wird die Abkürzung “TEAM” mit “Toll, ein anderer machts” persifliert.
Im echten Leben dann nicht mehr. Da zählt dann, was ein Team zustandebringt – und nicht, ob Hans darin geglänzt hat. Erstaunlich, dass Sie – durchaus zu Recht – fordern, junge Menschen müssten auf die Herausforderungen im Beruf vorbereitet werden. Dass Sie diese Herausforderungen im Beruf, in den meisten zumindest, aber gar nicht zu kennen scheinen.
Soziale Kompetenzen gehören entscheidend dazu. Wir wüssten aber nicht, dass die Schule alter Prägung diese sozialen Kompetenzen vermittelt. Schon dieser Umstand schreit nach Reformen.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Die 10 wichtigsten sozialen Kompetenzen:
“Wir wüssten aber nicht, dass die Schule alter Prägung diese sozialen Kompetenzen vermittelt.” – schreiben Sie, liebe Redaktion.
Da frage ich mich aber: Wie hat unsere Gesellschaft die letzten Jahrzehnte überleben können? Oder wo und von wem haben die Menschen diese Kompetenzen erlernt?
https://www.glassdoor.de/blog/was-ist-soziale-kompetenz/
Auf den Punkt!
Danke!
Ich würde sogar noch weitergehen und die These in den Raum stellen, dass obengenannten Kompetenzen bei Menschen, die “Schule alter Prägung”
(bitte genauer definieren, danke!) durchlaufen haben, haufig stärker ausgeprägt sind als bei heutigen Absolventen.
Teamfähigkeit spielt in meinem Beruf selbstvertändlich auch eine große Rolle. Dazu gehört es, nicht bei jedem auftretenden Problem die Flinte ins Korn zu werfen oder über die Umstände zu jammern. Ich kann nicht jegliche Herausforderung ablehnen und gleichzeitig erwarten, dass ich den Teamgedanken dadurch fördere. Das fängt beim Kinderfußball an, wo nicht mal mehr Tore gezählt werden und möglichst alle als Sieger vom Platz gehen sollen.
Was ist denn “Schule alter Prägung”? Die Drillschule aus den 70ern war dahingehend gewiss nicht gewinnbringend, da bin ich bei Ihnen. Aber über welchen Zeitraum reden wir? Ich würde mich schon als Teamplayer bezeichnen und ich machte mein Abi vor über 20 Jahren.
Beißen sich nicht Begriffe wie individuelles Arbeiten an was ich gerade will und individuelle Förderung mit dem Teamgedanken? Beklagen wir nicht seit Jahren eine Zunahme von Egoismus und eigenem Vorteil? Seit ich in der sozialen Arbeit tätig und mit Schulen sowie Lehrkräften in Kontakt bin, hat sich eben rein gar nichts verbessert – nicht für Schüler und nicht für Lehrerinnen und Lehrer, obwohl Reformer und Politik genau das versprachen. Das Gegenteil ist eingetreten. Wir haben immer mehr Fälle, die wir bearbeiten müssen.
Natürlich möchte ich all dies nicht auf Schulentwicklung alleine runterbrechen. Doch wenn ich die Forderungen des Bürgerrates lese, sehe ich mehr Holzweg denn Euphorie.
Indidviduelle Förderung beißt sich keineswegs mit dem Teamgedanken – um bei der Analogie Fußball zu bleiben: Es macht schon Sinn, zum Beispiel dem Torwart ein spezielles Training angedeihen zu lassen. Trotzdem gewinnt oder verliert er mit der Mannschaft.
“Seit ich in der sozialen Arbeit tätig und mit Schulen sowie Lehrkräften in Kontakt bin, hat sich eben rein gar nichts verbessert.” Kein Wunder: Es hat ja gar keine Reformen gegeben, die Wirkung hätten bringen können. Das größte Bildungsproblem in Deutschland, seit 25 Jahren (1. PISA-Studie) bekannt, ist die mangelhafte Förderung von Kindern aus sozial schwachen Familien. Die größte und mit Abstand teuerste bildungspolitische Reform nach PISA 2000 war: G8 – hin und her.
Gerne hier nachlesen: https://www.news4teachers.de/2024/05/bildungsforscher-ziehen-bilanz-fast-alle-schulpolitischen-massnahmen-seit-dem-ersten-pisa-schock-sind-gescheitert/
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Kein Wunder: Es hat ja gar keine Reformen gegeben, die Wirkung hätten bringen können.
Warum hat man sie dann durchgeboxt und als den “heißen Shit” verkauft? Ich bleibe als Negativbeispiel beim Aufweichen des gegliederten Schulsystems. Anstatt in homogenen Gruppen zu fördern, hat man sie heterogener werden lassen und eine Lehrkraft soll nun möglichst alle Niveaus abbilden. Ja, klappt nicht – also mehr davon?
Das größte Bildungsproblem in Deutschland, seit 25 Jahren (1. PISA-Studie) bekannt, ist die mangelhafte Förderung von Kindern aus sozial schwachen Familien.
Ja, wir fördert man solche Kinder am besten? Am ehesten mit verpflichtender Vorschule sowie Ganztagsangeboten und natürlich mit uns aus der sozialen Arbeit. Ich gebe aber gerne noch das Quentchen “Eigenverantwortung” mit rein. Wir zeigen bildungsfernen und sozial schwachen Familien immer wieder Lösungswege auf, die jedoch auch mit Arbeit und eigenem Antrieb verbunden sind. Wir können die Wege nur zeigen, laufen muss jeder selbst.
“Im echten Leben dann nicht mehr. Da zählt dann, was ein Team zustandebringt – und nicht, ob Hans darin geglänzt hat.”
Im echten Leben bringt man aber Menschen mit verschiedenen Expertisen in ein Team ein, so dass sie ein großes Projekt stemmen können.
Und nein, wenn Hans im Team nicht mitarbeitet, dann wird das im echten Leben Konsequenzen haben. Sollten wir also Schülern kündigen, weil das im Arbeitsleben auch so ist?
Auch im echten Leben werden übrigens einzelne Personen befördert und nicht alle Mitglieder eines Teams…
Kann man Teamfähigkeit denn in der Schule (oder überhaupt) lernen?
Behauptet wird es oft, aber ich habe da meine Zweifel.
Als Schüler haben wir in der Schule NIE wirklich Gruppenarbeit gemacht, aber an der Uni ging das wie von selbst.
Eine meiner Schülerinnen galt als absolut teamunfähig – bis sie in einem Begabtenprojekt mit Kindern anderer Schulen zusammenkam, mit denen sie interessenmäßig zusammenpasste. Da mutierte sie zur begeisterten Team-Playerin.
In Schulen sieht Teamarbeit oft so aus, dass einer die inhaltliche Arbeit macht, einer kümmert sich um die Präsentation, der Rest macht eher nix.
Meiner Ansicht nach funktioniert Teamfähigkeit nur, wenn die Mitarbgeiter nicht allzu introvertiert sind und sie die Thematik interessiert / irgendwie intrinsisch Druck oder Motivation vorliegt.
Dann könnte man sie aber nicht lernen, allenfalls etwas einüben.
“Kann man Teamfähigkeit denn in der Schule (oder überhaupt) lernen?”
Nicht solange Lernen kompetitiv verstanden wird – Schülerinnen und Schülern wird früh beigebracht, dass sie gute Noten bekommen, wenn sie besser sind als andere.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Ich denke auch, dass Wettbewerb eher die Teamfähigkeit hemmt.
Zusätzlich würde sogar die steile These aufstellen, dass Noten dazu führen, dass SuS nicht mehr lernen, sondern nur soviel, wie es für eine gute Note braucht. Das Ziel verschiebt sich nach und nach – man will nicht mehr wissen, man will nur eine gute Note.
Stimmt. Aber damit wäre ich schon zufrieden!!
Der Chef beziehungsweise der Kunde möchte später Leistung für das Geld.
Das geht Schülerinnen und Schülern nicht anders.
Die kaufen auch nichts Schlechtes, wenn es ein paar Meter weiter für denselben Preis etwas Besseres gibt.
Die bleiben nicht im schmutzigen Fitnessstudio mit Geräten, die nicht gewartet werden, obwohl das Team total nett ist und sich alle gut verstehen. Die gehen dahin, wo jemand ordentlich bis in die Ecken hinter den Toiletten und in der Dusche putzt, auch wenn das sicherlich keinen Spaß macht.
Und die Leute im ordentlichen Studio putzen und reparieren nur deshalb, weil sie in einem harten Wettbewerb stehen. Sonst könnten sie gelegentlich zumindest mal faul sein, aber die junge Klientel macht sofort ein Foto, das auf sozialen Medien erscheint: ey voll eklig in Studio X …
Die jungen Leute wissen ganz genau, was Wettbewerb ist und dass sie ein Teil davon sind.
Verstehe nicht, was Ihr Kommentar mit meinem zu tun hat.
Ich habe nie behauptet, dass junge Leute nicht wüssten, was Wettbewerb ist.
Ich denke aber, dass Wettbewerb hinderlich für Teamfähigkeit sein kann. Außer der Wettbewerb läuft so: unsere Team gegen andere Teams. Ansonsten wäre Wettbewerb innerhalb eines Teams Gift.
Da muss ich Ihnen widersprechen: Es reicht auch gleich gut zu sein wie andere. Jeder hat die Chance auf eine 1. Und da wie nicht beim Lotto sind, kann jeder mit entsprechender Leistung eine 1 bekommen. Kompetitiv wäre es, wenn jede Note genau ein einziges Mal vergeben würde. Dem ist ja aber nicht so.
“‘Noten sind halt ungerecht, aber was willste machen’, das bekomme er immer wieder von Lehrkräften zu hören. Der Bildungsforscher Hans Anant Prant sprach böse lächelnd von ‘melancholischer Resignation’. Dabei handele es sich bei Zensuren immerhin um ein zentrales Instrument des Bildungssystems. Es gebe für Noten drei mögliche Bezugsnormen: eine individuelle (hat sich der Schüler verbessert?), eine soziale (wo steht er im Verhältnis zum Rest der Klasse?) und eine sachliche (erfüllt er fixierte Kriterien?). ‘Was ist die häufigste, die Lehrer verwenden? Genau: die soziale. Sie schauen, was im unmittelbaren Lernumfeld geschieht.’ Dumm nur: Diese Bezugsnorm sähen die Schulgesetze gar nicht vor.” Gerne hier nachlesen: https://www.news4teachers.de/2024/04/konfbd24-wie-kuenstliche-intelligenz-die-schule-veraendern-wird-und-womoeglich-sogar-gerechter-macht/
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Man bekommt nicht gute Noten, wenn man “besser ist als andere”, sondern wenn man gut ist. Da ist kein Wettbewerb inkludiert, obwohl manche Schüler oder Eltern einen daraus machen mögen.
Ich habe Klassenarbeiten, da gibt es viele gute Noten – in anderen wiederum gar keine.
Danke. Gut sein genügt. Das nimmt Druck raus. Gleichzeitig ist es gesund, gut sein zu wollen. Das sollte schulisch und gesellschaftlich gefördert und gefordert werden. Wie gut jemand sein kann, ist immer individuell.
Dafür sind auch Noten gut. Das ist eine wichtige Information von außen über die individuelle Leistung innerhalb einer Gruppe.
Wie wird das Ergebnis einer Teamarbeit nach den „neuen“ Vorstellungen in der Zukunft dann bewertet? Sind dann alle Ergebnisse gleichwertig, auch wenn in
Gruppe 1 zwei Personen von fünf sich richtig reinhängen, während drei keine Lust haben und das Ergebnis super ist,
in Gruppe 2 mit großer Begeisterung alle miteinander ein tolles Ergebnis haben , das allerdings stark das Thema verfehlt und
Gruppe 3 sich zwar im Team stark mit dem Thema auseinander gesetzt hat, aufgrund der Inhomogenität aber die Zeit verbraucht hat, um überhaupt zusammen zu finden und aufgrund fehlender Zeit lediglich eine Grundform zum Ergebnis finden konnte?
Da fängt womöglich das Problem an: Es muss in Schule alles individuell bewertet werden – warum eigentlich? Wie wäre es, man betrachtet das Ergebnis von Teamarbeit mal tatsächlich als Teamarbeit (wie im richtigen Leben)? Wenn man dann unbedingt noch eine Einzelleistung bewerten will, hängt man einfach noch ein Kolloquium dran.
Das ist das Wertvolle an den Empfehlungen des Bürgerrats: Man kommt mal über den Tellerrand des bislang Üblichen hinaus.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Das mit dem Kolloquium habe ich meinen Schülern zuletzt genau so angekündigt – als Ergänzung der Bewertung ihres Vortrages an sich. Es ging aber weniger um Teamarbeit, als um den KI-Einsatz, der die individuelle Bewertung einer zu Hause erstellten Präsentation de facto unmöglich macht.
Warum in der Schule alles individuell bewertet werden muss? Nun, einerseits steht es so wohl irgendwo im Gesetz. Das recherchiere ich vielleicht irgendwann noch mal…
Andererseits sprechen Fairnessgründe sehr dafür, dass z. B. das fleißige/fähige Individuum nicht von seiner Gurkentruppe in den Keller gezogen wird bzw. umgekehrt der Laumeier die guten Leistungen seiner Teampartner ausnutzt.
Die Betrachtung einer Teamarbeit als tatsächliche Teamarbeit wäre in der Schule, so ganz pauschal, faktisch falsch.
Gibt es im echten Leben diese Schwierigkeit vielleicht nicht?
“Die Betrachtung einer Teamarbeit als tatsächliche Teamarbeit wäre in der Schule, so ganz pauschal, faktisch falsch.”
Die Folge ist dann eben, dass Schule am echten Leben vorbei erzieht – kann man gut finden, muss man aber nicht.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Also waren/sind alle früheren Generationen, die noch mit Frontalunterricht, Noten, Hausaufgaben, … sozialisiert wurden, unfähig zu Teamarbeit?
https://blog.eidam-und-partner.de/kollektivist-oder-individualist-kulturelle-unterschiede-beim-gruppenverhalten/
https://askanydifference.com/de/individualism-vs-collectivism/
Sie haben diese Fähigkeit auf jeden Fall nicht in der Schule gelernt. Herzliche Grüße Die Redaktion
Ja aber wo denn dann?
Schule ist also nicht der Hauptfaktor für die Entwicklung von Teamfähigkeit? Welche Faktoren sind es denn dann?
Als Beispiele von Teamfähigkeit ohne Schule fällt mir der Kinderbuchklassiker von Erich Kästner ein “Emil und die Detektive”. Oder, um meinen “Ruf als Ossi” zu bestätigen “Timur und sein Trupp” von Arkadi Gaidar.
Und warum gab es “Teamfähigkeit” schon bei den Urmenschen und bei Naturvölkern …völlig ohne Schule? Was läuft heute in unserer Gesellschaft schief, dass anscheinend allein die Schule die Teamfähigkeit herausbilden kann/soll?
https://www.deutschlandfunk.de/kooperation-nicht-nur-unter-verwandten-100.html
https://teamworks-gmbh.de/die-geschichte-teamarbeit-steinzeit-bis-mittelalter-folge-1/
“In Schulen sieht Teamarbeit oft so aus, dass einer die inhaltliche Arbeit macht, einer kümmert sich um die Präsentation, der Rest macht eher nix.”
Da stimme ich Ihnen zu, aber woran liegt das? Vielleicht daran, dass die Kids erstmal lernen müssen, wie das genau geht. Wie sieht die Aufgabenstellung konkret aus, wer hat diesmal den Hut auf und koordiniert die Aufgaben, wie verteile ich die Aufgaben? Wie führt man am besten die Ergebnisse zusammen und wer macht dann die Präsentation fertig bzw. hält sie? Bevor das nicht klar geklärt ist und dem LuL mitgeteilt wurde, geht es nicht weiter. Da braucht es vermutlich zu Beginn viel Unterstützung von den LuL, bis die SuS genau wissen, wie das genau abläufen sollte. Dadurch fühlt es sich dann auch nicht mehr so unfair für die an, die immer alle Aufgaben übernehmen.
Das klingt in der Theorie gut, aber im System Schule kann es nicht funktionieren, da die Sanktionsmögichkeiten zu begrenzt sind. Als Lehrer kann ich den individuellen Anteil am Gruppenergebnis schlecht feststellen. Und dann lehnen sich die faulen Socken entspannt zurück, die Leistungsstarken übernehmen den Löwenanteil. Zähneknirschend.
Wenn Sie vorher wissen, welche Aufgabe jeder hatte und diese dann schlecht ausgeführt wurde, können Sie das zumindest erkennen und evtl. individuell benoten.
Ja, aber damit entfällt ein essentieller Teil einer Teamarbeit, die Selbstorganisation.
Das muss aber doch erstmal gelernt werden. Sobald die SuS wissen, wie man Teams aufteilt, können sie es selber machen.
Und für die faulen Socken ist diese Zeit verlorener als der verschmähte Frontalunterricht mit dem grausamen schriftlichen kurzen Test zwei Tage später, der zumindest zu einer Teilaufmerksamkeit gezwungen hätte.
Natürlich. Frontalunterricht (für mich dasselbe wie Direkte Instruktion) hat die höchste Effizienz!
Man kann sich aber nicht immer an den faulen oder schlechtere SuS orientieren. Es muss auch Förderung für die guten bzw. fleißigen geben. Irgendwie fallen die immer hinten runter, weil die anderen alles torpedieren. Das ist unfair und sollte anders gelöst werden.
Häufig lese ich, dass es ja Begabtenförderung in Form von Wettbewerben (z.B Känguru Känguru in Mathe), tolle AGs etc. gäbe. Aber das ist ja alles on top. So doof wäre ich als Begabte dann doch nicht, mir das zusätzlich ans Bein zu binden oder vielleicht bin ich begabt, mag aber gar keinen Wettbewerb?
Also, mehr Einbeziehen von begabten SuS im Unterricht wäre fair und das ginge vielleicht wirklich nur, wenn diese eine Extraherausforderungen bekämen ( ihr macht das eigenständig als Projekt irgendwo auf dem Gelände), während die andere frontal abgefrühstück werden.
Ich glaube, es liegt eher an der Faulheit und dass man sich zu sehr auf andere verlässt. Die Lehrkraft baut dann natürlich Druck auf, dass bitte alle mitarbeiten sollen. Genau dieser “Druck” ist ja aber böse und nicht mehr gewollt.
Ich weiß nicht, was das ganze Überspitzen hier soll. Die SuS wollen doch nur mitgestalten und auch mal mitbestimmen können. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Lassen wir ein paar Plätzchen im Lehrplan frei für eigene Themen oder Projekte. Bieten wir Ihnen doch Wahlmöglichkeiten. Das ist nicht der Untergang des Abendlandes. Eigeninitiative ist erstmal was Gutes. Nirgendwo steht was von chillen oder gaming.
Mitbestimmen heißt für mich nicht, jeglichen Leistungsgedanken abschaffen zu wollen. Den Schülern geht es in erster Linie um “Spaß”. Nun ist Schule aber kein Freizeitpark. Soweit mir bekannt, gehen inzwischen viele Lehrkräfte auf Schülerinteressen ein, wobei es natürlich schwierig bzw. fast unmöglich ist, hier alle Kinder gleichzeitig zufriedenzustellen.
Ich glaube eher, sie wären schon dankbar, wenn es auch mal Spaß machen würde. Das hat tatsächlich Seltenheitswert.
Natürlich kann man es nicht allen recht machen, daher finde ich z.B. auch gut, wenn Kids auch mal den Freiraum hätten, sich vielleicht in 3-4er Gruppe selbst was auszusuchen und daran arbeiten könnten. Ich glaube, manche Schule setzen das mit dem Freiday schon so oder ähnlich um.
Vielleicht braucht es aber auch Unterricht und die Lehrkraft, um überhaupt Angebote, die Spaß bereiten, machen zu können. Mein Sohn hatte null Bock auf Mathe, bis seine Lehrerin mit mathematischen Logikspielchen kam. Er selbst wäre nie auf die Idee gekommen, sowas in der Schule lernen zu wollen. Daher ist fraglich, welche Inhalte die Schülerinnen und Schüler überhaupt machen wollen würden, wenn sie gar nicht wissen, was es denn so alles gibt.
Jein, es geht mir mehr darum, dass Kids mal wider dazu gedrängt werden, selber nachzudenken. Die meisten haben total verlernt, sich etwas auszudenken, nachzudenken, woran sie Interesse hätten. Ständig wurden sie bespaßt – Langeweile ist ein Fremdwort geworden. Wenn man heute Kids solche breiten Aufgaben stellt, sind sie vermutlich erstmal total überfordert. Sie sind zu Konsumenten verkommen.
Es geht nicht darum, dass sie besser in irgendeinem Fach werden, sondern lernen, sich ein Thema, eine Fragestellung, eine Aufgabe zu suchen und es zu bearbeiten oder zu entwicklen – kreativ, vielleicht mit Methoden wie Design Thinking. Ganz egal welchen Inhalts.
Viele haben überhaupt keine Lust, sich selbst etwas auszudenken. Wenn ich Angebote mache, kommt oft nichts zurück. Buch lesen? Wettbewerb mit machen? Etwas kreativ gestalten? Rollenspiel? Basteln? Experimente? Eine Handvoll freut sich und zwar sehr oft die gleichen. Der Rest hat auf nichts Lust, weil ja alles irgendwie Anstrengung sein könnte. Man kann nicht immer nur andere Formate und Kreativität haben wollen und dann das selbst nichts dazu beitragen. Ich würde gerne mehr Projekte machen, die SuS ziehen nur leider zum Großteil nicht mit. Von daher ärgern mich solche Forderungen, denn viele SuS wollen nicht mehr lernen (egal wie), sondern nur chillen.
Aber diejenigen haben doch dann eh auf gar nichts Lust. Dann kann man doch eben mal was für die machen, die sich darüber freuen.
Wird doch gemacht und alle anderen erreicht man extrinsisch eben nur mit etwas Druck. Wie heißt es so schön? Manche muss man zu ihrem Glück halt auch mal zwingen.
Wie oft hab ich schon Schülerinnen und Schüler erlebt, die sich vor allem bei jenen Lehrkräften bedankten, die ihnen in den Hintern getreten haben?
Die anderen machen nur leider die Projekte kaputt. Machen Mist im Computerraum oder im Nawi-Raum und müssen irgendwie “bespaßt” werden. Wo soll ich die einstecken, während ich die anderen an Projekten arbeiten lasse?
Das sagt meine Tochter auch immer, dass die LuL wegen der Störer nichts mehr machen. Vielleicht geben sie den Eifrigen einen Vettrauensvorschuss und erlauben denen, dass sie im Flur, Pausenhalle, Hof oder Schulgarten arbeiten. Da würden die Störer doof gucken 😉
Und ich meine Aufsichtspflicht verletzen… Wenn dann doch was wäre, muss ja nicht mal von meinen SuS ausgehen, dann hab ich das Problem. Das ist also ziemlich doof.
Es muss dafür ein Schlupfloch geben. In der Grundschule meiner Tochter war es ein Standardangebot, dass man im Flur arbeiten durfte, wenn einem die Klasse zu laut war. Dafür stand dort sogar immer ein Tisch mit Stühlen. Hat meine Tichter ständig gemacht.
Wie gesagt, in der Grundschule schon. Da kann es doch bestimmt mit älteren Kids erstrecht gehen. Auf Klassenfahrten dürfen die SuS ja auch mal in kleinen Gruppen alleine los. Da kann viel mehr passieren. Vielleicht einfach die Erlaubnis der Eltern einholen.
In sogenannten Lernclustern, können die Kinder wählen, wo sie arbeiten. Das Zauberwort heißt hier „sich beaufsichtigt fühlen“. Oft haben die Klassentpren dort Sichtfenster, die das Gefühl der Beaufsichtigung geben sollen.
Bei uns arbeiten die Kinder auch oft auf dem Flur oder im Diffraum nebenan….die fühlen sich dann auch beaufsichtigt….
Kein Schlupfloch, sondern gelebte Aufsichtspflicht….
Wie auch immer Sie es nennen – es ginge. Daher, bitte auch mal etwas für die Eifrigen anbieten und sich nicht nur an den faulen SuS orientieren. Vielleicht lässt sich dann der eine oder andere anstecken.
Wenn nicht, Pech gehabt. Dann haben die Eifrigen endlich mal Spaß und der Rest langweilt sich wie immer.
Ich wage auch mal die These, dass die vom Bürgerrat geforderten Freiräume sicherlich von ehem. oder heutigen “Eifrigen” stammen, die sich im jetzigen System langweil(t)en.
Es war nie anders: Am besten gefällt den allermeisten Kindern an der Schule Ausfall, das Wochenende und die Ferien.
Na, und? Was gefällt uns Erwachsenen denn am besten? Feiertage, Wochenende und Urlaub…gleiches Recht für alle!
Und wenn dann der “Erwachsenenrat” mehr (oder nur) Feiertage und Urlaub fordert oder empfiehlt, sagen dann auch alle “Ja, super, und ach so basisdemokratisch!” und widmen diesem “Rat” einen Artikel nach dem anderen?
Und wo habe ich die Forderung mehr oder nach Dauerferien überlesen?
In Ihrem eigenen Kommentar darüber.
Nein, ich habe geschrieben, dass alle ein Recht darauf haben, sich am meisten auf freie Zeit zu freuen. Nicht, dass sie das fordern.
Gilt nochmal mehr für Lehrer
Auch. Mir macht meine Arbeit jedoch Spaß und ich freue mich nach meinem Urlaub immer darauf, wieder zurück an die Front zu dürfen. Es soll sogar den ein oder anderen Schüler geben, wo dies genauso ist. Das sind in der Regel diejenigen, die Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft zeigen.