GROSS PANKOW. Lernen heißt scheitern dürfen – und genau darin liegt der Schlüssel für die Schule von morgen. Neue Studien zeigen: Kinder, die in einer positiven Fehlerkultur lernen, entwickeln nicht nur mehr Wissen, sondern auch mehr Vertrauen in sich und andere. Die Montessori-Pädagogik scheint dafür den idealen Rahmen zu bieten – und liefert erstaunlich aktuelle Antworten auf die Bildungsempfehlungen der UNESCO. Ein Gastbeitrag von Jana Reiche und Dr. Silke Kipper, beide Lehrerinnen an der Landweg-Schule im brandenburgischen Groß Pankow – und engagierte Vertreterinnen der Montessori-Pädagogik.
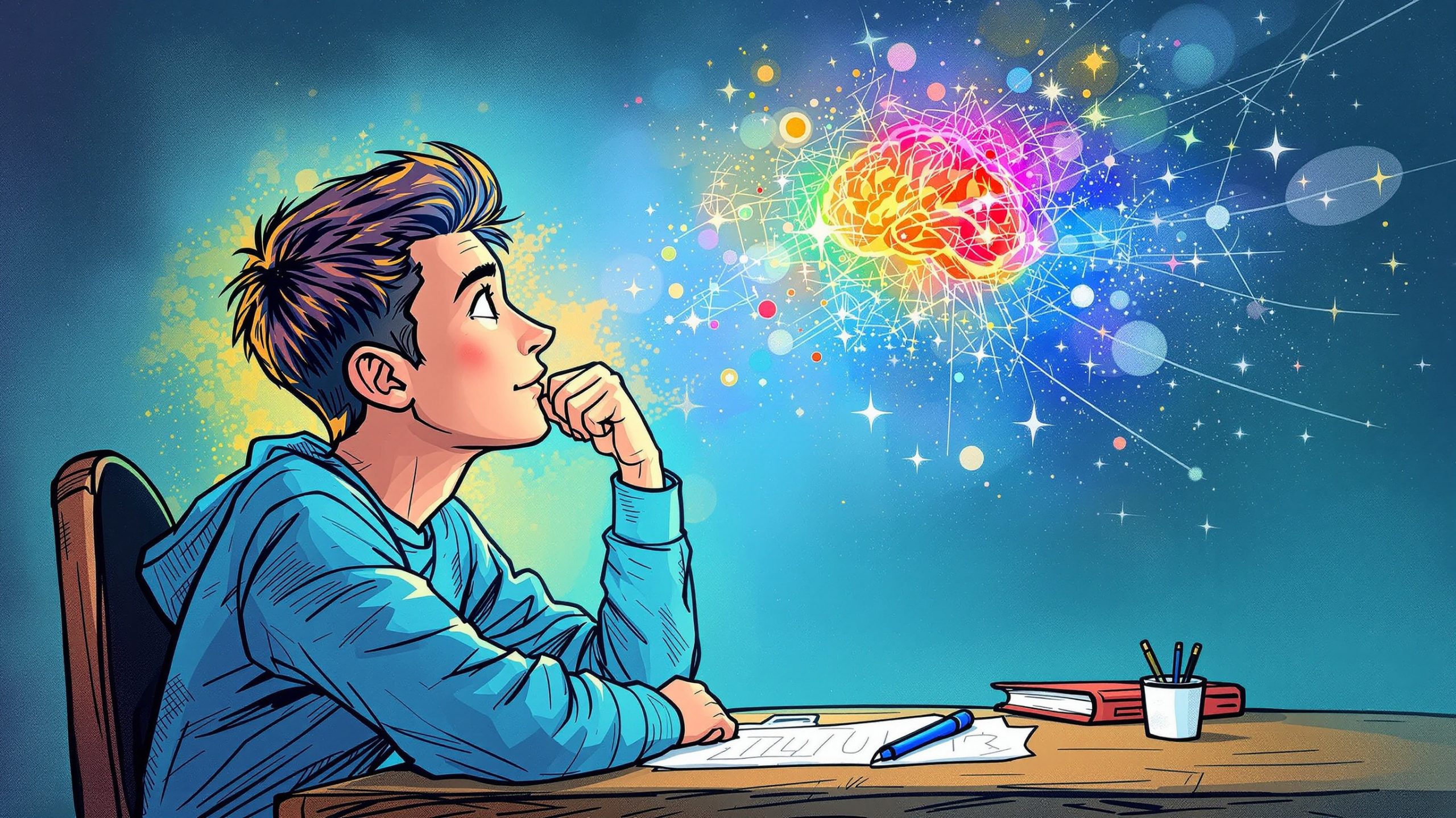
Die geheime Kraft des Fehlers. Eine neue Sicht auf Lernen, Irrtum und die Schule von morgen
Trotz tiefgreifender Umbrüche in Gesellschaft, Technologie und Politik erweist sich das Bildungssystem als erstaunlich stabil. Vielleicht zu stabil. Sollte es nicht, statt der Gegenwart hinterherzulaufen, längst antizipieren, welche Antworten Bildung auf eine sich verändernde Welt geben kann? Rechnen, Schreiben und Lesen gehören zu den grundlegenden Fähigkeiten, die Kinder traditionell in den ersten Schuljahren erwerben. Doch inzwischen ist unbestritten, dass eine zukunftsfähige Schulbildung weit mehr erfordert. Wer den Herausforderungen von morgen begegnen will, braucht neue Kompetenzen. Dazu zählen Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsvermögen, kritisches Denken und Denken in Zusammenhängen.
Vielleicht fällt auf, dass es sich dabei durchweg um Fähigkeiten handelt. Und das wirft eine alte Frage in neuem Licht auf: Wie steht es eigentlich um den Aufbau von Allgemeinwissen? Vielleicht wurde dieser Aspekt, also die Sammlung von (Welt-)Wissen, angesichts der Verlockungen des stets und ständig abrufbaren digitalen Wissensschatzes zuletzt bei der Entwicklung von Bildungsplänen vernachlässigt. Tatsächlich konstatieren führende Bildungsforscher*innen genau dies und mahnen an, dass das Pendel zwischen „Fähigkeiten“ und „Kenntnissen“ aus der Mitte geraten ist (Surma et al. 2025). Doch nur ein gutes Zusammenspiel von beiden schafft das Fundament für ein selbstbestimmtes, gesundes und aktives Leben als mündige Erwachsene.
Viele Wege führen zum Lernerfolg. In den letzten Jahren hat sich weltweit die Erkenntnis durchgesetzt, dass Bildung mehr sein muss als reiner Wissenserwerb. 2024 haben deshalb alle 194 Mitgliedsstaaten der UNESCO gemeinsam eine neue Bildungsempfehlung verabschiedet. Bildungsziel ist die Vermittlung von Haltungen, Werten und Kompetenzen, die Frieden, Menschenrechte und individuelle Grundrechte fördern. In der neuen Fassung sind nun die Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie die „Global Citizenship“, also die Herausbildung eines weltbürgerschaftlichen Bewusstseins, dazugekommen. Der primären Schulbildung wird dabei explizit eine besondere Rolle zugeschrieben. Legt man die Bildungsempfehlungen der UNESCO neben reformpädagogische Ansätze wie etwa die pädagogischen Ideen Maria Montessoris, sind Parallelen unübersehbar.
Aber inwiefern kann eine über hundert Jahre alte Pädagogik Antworten auf aktuelle Anforderungen an Schule und Bildung geben? Dafür gibt es nicht nur aus der Praxis, sondern zunehmend auch aus der Wissenschaft gute Argumente. In der Psychologie und in den Neurowissenschaften wurde in den letzten Jahren intensiv erforscht, wie sich ein auf Montessori-Prinzipien fußendes Bildungskonzept bei Kindern niederschlägt. Die Ergebnisse sind höchst interessant und teils überraschend.
Lernwege aus wissenschaftlicher Sicht
Es gibt mittlerweile sehr viele vergleichende psychologische Studien an Kindern im Vorschul- und Grundschulalter. Wenig überraschend kommen sie nicht in allen Details zu gleichen Ergebnissen. Eine Meta-Studie ist ein geeignetes Verfahren, die Ergebnisse vieler verschiedener Studien unter einen Hut zu bringen. Eine solche haben Demangeon et al. 2023 vorgelegt. Dabei wurden Ergebnisse von 33 Studien in Betracht gezogen, die in 13 Ländern der Welt auf 4 Kontinenten durchgeführt wurden. Mehr als 20.000 Kinder lieferten „Datenpunkte“. Das ist beeindruckend, auch wenn in den meisten der Studien jeweils nur einzelne Fähigkeiten verglichen wurden. Denn die Bildung eines Menschen kann natürlich in vielen Dimensionen untersucht werden.
In dieser Metastudie ergab sich, dass nach dem Montessori-Konzept beschulte Kinder in der Dimension „schulische Leistungen“ bessere Ergebnisse erzielten. Etwas weniger profund, aber immer noch statistisch nachweisbar, war das positive Abschneiden im Bereich der sozialen Entwicklung. Wurden kognitive Fähigkeiten, Kreativität und die motorische Entwicklung verglichen, fand sich über die vielen Studien hinweg kein signifikant besseres Abschneiden gegenüber anderen schulischen Konzepten. Allerdings zeigten sich in keinem Fall Nachteile. Auch in den wissenschaftlichen Studien wird immer wieder betont, dass die direkten Vergleiche von Lernerfolgen in verschiedenen Schulkonzepten bestenfalls Annäherungen an die Realität sind. Denn das wissenschaftlich korrekte Vorgehen, eine Längs- und Querschnittstudie mit hoher Teilnehmendenzahl, multidimensionalen Tests und zufällig zugeordneten Bildungswegen ist natürlich realitätsfern.
Ganz abgesehen davon lassen sich aus den Ergebnissen der vorliegenden vergleichenden Studien keine Rückschlüsse auf individuelle Lernwege ziehen. Dennoch lässt sich selbst bei Berücksichtigung dieser Einwände mit aller Vorsicht konstatieren, dass in verschiedenen Studien Montessori-Kinder im Vor- und Grundschulalter besser abschnitten als gleichaltrige Kinder, die in traditionellen Bildungssystemen ausgebildet wurden. So gut wie nie zeigten sie schlechtere Leistungen als die Vergleichsgruppe. Aber mit diesem vergleichenden Ansatz kann nur beschrieben werden, was besser oder schlechter funktioniert, also ob es Unterschiede gibt. Es lässt sich nichts darüber in Erfahrung bringen, warum das so ist. Die zugrundeliegenden Prozesse sind wie in einer Blackbox verpackt und können bestenfalls erahnt werden.
In jüngster Zeit wurden komplementär zu vergleichenden psychologischen Studien nun auch neurowissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt, die genau dieses „Wie und Warum“ adressieren. Eine Forscherin auf diesem Gebiet ist die Neurowissenschaftlerin Solange Denervaud von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (Schweiz). Sie untersucht, wie sich Lernumfeld, Fehlerkultur und gemeinsames Lernen in Gruppen im Gehirn abbilden und wie sie das Gehirn verändern (siehe Gaujard & Denervaud 2023 für eine ausführliche Zusammenfassung der Studien).
In den Studien, die die neuronalen Grundlagen des Lernens nach Montessori mit dem traditionellen Lernen verglichen, zeigten sich nicht etwa Unterschiede in den Verbindungen, die für Erwerb, Speichern oder Abruf von Informationen und Kenntnissen (anders gesagt: für Lernen) wichtig sind.
Eine andere Hirnregion rückte in den Mittelpunkt: der anteriore cinguläre Cortex (ACC). Diese Region im vorderen Teil des Großhirns ist quasi der Sitz des Fehlermanagements im Gehirn. Der ACC wird immer dann aktiv, wenn vom sensorischen Input, also von den Sinnesorganen, unerwartete Ereignisse oder Diskrepanzen gemeldet werden. Mit anderen Worten, wenn Fehler erkannt werden, sendet die ACC-Region ein Stopp-Signal, das zur Verlangsamung allen Verhaltens führt. So kann neue Informationen integriert werden. Das Verhalten wird wiederholt, wobei alle Sinne besonders geschärft sind. Der Fehler wird korrigiert und es wird eingespeichert, wie es „richtig“ geht.
Im Ergebnis ist eine Verhaltensanpassung erfolgt. Einfach gesagt, es wurde gelernt. Ein Beispiel kann helfen, die Herangehensweise in solchen Studien nachzuvollziehen und die unterschiedlichen Lernwege zu beschreiben (Denervaud et al. 2020). In dieser Studie wurden den Teilnehmerinnen (Mädchen im Alter zwischen 8 und 12 Jahren) im fMRI-Setting1 auf einem Bildschirm Matheaufgaben mit einer Lösung gezeigt.
Beispiel: 3+10=12. Die Aufgabe der Kinder war es, per Knopfdruck zu entscheiden, ob die Gleichung stimmt oder nicht stimmt. Dabei sollte möglichst schnell und möglichst akkurat geantwortet werden. Nach ihrer Entscheidung bekamen die Kinder auf dem Bildschirm angezeigt, ob ihre Einschätzung richtig oder falsch war. Und just in diesem Moment unterschieden sich die Gehirnaktivitäten. Bei Kindern der Montessorischulen wurden, nachdem sie einen Fehler gemacht hatten, sowohl das ACC als auch Regionen, die für das Problemlösen wichtig sind, aktiviert. Die Fehler wurden genutzt, um zu lernen. Kinder anderer Schulen aktivierten dagegen bestimmte Hirnregionen, wenn sie eine richtige Antwort gegeben hatten. Und zwar Regionen, die für das Gedächtnis relevant sind. Pointiert gesagt beschreibt es den Unterschied zwischen prozessorientiertem Lernen versus Erinnern vorgegebener Erkenntnisse, also dem Auswendiglernen.
“Unterschiedliche pädagogische Konzepte führen dazu, dass in den Gehirnen der Kinder ganz unterschiedliche Lernwege beschritten werden”
Das Gehirn kommt also auf zwei sehr verschiedenen Strategien zum Lernerfolg. Entweder mit (Zeit)druck von außen forciert oder bei ausreichender Zeit ohne jedes Zutun Dritter quasi aus der Natur des Kindes heraus. Unterschiedliche pädagogische Konzepte führen also dazu, dass in den Gehirnen der Kinder ganz unterschiedliche Lernwege beschritten werden. Montessorischulen setzen auf Lernmaterial mit Selbstkontrolle, auf selbst gewähltes Zeitmanagement und auf soziales Lernen voneinander. All dies steht zweifellos mit dem Fehlermanagement in Zusammenhang und erlaubt ein tiefes Durchdringen des Lernstoffs, das beim Auswendiglernen nicht erreicht wird.
Spätestens hier fragt sich das „normale“ erwachsene Gehirn wohl, wieso Montessori-Kindern Fehler nicht unangenehm sind, wieso sie Fehler positiv nutzen, wo wir doch alle darauf aus sind, Fehler zu vermeiden? Für die allermeisten Erwachsenen ist „richtig oder falsch“ tatsächlich emotional aufgeladen. Wir wollen keine Fehler machen. Doch genau diese Einstellung Fehlern gegenüber hat enorm viel Einfluss auf das Lernen. Auch das lässt sich in einem einfachen Laborsetting zeigen (Denervaud et al. 2021). Erwachsene oder Kinder bekommen am Bildschirm eine Zuordnungs-Aufgabe. Die ist schwierig, sie machen Fehler. Direkt nach einem Fehler sollen sie ein Wort als positiv oder negativ benennen (z.B. „Krieg“ negativ, „Lachen“ positiv). Erwachsene, die einen Fehler gemacht haben, fühlen sich schlecht. In dieser Stimmung kategorisieren negative Wörter schneller, denn ihr Gehirn ist in diesem Moment „auf negativ eingestellt“, sie sind voreingenommen. Kinder zeigen diese Art von Voreingenommenheit nicht. Für sie sind Fehler noch nicht negativ besetzt.
Im Gegenteil, Kinder traditioneller Schulsysteme kategorisieren nach einer richtigen Zuordnung positive Begriffe schneller. Richtiges Antworten bewertet das Gehirn als gut. Kinder aus Montessorischulen zeigen keinerlei Voreingenommenheit, bei ihnen hängt die Einordnung eines Begriffes als positiv oder negativ nicht damit zusammen, ob sie vorher richtig oder falsch lagen. Das ist für sie eine Information, die einfach zum Lernen dazugehört. Sie nutzen die richtig/falsch-Information für nachfolgende Entscheidungen. Bei einem Fehler werden sie einen anderen Weg probieren, um zur Lösung zu kommen. Hier könnte der entscheidende Unterschied zwischen beiden Lernumwelten liegen. Wenn Kinder für ihr Lernen das Feedback von außen brauchen, könnte das in der Umkehrung dazu führen, dass „das Falsche“ gemieden wird und so das oben beschriebene Lernen am eigenen Fehler nicht länger stattfindet.
Schließlich gibt es auch noch die soziale Dimension des Fehlermanagements. Vertraue ich oder erwarte ich Negatives, muss ich mich schützen? Auch das lässt sich in Forschungs-Settings hinterfragen (Denervaud et al. 2020a). Dabei sehen Kinder ein Gesicht, dessen Mimik sich von Bild zu Bild minimal verändert. Die Kinder entscheiden per Knopfdruck, ab wann der emotionale Ausdruck umschlägt. Natürlich werden im Rahmen eines solchen Experimentes viele Gesichter bewertet, der Ausdruck wechselt mal vom Positiven ins Negative, mal anders herum. Es zeigen sich wieder deutliche Unterschiede: Montessori-Schülerinnen tendieren zu einer positiven Deutung. In der Interpretation der Wissenschaftlerinnen sehen sie in einem unbekannten Gegenüber keine Konkurrenz, sie können Vertrauen schenken, das Potenzial gemeinsamen Lernens ist groß. Auch wenn dies sicher nicht die einzige Interpretationsmöglichkeit ist, lohnt es sich, diesen Wahrnehmungsunterschieden in Folgestudien weiter nachzugehen.
“Wenn Fehler keine Rückschläge sind, sondern ein essenzieller Teil des Lernprozesses, eröffnen sie Gelegenheiten zum Nachdenken und Verstehen”
Zentral scheint aber der Umgang mit Fehlern. Wenn Fehler keine Rückschläge sind, sondern ein essenzieller Teil des Lernprozesses, eröffnen sie Gelegenheiten zum Nachdenken und Verstehen. Lernumgebungen, die Kinder gezielt herausfordern und ihnen zugleich die Sicherheit geben, dass Fehlermachen erlaubt und sogar notwendig ist, schaffen die besten Voraussetzungen für nachhaltiges Lernen. Erfolgreiches Lernen bedeutet hier weder reines Auswendiglernen noch freies Schweben ohne Anleitung, sondern ein Zusammenspiel von eigenständigem Tun,gezielter Anstrengung, Lernen an Materialien mit Selbstkontrolle und konstruktiver, zeitnaher Rückmeldung durch Erwachsene oder die Gruppe.
Kinder müssen sich an Aufgaben erproben dürfen, ermutigt werden und erfahren, dass sie sich durch eigenes Ausprobieren wirklich entwickeln. Kein Arbeitsblatt hält dieses Angebot bereit. Genau hier könnte die entscheidende Erklärung dafür liegen, warum Montessori-Schüler*innen in einigen Studien besser abschneiden. Die hier dargestellten Studien belegen die Wirksamkeit der Montessori-Pädagogik in der Grundschule. Doch die Grundlagen für gelingendes Lernen mit einer positiven Fehler- und Feedback-Kultur werden schon vorher, in der frühkindlichen Bildung gelegt. Wenn alles gut läuft, lernt ein Kind den montessorischen Rahmen von Beziehung und Ermöglichung im Kinderhaus kennen und wird darauf aufbauend in der Schule seine Lernprozesse aktiv gestalten. Das gilt dann für weiterführende Schulen ebenso wie für die Teams in solchen Einrichtungen. News4teachers
Hier geht es zu Folge zwei des Gastbeitrags: Wie diese Prinzipien im konkreten Schulalltag aussehen.
Jana Reiche
Diplom-Sozialpädagogin und Lehrerin mit Montessori-Zusatzausbildungen; Vorstandsmitglied und Schulleiterin des Landweg e.V.; aktive Mitarbeit im Montessori-LV Berlin-Brandenburg; seit vielen Jahren prägt sie die pädagogische Entwicklung der Landwegschule; regelmäßige Veröffentlichungen zur Montessori-Pädagogik in Blogs, Fachbeiträgen sowie auf YouTube und TikTok.
Dr. Silke Kipper
war als Professorin für Biokommunikation und Verhalten tätig und dabei in die Lehramts-Ausbildung involviert; seit 2017 Lehrerin an der Landweg-Schule; BNE-Koordinatorin des Hauses und Buchautorin; gemeinsam mit Jana Reiche wirkt sie in Workshops, Vorträgen und Schriften als Multiplikatorin von Montessori-Pädagogik, BNE und moderner Bildung.










Dann kann sich das Bildungswwesen ja freuen, es kann nur besser werden, so gescheitert wie es derzeit ist.
FEHLER = HELFER
So betrachtet können Fehler sehr produktiv sein, vorausgesetzt man gibt den Kindern die Möglichkeit an den Fehlern zu arbeiten, weiterzudenken und zu verstehen.
Das setzt voraus, dass in der Schule, in der Klasse, in der Lerngruppe eine positive Fehlerkultur etabliert ist und Fehler als das betrachtet werden, was sie sind: als Chance…..
Bei der Studie (Metastudie) will ich die Ergebnisse gar nicht bezweifeln, allerdings sollte man bitte auch berücksichtigen, welche Kinder eine Montessorischule besuchen. In der Regel sind sie Privatschulen, welche sich ihr Klientel aussuchen können und sie kosten Schulgeld…..das schließt schon eine Menge Kinder aus…..oder werden von Eltern gar nicht erst in Betracht gezogen….
… und es werden nur Kinder von Eltern angemeldet, die hinter diesem Konzept stehen und ihre Kinder entsprechend “motivieren”.
Nach meinen Informationen wurden bereits in der ersten Montessori-Schule nur Kinder aufgenommen, wenn sich die Eltern bereit erklärten mit der Schule zu kooperieren, regelmäßig zu Gesprächen in der Schule zu erscheinen und die Lehrkräfte und Erzieher*innen zu respektieren
Stimme Ihnen gerne und voll zu, aber Vorsicht!Für manche im Forum ist das ist nahe am Growth-Mindset 😉
Schule der Zukunft lässt auch das Scheitern zu. Ausprobieren, neu denken und flexibel arbeiten.
Wir werden wegkommen von der 5 Tage Woche vor Ort in Vollpräsenz hin zu einer offenen und flexiblen Schule mit 4 Tage Woche, Distanzunterricht / Homeofficemöglichkeiten und freien Lernformen.
Denkt an Hasi, er hat, wie wir Lehramt studiert, jetzt verdient er doppelt, hat 3 Tage Homeoffice und es klappt. Die Verbindungen nach Asien laufen einwandfrei.
Man muss dazu sagen, dass er noch Prämien und Bonuszahlungen erhält und das einfach so oben drauf. Lehrer haben ein Jahresgehalt, das sieht immer keiner.
Er arbeitet dann auch 5 Jahre weniger als ihr mit den 67.
Viele Lehrer wissen das gar nicht, weil sie nur Lehrer kenne und das ist einfach schade. Klar, es ist auch idealisierend und was man nicht weiß, macht einen nicht heiß, Freunde!
Schönes Wochenende, eure Petra aus dem Lipperland 🙂
Sehr richtig, liebe liebe Petra
Liebe Grüße zurück.
Du bist spitze!!
Wo ist der Bezug zum Thema???
Das ist doch nun aber wirklich ein alter Hut !!!
Interessanter Artikel, vor allem in Bezug auf die Untersuchungen. Das unterstreicht für mich das, was man pädagogisch schon länger tut. Die Sichtweise, den Fehler als Chance zu begreifen, ist für mich jetzt nicht neu. Zum ersten Mal hörte ich davon auf unseren Fortbildungen zum Lehrplan 2000 (Vorgänger zum LehrplanPLUS) in Bayern. Das war so um das Jahr 2000, ist also fast schon 25 Jahre her.
Dieser Gedanke ist seitdem in die Lehrpläne und Schulbücher eingearbeitet. Man reflektiert immer wieder über Fehler, vor allem in D und M. Dazu gibt es verschiedene Methoden, z.B. das Kommentieren der Fehler. Und da werden Fehler als Chance begriffen, daraus zu lernen, wie auch die Sichtweise auf Fehler grundsätzlich so ist. Fehler können sogar eine pädagogische Möglichkeit sein, etwas tiefer zu verstehen.
Übrigens flossen Elemente der Montessori-Pädagogik zum ersten Mal in Bayern in den oben erwähnten Lehrplan der Grundschule ein.
Zur Überschrift des Artikels: “Scheitern” ist negativ besetzt und unabwendbar, deshalb finde ich diesen Zusammenhang nicht gut beschrieben. “Fehler und “Scheitern” passt nicht zusammen. Man scheitert nicht, wenn man Fehler macht, sondern man lernt eben aus Fehlern. Das ist ein dynamischer Prozess.
was wir für alle brauchen:
4-Tage Woche
30 % Homeschooling
Gehälter um 17 % rauf
DB & GK online
Es muss sich was ändern.
Wir brauchen hier aber auch Kommentare, die mit dem Thema des Artikels zu tun haben!
Wieso denn neue Studien? Das ist doch hinlänglich bekannt! Ich würde sagen, seit Jahrzehnten. Viele reformpädagogische Ideen beruhen besonders darauf.
Dank für diesen interessanten Beitrag, dessen Fazit mich wenig überraschte. Amüsiert nehme ich den Ausdruck “Biokommunikation” zur Kenntnis.
Lehnt Chomsky den ab? 😉
Checken Sie doch mal die ANT aus. Bruno Latour etc. Es gibt neben Sprache noch weitere Agenten. Es gibt Dinge. Auch ohne Sinn. Einfach mal reinlesen, ernstgemeinter Lese-Tipp ohne Häme.
Keine Ahnung, wie der den findet.
Fast so lustig wie Biomüll.
Danke für unhämischen Lesetipp.
Leider stapeln sich hier aktuell ungelesene Bücher, man kommt ja zu nix, bei dem ganzen Getippe hier.
Ich finde es immer wieder spannend, dass althergebrachte Weisheiten als neue Erkenntnis verkauft werden. Die Naturwissenschaften haben schon immer nur so funktioniert und das stand auch immer wieder hier im Forum.
Das Problem ist nicht, dass Lehrer nicht wüssten, dass man aus Fehlern lernt, das Problem ist die geringe Aufmerksamkeitsspanne der Kinder, die niedrige Frustrationsschwelle und das Arbeiten nach dem Lustprinzip bei vielen Kindern. Wer nie Mensch ärgere Dich gespielt hat und dabei gelernt hat, dass jeder mal verliert und dass das ganz normal ist und dass man danach auch immer noch lebt, der wird auch bei Rechenwegen nicht gewillt sein zu verlieren. Ausserdem dauert es ja immer eeeewig, bis man mal wieder dran ist bei diesem Spiel. Man braucht dieses damit erworbene Sitzfleisch für das Herumprobieren, bis man den Lösungsweg z.B. einer Matheaufgabe hat und man braucht den Mut, immer wieder von vorne anzufangen.
Viel einfacher ist es aber, sich auf dem “ich kann das nicht, ich habe es nicht verstanden, meine Eltern haben es früher auch nie verstanden, ich werde es nie verstehen ” und dem ”wieso soll ich mich im Unterricht quälen, zuhause bekomme ich das von xy persönlich erklärt oder vom Video oder von ChatGpt oder … da verstehe ich das besser”.
Oder auch: “Was??? Üben??? Wozu? Wofür brauche ich das? Ich habe keine Lust dazu! Das ist uncool und dauert mir zu lange! Gäääähn”
Jemand, der z.B. ein Musikinstrument erlernt hat, hat sich ganz automatisch mit den nötigen Kompetenzen ausgestattet. Man merkt einen deutlichen Unterschied in der Schülerschaft, je nachdem, wie die Kinder seit frühester Kindheit im privaten Umfeld gefordert wurden und wie die Eltern es vorleben bzw. sich mit ihren Kindern beschäftigen.
Was ich in einer Montessoriklasse erlebt habe: Es wurden Fehler gemacht, aber weder vom Kind noch Lehrerin bemerkt. Großartig.
Das klingt furchtbar.
Fehlerkuktur bedeutet nicht Ignoranz der Lehrkräfte.
Oder missverstand ich Sie und Sie beziehen sich auf eine “klassische” Reaktion der Lehrkraft, welche ausblieb?
In wie fern? Haben Sie hospitiert?
Interessant – endlich empirische Erklärungen für die grundlegenden Unterschiede, nicht nur mehr allein das “Gefühl”, anders zu denken.
Jetzt könnte man untersuchen, was passiert, wenn (in der Kindheit) Montessori-geprägte Lehrergehirne auf Otto-Normal-Schüler-Gehirne treffen.
Schüler erwartet: Fehler ist schlecht, freut sich wenn keiner den Fehler bemerkt oder macht lieber gleich gar nichts, wenn nicht sicher ist, dass er es schon kann. Neigung zu Passivität, Frustration und Fatalismus, erwartet in und von der Schule, dass er alles, was kommt, schon können kann/muss..
Lehrer erwartet: Fehler ist gut, Schüler sollten sich freuen, wenn sie selbst oder jemand anders den Fehler findet und sie dran lernen können. Neigung zu Optimistmus, Ausprobieren, Try and Error ohne Vorbehalte, erwartet Neugier, Experimentierfreude, Freude am Nachdenken und Ausprobieren und kommuniziert, was man lernen kann/könnte, wenn man sich auf Lernen einlässt/einließe.
Überfordert das beide Seiten?
Wie kann man Brücken zwischen den Systemen bauen?
Die meisten Kinder lernen eben nicht in Montessori-Schulen, sondern in ziemlich “merkwürdigen” “normalen” Systemen.
Die meisten Erwachsenen mit “Montessori-geprägtem Gehirn” arbeiten später auch nicht an Arbeitsplätzen, wo sie auf ähnlich sozialisierte/geprägte/gehirnstrukturierte Menschen stoßen.
Wie kann man diese so grundverschiedenen Herangehensweisen annähern, ohne missverstanden/nicht verstanden zu werden?
“Dazu zählen Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsvermögen, kritisches Denken und Denken in Zusammenhängen.”
An welcher Stelle ist das neu??? Schon zu meiner Schulzeit sollten wir zusammenarbeiten und in Zusammenhängen denken. Wir haben argumentieren geübt, Reden analysiert, Werbebotschaften auseinander genommen und und und, es würde Selbstständigkeit verlangt, keiner hat uns etwas hinterher getragen, es gab weder Kompetenzraster noch Smileyankreuzbögen.
An den Forderungen ist eigentlich überhaupt nichts neu. Das ist jedoch anstrengend und wird einfach nicht so gerne gemacht. Oder es interessiert viele einfach nicht. Leider.
Man hat das Gefühl, als wäre man früher eine Schülerroboter gewesen, der alles gefressen und ausgespuckt hat, was man gerade verlangt hat, völlig unkritisch und unselbständig war etc. Im Gegenteil, das trifft eher auf viele der SuS heute zu und das, obwohl sie doch ständig nach Kompetenzen, Spaß und allem möglichen Schnickschnack unterrichtet werden sollen.
Ach jaaa, solange Kinder nicht einmal in ihrem kindlichen (Spiel-) Alltag Fehler machen, scheitern dürfen, wird das mit der “Fehlerkultur” wohl nix…
Dafür sorgen die Helikopter, – Rasenmäher, – und wie sie sonst noch heißen….-Eltern schon im/ab KiGa.
Das Elternhaus hat einen SEHR GROßEN EINFLUSS auf die Fehlerkultur.
Der Umgang der Eltern mit eigenen Fehlern udn Fehlern beim Kind sowie auch der Umgang der Eltern mit Schulleistungen des Kindes sind entscheidend!!!
Warum soll diese Art Schule die Schule der Zukunft sein? Warum ist nicht die Schule mit konzentrierterem Arbeiten ohne Schnickschnack die Schule der Zukunft? Kommt das dann danach, wenn diese neue Mode auch gescheitert ist?
Dass eine fehlerfreundliche Lernkultur ungemein entwicklungsförderlich ist, ist wichtig – und mittlerweile unbestritten. Der Beitrag erweckt indes den Eindruck, als ginge dies nur oder in besonderem Maße via Montessori-Pädagogik. Das gibt erwähnte Metastudie wohl kaum her.
Tatsächlich ist Fehlerfreundlichkeit eine Haltung der Lehrkräfte – und sie ist auch in traditionellen Settings praktikabel … wenn diese denn gekonnt wird oder gelernt wurde.
So lässt sich ein Thema üer mehrere Wochen ohne eine einzige Note (und damit etwaige Versagensangst) unterrichten bzw. bearbeiten – erst danach können die Schüler ihren Lernstand via (dann ruhig auch benotetem) Test oder Klassenarbeit dokumentieren. Weinert et al. warben sehr für eine solche Trennung von Lernen & Leisten.
Im übrigen lässt sich nicht zweifelsfrei zeigen, dass Effekte bei ‘Montessori-Kindern’ der praktizierten Pädagogik oder ihrer Herkunft geschuldet sind.