DÜSSELDORF. Dem eigenen Bauchgefühl zu vertrauen, das rät unser Gastautor Uli Black jungen Lehrkräften. Der mittlerweile pensionierte Gymnasiallehrer für die Fächer Sport, Englisch und Psychologie erinnert sich an seine Anfänge als Lehrer und kommt zum Schluss: die Lehrpraxis, aber auch die Ausbildung angehender Lehrkräfte muss sich verändern – er weiß auch wie.

Club der schlechten Lehrer
Es war in meinem ersten Jahr als Lehrer an einem Gymnasium in Karlsruhe. Ich sollte unter anderem eine 5. Klasse im Fach Englisch unterrichten, worauf ich mich ganz besonders freute. In den Sommerferien hatte ich mir das Lehrbuch eines großen Schulbuchverlags angeschaut, um mich auf den Unterricht vorzubereiten, was jedoch ein großes Gähnen bei mir auslöste. Ich fragte mich, wie ich die Kids über das gesamte Schuljahr für in Schuluniformen gekleidete Fantasieschüler aus Sheffield, die in ihrer Freizeit einen nebulösen Detektivclub gründeten, begeistern sollte. Wie sollte ich hier einen Transfer herstellen?
Neben dem Schülerbuch lag mir ein Lehrerhandbuch vor, in dem kleinschrittig aufgezeigt wurde, wie die Schüler zu unterrichten seien. Als „Assistenten“ sollte ich mir beim Verlag eine Handpuppe besorgen, um den Unterricht „kindgerecht“ zu gestalten. What???! Es wurde vorgeschlagen, nach einer „Einführungsstunde“ sofort mit dem Schulbuch zu beginnen und die Kinder von der ersten Stunde an die Vokabeln der ersten Unit von der Tafel abschreiben zu lassen. Ein erster Vokabeltest sollte nach vier Wochen erfolgen, die erste Klassenarbeit, die auch haarklein dargelegt wurde, nach sechs bis acht Wochen. Meine Gefühlslage schwankte von Panik bis Übelkeit. Hatte ich mir so das Unterrichten von Sprachanfängern vorgestellt? Nein, ganz sicher nicht! No way!! Was tun? Ich fragte eine erfahrene Kollegin, ob ich das auch anders machen und vom Lehrbuch abweichen könne. „Nein, auf gar keinen Fall. Sie müssen sich haargenau an die Vorgaben im Lehrbuch halten, damit die Kollegen, die die Klasse dann später übernehmen, sich darauf verlassen können.“
„Die Bücher sind völlig überholt und langweilig. Sie haben nichts Besseres verdient. Also weg damit!“
Und nun? Ich war auf der einen Seite noch Anfänger und wollte es nicht besser wissen als meine erfahrenen Kollegen. Auf der anderen Seite wollte ich meinen Instinkt und mein Bauchgefühl nicht einfach ausschalten. Ich hatte sehr genaue Vorstellungen, wie ich meine Fünftklässler zur englischen Sprache sanft und behutsam und vor allem mit Spaß und Humor, meinem Charakter entsprechend, hinführen wollte. Das sollte ich alles über den Haufen werfen? Nein, auf keinen Fall!
Als ich dann in der ersten Stunde in meiner 5. Klasse sah, wie die armen Kinder über 20 Kilo schwere Ranzen mit sich schleppten, war mir endgültig klar, dass ich da nicht mitmachen und meinen eigenen Weg gehen würde. „Die dicken Englischbücher könnt ihr ab sofort zu Hause lassen, die braucht ihr nicht!“ Nie werde ich die staunenden, aber vor allem dankbaren Blicke der Kinder vergessen. „Und was sollen wir mit den Büchern machen?“, fragte mich eine Schülerin. „Keine Ahnung“, sagte ich. „Verschenkt sie oder bringt sie in die Buchhandlung zurück oder wenn ihr wollt, könnt ihr sie auch aus dem Fenster werfen.“ „Ist das Ihr Ernst?“ „Ja, klar, oder sehe ich so aus, als würde ich Spaß machen?“, fragte ich sie lachend. „Und wir werden nicht bestraft, wenn wir das machen?“ „Bestraft? Warum denn? Die Bücher sind völlig überholt und langweilig. Sie haben nichts Besseres verdient. Also weg damit!“
Es dauerte keine drei Sekunden, bis der Erste unter dem johlenden Beifall seiner Mitschüler aufstand, das Fenster öffnete und sein Englischbuch in hohem Bogen aus dem Fenster warf.
Die nächsten ließen sich nicht lange bitten und taten es ihm gleich. Sie hatten augenscheinlich einen Riesenspaß. Nur wenige trauten sich nicht so recht und fragten mich schüchtern, ob sie das wirklich tun müssten. „Es ist völlig in Ordnung, wenn ihr das nicht macht. Bücher sind eigentlich Schätze, die man hüten sollte. Aber diese Bücher taugen nichts. Sie sind zu alt für euch. Nehmt sie einfach mit nach Hause und bringt sie nicht mehr mit.“
Shitstorm der Eltern
Der Shitstorm der Eltern ließ nicht lange auf sich warten. Schon am nächsten Tag rief mich der Schulleiter zu sich. „Es haben Eltern angerufen und sich darüber beschwert, dass Sie Ihre Schüler angeblich aufgefordert haben, ihre Schulbücher aus dem Fenster zu werfen. Stimmt das?“ „Nicht ganz. Für die anderen Fächer fühle ich mich nicht zuständig, aber die Englischbücher durften sie aus dem Fenster werfen, das ist wohl wahr.“ „Ja, sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Wo kämen wir denn hin, wenn das jeder Lehrer machen würde?“ „Gute Frage. Ja, wo kämen wir da hin? Vielleicht wäre das der erste Schritt in eigenverantwortlichen, selbstbestimmten Unterricht ohne überalterte und völlig überholte Lehrbücher.“
Es sollte noch vier Jahre dauern, bis ich im Kino den wunderbaren Film „Club der toten Dichter“ sah und mit glänzenden Augen Zeuge sein durfte, wie der großartige Robin Williams seine Schüler die antiquierten Lehrbücher aus dem Fenster werfen ließ. Ich hätte mir die Filmrechte dafür rechtzeitig sichern sollen.
35 Jahre Lehrer an 5 Gymnasien
Bis zu meiner Pensionierung war ich 35 Jahre an insgesamt fünf Gymnasien tätig und überall war es das gleiche: Die Lehrbücher wurden wie Heiligtümer betrachtet und ein Abweichen davon war geradezu blasphemisch. Ich blieb meiner Linie treu und verwertete aus ihnen nur die wenigen Artikel oder Beiträge, die entweder zeitlos oder spannend waren. Alles andere holte ich mir aus Büchern, Zeitschriften oder Zeitungen. Das war oft zeitaufwändig, aber es lohnte sich, da wir immer auf der Höhe der Zeit waren. Einen wesentlichen Teil der Englischstunden verbrachten wir mit dem Hören und Analysieren von Popsongs oder wir lasen Short Storys oder altersgerechte Romane. Die Unterrichtssprache war, von der 5. Klasse an, ausschließlich Englisch.
Das dann ab den 90er-Jahren verfügbare Internet war natürlich ein Segen für meine Unterrichtsvorbereitung, da ich mir hier in kürzester Zeit und von zu Hause aus die notwendigen Materialien holen konnte. Später kamen Filme und am Ende Serien hinzu. Der Unterricht war selten langweilig und wenn, wurden Inhalte und Methoden schnell gewechselt. Das Sprachniveau meiner Klassen war immer gut bis sehr gut und ich kann mich tatsächlich an keinen einzigen Fall erinnern, wo ein Schüler wegen einer mangelhaften Leistung in Englisch die Versetzung nicht schaffte. Wenn ich nach meist zwei Jahren meine Klassen abgeben musste, bekam ich fast immer von den Kollegen die Rückmeldung, dass das sprachliche Niveau der Schüler „erstaunlich gut“ war. Und das, „obwohl“ ich fast gänzlich ohne Lehrbücher gearbeitet hatte.
Um die „Bildungspläne“ habe ich mich meist nicht geschert. Mein Ziel war immer, das Maximum aus den Schülern herauszuholen, sie zu fördern, aber vor allem auch zu fordern. Wenn ein Jahrgang schon in der 5. Klasse in der Lage war, mit „simple past“ oder „present perfect“ problemlos zu arbeiten, war es mir gleichgültig, dass dies in den Bildungsplänen erst ab Klasse 6 oder 7 vorgesehen war. Und mehr als einmal ließ ich in der 6. Klasse eine Klausur schreiben, die das Niveau einer 8. Klasse hatte, weil die Schüler einfach dazu in der Lage waren.
„Was einem suspekt erscheint, sollte man infrage stellen.“
Jungen Kollegen und Kolleginnen kann ich nur den Rat geben, sich etwas zu trauen, mutig zu sein, die Schüler immer in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen und ihrem Instinkt und Bauchgefühl zu vertrauen. Ein guter Koch vertraut auch seinem Gefühl und Geschmack und nicht einem Kochbuch. Was einem suspekt erscheint, sollte man infrage stellen. Das System ist für Menschen gemacht und nicht umgekehrt. Wer nicht hinterfragt (auch sich selbst) und sich immer nur unterordnet, ist kein gutes Vorbild für junge Menschen.
Nach meiner Erfahrung und Beobachtung sind die Bildungspläne für sehr viele Lehrer eher ein Hemmschuh als eine Hilfe. Die mikroskopische Operationalisierung von zu erlernenden Fähigkeiten und Fertigkeiten irritiert mehr, als dass sie förderlich ist. Es steht außer Frage, dass inhaltliche Vorgaben notwendig sind, damit die Lehrer wissen, welche pädagogischen Ziele zu erreichen sind. Aber es bedarf meines Erachtens einer radikalen Verschlankung der fachdidaktischen Inhalte. Und die Methodik sollte ohnehin ausschließlich der Entscheidung des Lehrers und den Gegebenheiten wie Klasse, Fach, Thema und technische Möglichkeiten unterliegen.
Die neu zu schreibenden Bildungspläne sollten sich auf die wesentlichen Ziele und Erwartungen konzentrieren. Dies kann pro Unterrichtsfach und Klassenstufe auf ein oder zwei Seiten geschehen. Die von Verlagen herausgegebenen Lehrbücher, die traditionell die Bildungspläne im Klassenzimmer repräsentieren, sind nicht mehr zeitgemäß, da von der ersten Stoffsammlung bis zum endgültigen Einsatz in den Klassen Jahre vergehen und sie somit unserer schnelllebigen Zeit mehr als hinterherhinken. Sie können im übertragenen Sinne allesamt aus dem Fenster geworfen werden. Durch die Ausstattung der Schulen mit Filmräumen und das Zurverfügungstellen von Tablets für alle Schüler werden diese Bücher nicht mehr benötigt und die Millionen, die dadurch eingespart werden, können in andere Anschaffungen und Projekte gesteckt werden. Der einzelne Lehrer bekommt auf diese Weise deutlich mehr Freiräume, die er nach seinem Dafürhalten inhaltlich und methodisch gestalten kann.
Gesucht: vorbildliche Lehrerpersönlichkeiten
Eine wesentliche Voraussetzung für Lernerfolg ist neben einer klaren Definition von Zielen und Erwartungen die qualifizierte Lehrerpersönlichkeit. Der lehrerzentrierte Unterricht kann sehr erfolgreich sein unter den Voraussetzungen, dass es dem Pädagogen gelingt, eine verbindliche Beziehung mit den Schülern einzugehen, und dass er in der Lage ist, die Schüler zu motivieren, zu interessieren oder im Idealfall zu begeistern. Dies setzt voraus, dass der Lehrer selbst interessiert, motiviert und charismatisch ist und sowohl eine fachliche wie persönliche Autorität ausstrahlt. Wenn ihm dies nicht gelingt, sollte er dem Club der schlechten Lehrer beitreten und sich sodann einen neuen Job suchen.
Es wird eine der herausragenden bildungspolitischen Aufgaben der Zukunft sein, solche vorbildlichen Lehrerpersönlichkeiten zu finden beziehungsweise auszubilden. Dies wird nur mit hohen finanziellen Anreizen, attraktiven Arbeitsbedingungen und geeigneten Ausbildungsmethoden und -personen möglich sein. Lehramtskandidaten sollten schon in einer frühen Phase ihrer Ausbildung für sich selbst herausfinden, ob sie diese Voraussetzungen erfüllen. Wünschenswert wäre ein duales Studium ab dem ersten Semester, wo schön früh mithilfe von Schülern und betreuenden Mentoren diese vorhandenen oder fehlenden Qualifikationen erkannt werden können. Auf diese Weise erspart man den Lehramtskandidaten den Frust eines erfolglosen Studiums und den Schülern schlechte Lehrer.
 Sein kürzlich erschienener Roman „Kafka kannste knicken. Bildung war gestern-heute ist TikTok“ wurde durch das Anwerbungsprogramm der baden-württembergischen Landesregierung inspiriert („Kein Bock auf Arbeit? Huurraaa, werde Lehrer*in“). Auf satirisch-ironische Weise setzt er sich mit der Frage auseinander, was passieren kann, wenn ein fachfremder Quereinsteiger ohne jegliche pädagogische Ausbildung von heute auf morgen vor Klassen gestellt wird und eigenverantwortlich unterrichten muss. Der Protagonist treibt in dem Roman ungehindert in einem ehemaligen Elitegymnasium sein Unwesen und gewinnt mit seiner fast anarchischen Art sehr schnell die Herzen seiner Schüler, bringt jedoch den überforderten Schulleiter an den Rand des Wahnsinns. Als er auch noch überragende pädagogische Erfolge erringt, weckt er das Interesse des Kultusministeriums.
Sein kürzlich erschienener Roman „Kafka kannste knicken. Bildung war gestern-heute ist TikTok“ wurde durch das Anwerbungsprogramm der baden-württembergischen Landesregierung inspiriert („Kein Bock auf Arbeit? Huurraaa, werde Lehrer*in“). Auf satirisch-ironische Weise setzt er sich mit der Frage auseinander, was passieren kann, wenn ein fachfremder Quereinsteiger ohne jegliche pädagogische Ausbildung von heute auf morgen vor Klassen gestellt wird und eigenverantwortlich unterrichten muss. Der Protagonist treibt in dem Roman ungehindert in einem ehemaligen Elitegymnasium sein Unwesen und gewinnt mit seiner fast anarchischen Art sehr schnell die Herzen seiner Schüler, bringt jedoch den überforderten Schulleiter an den Rand des Wahnsinns. Als er auch noch überragende pädagogische Erfolge erringt, weckt er das Interesse des Kultusministeriums.
„Keinen Bock auf Arbeit? Dann werde doch Lehrer*in!“ Empörung über Werbekampagne



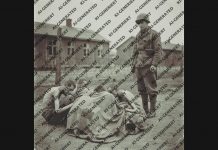






Ich habe unter all den guten Ratschlägen keinen gefunden, der jungen Kollegen sagt, wie sie mit Shitstorms seitens der Eltern und SL umgehen sollen.
Ja, die Eingangserzählung war (zu) lang. Das macht sie aber noch lange nicht zum Kerngedanken, auch den erwähnten Shitstorm nicht. Das war auch nicht das Thema!
“Findet euren eigenen Weg ohne euch von den formalen Vorgaben von gutem Unterricht abhalten zu lassen.” Gibt es daran etwas zu kritisieren? Abgesehen davon, dass man heute in jedem Schritt der Ausbildung die entsprechende Courage abgewöhnt bekommt – um dann Schüler wieder bei eigenverantwortlichem Handeln unterstützen zu sollen.
Ich teile nicht alle Gedanken (zum Beispiel zum dualen Studium), aber sehr viel von dem was er schreibt, zum Beispiel die Abschaffung der Bücher und wirklich kurze Kernlehrpläne ist vernünftig. Allerdings arbeitet eine Reihe meiner Physikkollegen seitengenau nach Buch, Aufgabensammlung und Musterlehrplan. In den Klassenbüchern stehen am Ende die gleichen Themen, ob mit oder ohne Buch, der Leistungsstand ist auch gleich.
Ja, daran gibt es etwas zu kritisieren.
In der Schule arbeiten Lehrkräfte nach Vorgaben. Es steht den Lehrkräften nicht frei, die Vorgaben des Dienstherren in den Wind zu schießen.
Wer frei unterrichten will, kann das gerne tun – außerhalb der Schule und mit dem Einverständnis der Eltern.
Aber es ist mit Sicherheit nicht ok vom Dienstherren Geld für eine Leistung zu kassieren, die man nicht erbringt.
Sobald die Lebenszeitverbeamtung durch ist, kann das egal sein. Bis dahin, jedoch leider nicht.
Nö, auch nach Beamteraufewig sind Sie nicht der king, wenn Sie sich einen groben Schnitzer leisten, außer Sie haben keinerlei Motivation und Bezug zu Ihrem Beruf, dann dümpeln/ beamtvegetieren Sie eben dahin. Warnung @ Junge Kollegen: Das macht keinen Spaß, viele werden krank. Da hilft auch die
“Beamtensicherheit ” nix.
Aber unter uns: so groß kann der Schnitzer gar nicht sein. Unterm Strich kann man sagen, dass man mit der Verbeamtung als Lehrkraft das goldene Faß aufmacht.
Ich weiß ja nicht in welchem BL an welcher Schule Sie sich befinden.
Wenn Sie bis zur Pension zB StR bleiben wollen oder den SL in Not bringen, weil die jeweilige Beurteilung nicht mehr vertretbar ist…..und damit die nächste Instanz kennenlernen…..aber im Prinzip kann das jeder versuchen, kommt halt darauf an, auf welche Vorgesetzte er trifft.
Ihre shitstorms lassen mich nicht los.
Haben Sie 1, 2 Beispiele für mich ?
– seitens der Eltern und
– seitens der SL
„Was einem suspekt erscheint, sollte man infrage stellen.“Genau das machen viele ältere Bestandslehrkräfte seit Jahrzehnten, ihre Meinungen und Erfahrungen haben jedoch bildungspolitisch nicht interessiert.
“Der lehrerzentrierte Unterricht kann sehr erfolgreich sein.” Wissen wir, können wir und wollten die meisten auch, die Oldschool-Autoritäten wurden jedoch didaktisch bevormundet.
“Gesucht: vorbildliche Lehrerpersönlichkeiten”Vielleicht auch mal diejenigen bestärken, motivieren und wertschätzen, die bereits “Gefunden” wurden, damit diese Persönlichkeiten nicht dem Club der demotivierten Bestandslehrkräfte im Krankenstand oder im vorzeitigen Ruhestand beitreten.
Buchtipp: ” Fach- und Faktenwissen kannste knicken. Ernsthafte fachliche Bildung war gestern- heute sind wir kompetent.
Was Bestandslehrkräften suspekt erscheint und von vielen infrage gestellt wird:
Klüngelügelüng, da kommt die nächste bildungsfeindliche Sau.
Was diese floskelt und wie sie schönfärbt, wissen wir genau.
Klüngelügelüng, da kommt ein weiterer Rumeiermann,
hält sich für superschlau, obwohl er selbst nur wenig kann.
Bei Lehrkräften in der Stadt und auf dem Land
sind Bildungspolitiker als populistische Didaktik-Genies bekannt.
Sie labern, bevormunden und fordern mit geheucheltem Entzücken,
wer zweifelt oder widerspricht, dem fällt man in den Rücken.
Was uns nach vielen Dienstjahren fehlt, ist vor allen Dingen,
der unerschütterliche zeitgeistkonforme Glaube ans Gelingen.
Das ist jedoch vielen auch völlig wumpe oder schnuppe,
im flachen Teller köchelt weicher die Bildungseinheitssuppe.
Den abgespeckten neuen Superlehrkräften sei zu gönnen,
dass diese die Pampe noch rechtzeitig auslöffeln können.
Der Lehrer aus dem Beitrag gehört noch zu der Generation echt leistungsorientierter Lehrer. Bei den jungen Lehrern am meiner Schule ist das leider bedeutend weniger, was aber ihrer Ausbildung im Referendariat entspricht. Insofern sind sie nicht schuld daran.
Das Mathebuch nutze ich als Aufgabensammlung, das Physikbuch können meine Schüler zuhause lassen.
Auch bei mir können SchülerInnen sind seit Beginn ihre Bücher zuhause lassen. Auch mir ist der Gähnfaktor in den Büchern zu groß. Vor allem diese Aufgaben wie Paula möchte …, Mehmet möchte … sprechen SchülerInnen 0 an.
Paula kauft 200 Melonen, doch sie hat nur einen VW Polo. Wieviele Flugzeuge braucht man, um drei Schwaben nach Ostfriesland zu transportieren ?
Ich sage einen Star Wars-Film.
Ich weiß es, ich weiß es!! (schnippschnipp)
Die Antwort lautet 42!!
🙂
@Hysterican
Akzeptiere ich als Lösung und gebe die volle (!) Punktzahl.
(Du hast im ganzen – sprachlich korrekten – Satz geantwortet, daher kein Punktabzug. Ich kann halt nicht aus meiner “faule-Säcke-und-Besserwisser-Haut”.)
Für alle, die mit “42” als Antwort auf alles nichts anfangen können:
https://de.wikipedia.org/wiki/42_(Antwort)
Lehrer/in: Falsch. Die Antwort ist… Ein Husky mit Weihnachtsmütze.
Was wollen denn die Schwaben im Ostfriesenland?
Warum nehmen sie keinen Kahn, da können Paula, ihr Polo und die Melonen mitfahren.
Respekt, auch wenn ich das Werfen von Büchern nicht unbedingt empfehlen würde – aufklappbare Fenster sind an Schulen inzwischen selten gegeben 😛
Danke für den Artikel, ich wünsche einen schönen (, denn wohlverdienten) Ruhestand 🙂
Auch ich wünsche einen langen schönen Ruhestand.
Vlt probier ich das mit dem Bücherwerfen mit ein paar alten, überfälligen LDOexemplaren am Freitag.
Könnte ein befreiender Abschluss des Schuljahres sein 🙂
Hier wird ein Loblied darauf gesungen, Anweisungen des Dienstherren zu missachten. Aber ist eine Lehrkraft, die sich den Anordnungen ihres Dienstherren so konsequent widersetzt wirklich vorbildlich?
Die meisten Lehrkräfte sind Beamte. Haben die nicht eine Gehorsamspflicht?
Mir gefällt das Bildungsziel Bücher aus dem Fenster zu schmeißen aber auch aus einem anderen Grunde nicht – nämlich, weil unter einigen Fenstern die Lehrkräfte ihre Autos parken.
Wenn alle hier Ihre Dienstpflicht so froh und zufrieden ausleben würden ( wie Die meinen ? ), dann wären die Beiträge hier im forum zwei Drittel weniger.
Die Dienstpflicht beinhaltet auch keinen blinden Gehorsam, deshalb auch als Unheil abwendendes Instrumen das Remonstrationsrecht und auch die Remonstrationspflicht.
Ihre Luxuskarosse ist versichert – gegen randalierende Schüler*innen sowieso und wenn dann ist der fällig, der nicht am Werfen hindert….
Verstehe ich Sie richtig? Sie sprechen bei der Umsetzung von Lehrplänen, die von vielen Kolleginnen und Kollegen über Jahre erdacht, erprobt und evaluiert wurden, von blindem Gehorsam? Und Sie glauben, dass das Remonstrationsrecht hier ein sinnvolles Instrument wäre? Kennen Sie Beispiele, wo dieses Instrument bei Lehrplänen erfolgreich zum Einsatz kam?
Bitte nicht alles bewusst? zwecks Argumentationsnot drehen.
Die guten und durchdachten Lehrpläne wurden schon vor vielen Jahren abgeschaft und ausgetauscht durch Kompetenzgeschwurbel. Da alle paar Jahre einen neue tolle Idee kommt, bekommen die neuen auch gar nicht die Chance sich vernünftig beweisen zu können.
Viele der Neuen sind ja schon als SuS im fachlichen Flachwasser weichgespült und gedönskompetent sozialisiert worden.
Wer stellt denn fest, welche Lehrpläne nichts taugen? Und nach welchen Kriterien?
Und nach welchen Kriterien stellt dann jede Lehrkraft fest, dass ihr Unterricht (natürlich) viel besser ist?
Das selbstbeweihräuchernde Auf-die-eigene-Schulter-Klopfen und andere ohne Begründung Schlecht-Reden bringt das System Schule nicht weiter.
Wohin Schön-Färben und Schön-Reden führen, zeigen Studien (Leistungsvergleiche) wie PISA und IGLU.
Bei den Lehrplänen bleibt aufgrund der Abschlussprüfungen nicht viel mehr übrig als blinder Gehorsam. Wenn man die Zeit hat und der Kurs es ermöglicht, kann man darüber hinaus noch zu den interessanten Dingen des Faches übergehen oder sogar exemplarisch zeigen, dass man es mal studiert hat bzw. was auf einen zukommt, wenn man es mal ggf. im Nebenfach studieren wird.
Sie wurden von Leuten erdacht, die am Schreibtisch sitzen und in der Regel soweit von der Realität entfernt sind, wie die Sonne von der Erde. Die Lehrpläne sind zu voll gestopft und viel zu oberflächlich. Normalerweise müssten sie regelmäßig überarbeitet und angepasst werden. Wüsste nicht, dass das passiert.
Genau so ist es. Inhalte, welche anspruchsvoll und im Erarbeiten und Erfassen die SuS anstrengen und fordern könnten, müssen abgeflacht und angespaßt werden. Dafür noch mehr oberflächliches Trullala.
Der Chemielehrplan (Gymnasium Sachsen) wird auch zunehmend zur Lachnummer. Das hat mit ernsthafter fachlicher Bildung nichts mehr zu tun.
* wie Sie meinen ?
Aha, 0815 – ein wunderbar passender NickName … an der Front im ersten Weltkrieg von den Alliierten sehr gefürchtetes deutsches Maschinengewehr, das hunderttausendfachen Tod und Elend gebracht hat … eine klassische Massenvernichtungswaffe unter dem Befehl der staatlichen Obrigkeit … so ähnlich lese ich die Worte des Kommentators ….. wie können LuL es wagen, gegen die Vorgaben von Oben zu verstoßen …. das halte ich für viel bedenklicher als KuK, die fach- und schülerorientiert eigene Vermittlungswege gehen.
🙂 ja
Um im Bild zu bleiben: Wer nicht an die Front will, soll doch zu Hause bleiben. Null Problemo.
Unredlich ist es aber den Sold einzusacken, doch sich vor dem Kampf zu drücken.
Hier wird immer wieder so getan, als ob die Einzelgänger, die Unangepassten, die Totalverweigerer das Recht hätten, die vom Brötchengeber verlangte Arbeit zu verweigern. Doch das ist nicht der Fall.
Wer A sagt, muss auch B sagen. Wer das Geld für die angeordnete Arbeit nimmt, muss die angeordnete Arbeit auch machen.
Und was sagen Sie dem Handwerker, der entgegen Ihren ausdrücklichen Wünschen einfach seine eigenen Ideen umsetzt?
Irgendwie scheinen hier viele Lehrkräfte zu glauben, es ginge nur um das Ergebnis. Aber nein, der Dienstherr beschreibt in seinen Lehrplänen den Weg. Ob das Ziel auf diesem Weg erreicht wird, liegt nicht in der Verantwortung der Lehrkräfte.
Die Lehrkräfte, die in der Regel Beamte sind, dienen. Dienen bedeutet, dass die Lehrkräfte sich redlich mühen und für das Ergebnis nicht verantwortlich sind. Es handelt sich hier um keinen Werksvertrag, wo vereinbart wird, ein bestimmtes Ergebnis zu erstellen.
Die Lehrkräfte bekommen ja auch nicht weniger Gehalt, wenn SuS das Klassenziel nicht erreichen.
Ach ja: Opa erzählt vom Krieg.
Und Ragnar weiß es viel viel besser.
Sie sagen a > Opa erzählt
Wo bleibt b > Ragnar erzählt.
Unabhängig vom Inhalt
Aus dem Bauch heraus: wenn ich jemand ala jung dynamisch abkanzle 😉 Witzelchen ists hier nicht, dann muss ich ran und zeigen, dass ichs besser kann.
Nicht Ragnar kanzelt ab, sondern der Autor, der behauptet so viel schlauer zu sein, als die vielen Kolleginnen und Kollegen, die in der Regel über viele Jahre Lehrpläne erdacht, erprobt und evaluiert haben.
Es ist wirklich zum K… dass da jemand anscheinend nicht teamfähig oder-willig ist, sein eigenes Süppchen kocht, sich dann auch noch selbstgefällig auf die Schulter klopft und nun auch noch ein digitales Plenum zum Schulterklopfen zur Verfügung gestellt bekommt.
Aus welcher Textstelle lesen Sie Ihre Aussagen heraus ?
Welche Aussagen meinen Sie genau?
🙂 die von Ihnen Getätigten ???
Die lese ich aus den Textstellen oben im Text heraus.
🙂 ist ja wie in der Schule.
Da würde jetzt drunterstehen: Leider begründen Sie Ihre Aussagen nicht.
Also ich mag jetzt nicht weiterbohren – lesen Sie gerne weiter heraus……vlt. wirds ja noch.
[ verwundert, nicht überheblich, Lehrer ?]
Ja, so etwas gibt es leider immer wieder an Schulen: Zuerst ungenaue Fragen stellen, dann auch auf Rückfragen nicht antworten können oder wollen und abschließend sinnlose Kommentare schreiben…
Gute Schule sieht anders aus.
Jetzt dürfen Sie gerne das KZimmer verlassen und über Ihre Aussagen nachdenken 🙂
Wenn Sie das Spiel spielen wollen, müssen Sie noch a bisserl üben; so ist es noch zu einseitig amüsant – got it ?
Niemand muss draußen nachdenken. Genauso wie der Autor dürfen sich solche Lehrkräfte früher oder später mit den Eltern und der Schulleitung auseinandersetzen. Und vielleicht auch ähnlich häufig wie der Autor die Schule wechseln.
Es mag sein, dass Sie so etwas einseitig amüsant finden. Meinen Humor trifft das nicht.
Au weia!!!
Nicht allem aber einigem kann ich sehr gut zu stimmen in diesem Beitrag aber nun dieser Beruf lebt auch von verschiedenen Ansichten und Wegen. Aber zwei Dinge finden meine volle Zustimmung. Erstens eigene Wege zu gehen um seine Schüler bestmöglich abzuholen und zweitens sich auch auf sein Bauchgefühl mal zu verlassen, dass wird einem versucht regelrecht abtrainiert zu werden.
Ein letzte Punkt in dem wir uns wohl alle einig sind: „Es wird eine der herausragenden bildungspolitischen Aufgaben der Zukunft sein, solche vorbildlichen Lehrerpersönlichkeiten zu finden beziehungsweise auszubilden. Dies wird nur mit hohen finanziellen Anreizen, attraktiven Arbeitsbedingungen und geeigneten Ausbildungsmethoden und -personen möglich sein. Lehramtskandidaten sollten schon in einer frühen Phase ihrer Ausbildung für sich selbst herausfinden, ob sie diese Voraussetzungen erfüllen. Wünschenswert wäre ein duales Studium ab dem ersten Semester, wo schön früh mithilfe von Schülern und betreuenden Mentoren diese vorhandenen oder fehlenden Qualifikationen erkannt werden können. Auf diese Weise erspart man den Lehramtskandidaten den Frust eines erfolglosen Studiums und den Schülern schlechte Lehrer.“.
Leute , die andere dazu auffordern, Bücher aus dem Fenster zu werfen, sind mir suspekt.
Lehrmittel? – Besser aber “Leermittel”, die wegen ihrer Phantasielosigkeit bitte nicht mit literarischen Ergüssen verwechselt werden sollten. Von daher verbietet sich die Bezeichnung Buch. Es sind halt nur Druckerzeugnisse.
In einem gebe ich Ihnen allerdings recht, sie gehören über die Altpapiertonne entsorgt.
Wenn die Le(h/e)rmittel so leer sind, sollten diejenigen, die sich an der Leere stören, einfach mal neue Lehrmittel erstellen. Die Schulbuchverlage suchen ständig Lehrkräfte, die ihre Ideen verschriftlichen.
Wessen Ideen verschriftlichen?
Ihre eigenen Ideen.
Warum sollten die für andere arbeiten?
Wenn es dienstliche Obliegenheit ist, dann müsste es entsprechende Freistellungen hier in NRW ans QUA-LIS geben. Die Vorschläge würden dann dort erarbeitet und verbindlich gemacht für die Verlage.
Läuft aber anders – bei der Erstellung der Kernlehrpläne sind die Verlage durch ihre Lobbyvertreter bereits im Vorfeld über die Referentenentwürfe informiert und können entsprechend reagieren. Wenn dann schulintern die Curricula von den Fachschaften auf Grundlage der verabschiedeten KLP erarbeiten, haben die verlage ihre angepassten Schulbuchversionen schon im Druck und versenden ihre Handreichungen zu den KLP sowie Anschauungsexemplare. Die fachschaften können dann der Schulkonferenz die Schulbuchreihe zur Genehmigung vorschlagen, die am ehesten zum schulinternen Curriculum und in den Kostenrahmen des Sachaufwandträgers passt.
Die Lehrkräfte erfahren als letztes von Plänen/Curricula, die sie dann aber sofort umsetzen müssen.
Es ist mir unverständlich, warum es nicht generell eine vorherige Veröffentlichung gibt und damit Zeit, sich mit neuen Curricula in Ruhe beschäftigen und darauf einstellen zu können.
Zudem bräuchte es ein Evaluation- oder Rückmelde-System, da immer wieder unklare Formulierungen auftauchen, die Übergänge zwischen den Stufen nicht gut abgeglichen sind, fächerübergreifende Bezüge nicht hinreichend bedacht sind.
In meinem Regierungsbezirk in NRW sind die Schulen vorab über neue Pläne/Curricula informiert worden. An einigen Schulen hatten Schul-Teams bereits Lehrbücher erstellt oder waren dabei. Die anderen Schulen sollten Materialien entwickeln und erproben. Es gab eine mehrjährige Evaluationsphase.
Aus den Gründen warum sehr viele Menschen arbeiten:
a) Weil es Spaß macht.
b) Weil man damit Geld verdient.
Je nachdem wie hoch die Auflage ist, verdienen Schulbuchautoren wirklich gut, zB Schmolke/Deitermann.
Auch mir wurde einmal von einem bekannten Verlag die Mitarbeit an einem neuen Lesebuch nach dem Lehrplanplus angeboten. Das hieß: Erstellung des Lesebuchs, Lehrerhandbuchs, Erarbeitung von Zusatzmaterialien.
Das hätte mindestens geheißen:
-1-2 Jahre lang an einigen Wochenenden Konferenzen in einem Hotel mitten in Deutschland mit den anderen Buchautoren zur Absprache
-Erproben der Unterrichtseinheiten in der eigenen Klasse
Ich habe mich – obwohl der Aufgabenbereich sehr interessant klang – dagegen entschieden, weil ich weder diese enorme Anzahl an Wochenenden investieren noch alle Erprobungseinheiten in der Klasse durchführen konnte ohne den eigentlichen Stoff zu vernachlässigen. Das evtl. zu verdienene Geld hätte mich nicht gereizt, denn das machte nur einen geringen Anteil des Verkaufserlöses der Bücher aus. Zeitlich war für mich so etwas neben des Unterrichts einfach nicht machbar.
Ebenfalls zur Zeit der Einführung des Lehrplans plus wurde ich von einem anderen Verlag angefragt, mit einer Autorin ein Rechtschreibarbeitsheft nach den neuen Kriterien zu überarbeiten. Auch hier war der Grund die mangelnde Zeit und dass ich hätte weit fahren müssen um mich mit der anderen Autorin zu treffen. Hier hätte ich es mir überlegt, wenn der Anfahrtsweg nicht so weit gewesen wäre, wäre aber zeitlich auch zusätzlich um einiges strapaziert gewesen.
Videokonferenzen waren zu der Zeit noch nicht angedacht. Auf den “Verdienst” kann man sich bei einer Mitautorenschaft nicht verlassen, denn man erhält immer nur einen geringen prozentualen Anteil des Verkaufserlöses.
Natürlich differiert der Verdienst von Verlag zu Verlag und in Abhängigkeit von der Auflage. Das von mir angeführte Beispiel die Autoren Schmolke/Deitermann sind schon sehr lange erfolgreich am Markt. Mit einem ihrer Rechnungswesen-Lehrwerke habe ich bereits in meinem Studium in den 1990er-Jahren gelernt. Heute lehre ich mit diesem Klassiker.
Auch wenn ich die Autoren nicht persönlich kenne, bin ich sicher, dass sie wirklich sehr gut verdienen. Der zeitliche Aufwand dürfte nicht allzu groß sein – dieses Jahr ist beispielsweise die 53. Auflage „Industrielles Rechnungswesen – IKR“ erschienen. Da müssen nur noch neue gesetzliche Regelungen eingearbeitet werden. Alles andere hat sich bewährt.
Hab ich ne Zeitlang mal gemacht … das, was ich mit einer Reihe von engagierten und erfahrenen KuK eingereicht hatte, war nach der schulbuchverlaglichen “Überarbeitung” nicht mehr wiederzuerkennen.
Daraufhin haben wir die Erlaubnis zur Verwendung unserer Vorschläge verweigert.
Im Übrigen: nach über 30 Jahren “direktem und ausdauerndem Einsatz an der Bildungsfront” (davon allein 12 Jahre an einer Brennpunkthauptschule im großstädtischen Bereich) ziehe ich mir so ein dummes 0815-Geschwätz, wie weiter Oben als Replik auf meinen Kommentar gar nicht mehr an.
Das “0815-Geschwätz” ist mit Sicherheit nicht dumm, sondern der in Ihrem Fall bedauerlicherweise erfolglose Versuch, Menschen, die über keinerlei Kenntnisse im Arbeitsrecht verfügen, eine Brücke zu dieser Thematik zu schlagen.
Verschiedene sehr kritische Anmerkungen zu Uli Blacks Einlassungen:
1) Lernmittelfreiheit gilt auch in Baden-Württemberg, folglich werden die Lehrbücher kostenlos an die SchülerInnen ausgeliehen. Wohlgemerkt, von uns Steuerzahlern bezahlt!
Ein ausgegebenes Lehrbuch, da ja Leihgabe, soll am Ende des Schuljahres (eigentlich) möglichst unbeschädigt und ohne Schülernotizen zurückzugeben werden.
Bei Beschädigung, je nach Ermessen der Lehrmittelausgabestelle an der Schule, immer jedoch bei Verlust (hier: aus dem Fenster werfen), muss das Buch ersetzt werden, die Erziehungsberechtigten bekommen also eine Rechnung!
Wie passt das denn auch mit der geschilderten Reaktion der Schulleitung zusammen?
Mein Fazit: völlig unglaubwürdiges “Geschichtle”!
2) Zu den Begriffen a )”Pädagoge”, b) ” Gymnasiallehrer” und c) “Ausbildungslehrer für Studierende im Praxissemester”:
ad a) Fachlehrkraft ist zwar in Personalunion “Pädagoge”, da auch pädagogisch ausgebildet
und tätig, ist aber nicht expressis verbis voll ausgebildeter “Pädagoge”, da er/sie im
Normalfall kein Vollstudium in Pädagogik vorweisen kann
ad b) “Gymnasiallehrer”:
Ich vermute im Angestelltenverhältnis, denn als verbeamteter Lehrer hat man Dienstgrad.
Nach 35 Dienstjahren wohl meist Oberstudienrat (= OStR), oder StR (= Studienrat).
Schulbeurteilungsnoten u.a. haben Einfluss auf Beförderung(stempo).
Mit Funktionsstelle ist man StD (= Studiendirektor).
Mein Fazit;
Begrifflichkeit hat wenig Aussagekraft über Fachkompetenz als überzeugende Referenz für Lehramtsstudenten, Referendare oder junge Lehrkräfte, die ihre Lehrerpersönlichkeit erst entwickeln.
3) ad “Ausbildungslehrer” im Praxissemester
unklar, kann alles mögliche beinhalten. Keine Qualifikation per se!
Jegliche Fachlehrkraft an der Schule (hier: Gymnasium) als Seminarschule kann mit der
Betreuung und Mitausbildung als Mentor/in von ReferendarInnen betraut werden.
Uli Black war wohl kein Seminarlehrer an der Uni, oder?
Wenn doch, hätte er diese offizielle Funktion doch wohl erwähnt und sein Licht nicht unter
den Scheffel gestellt.
Auch seine Diktion, Duktus und Inhalt lassen das nicht vermuten.
Relevanz seiner Ausführungen???
Mein Fazit:
Artikel mit äußerster Vorsicht genießen, mit sehr kritischer Distanz!
PS: zu meiner Expertise:
Ich habe viele Dienstjahre in BaWü und Jahrzehnte in Bayern, an verschiedenen Gymnasien, Englisch, Geschichte und Politik mit viel Herzblut und Begeisterung für meine Fächer und die Arbeit mit den SchülerInnen unterrichtet.
Habe auch zahlreiche Referendarinnen mitausgebildet. War viele Jahre als StDin Fachleiterin in Englisch (1. Fachbetreuung), war Lehrerin mit Leib und Seele. Bin inzwischen in Pension.
Mein Gesamtfazit:
Lehrplan ist zu erfüllen und Lernziele sind zu beachten!
Stets Lehrbuch mit vielen zusätzlichen Materialien ergänzen, immer aktualisieren, am Puls der Zeit bleiben.
Besonderes Augenmerk auf Methodenvielfalt! Medieneinsatz und Arbeitsformen variieren! Und je nach Zielgruppe immer modifizieren.
Uli Black kann man googeln. Er ist auch Autor von 2 Büchern. Außerdem findet man ein Interview mit ihm auf dem youtube Kanal von B. Krötz (was mich wundert, da B. Krötz mir eher als konservativer Verfechter des Mathematikunterrichts aufgefallen ist), wo er seinen Ansatz erklärt.
Buchautoren haben für mich hier per se keine Relevanz, sind keine Autorität an sich beim kritischen Kommentar zum Artikel von Uli Black.
Inhalt seines Textes, Diktion und Gedankenführung sind für mich jedenfalls sehr dubios.
(Bin vom Fach, StDin a.D., verfüge über Expertise und jahrzehntelanger praktischer Unterrichtserfahrung in drei Fächern am Gymnasium in BaWü und Bayern.
Ich war auch häufig in der Referendarmitausbildung tätig, hatte viele Jahre in Personalunion eine Funktionsstelle als Fachleitung im Fach Englisch.)
Außerdem gilt es zuerst zu überprüfen, um was für Publikationen von Uli Black es sich denn überhaupt handelt.
Und dann noch ggf. Reaktionen der akademischen Fachwelt und Fachdidaktikern mit langer Praxiserfahrung (Rezensionen) zu studieren.
Übrigens, das Urteil eines Mathekollegens ist hier wenig hilfreich und nicht zielführend, denn der Unterricht, Inhalte, Lernziele unterscheiden sich doch erheblich:
Tagesaktualität entfällt z.B., wenn man Politikunterricht mit Matheunterricht vergleicht.
Oberstufenunterricht in Englisch, wo topaktuelle Zusatzmaterialien zum Buch zur Landeskunde oder -politik, stets am Puls der Zeit, eingesetzt werden, ist ansonsten ja immer in Gefahr, teilweise zu veralten.
Stoffgebiete wie Analysis, Kurvendiskussionen, Trigonometrie werden dagegen wohl eher nicht obsolet, oder?
Ich glaube, Sie haben meinen Einwand falsch verstanden. Wenn Sie weiter unten meine Kommentare lesen, dann sehen Sie, dass ich ähnlich wie Sie denke.
Da Sie aber bezüglich der Person Black Ihre Zweifel über dessen Expertise äußerten, indem Sie sich an seinen Berufsbezeichnungen störten, habe ich Uli Black gegoogelt.
Herr Black hat schon Erfahrung. Vielleicht war ihm sein Titel (Studienrat) nicht so wichtig, das soll es geben. Falls er angestellt war, warum sollte er nach erfolgreichem Studium schlechter unterrichten als ein Studienrat?
Er steht unserem Schulsystem kritisch gegenüber. Aus dem Interview bei youtube erfährt man viel über seine Einstellungen.
Der Mathematikprofessor hat übrigens gar nicht viel dazu gesagt; eigentlich müsste es ihm nicht gefallen haben, was Herr Black mitgeteilt hat, denn Dr. Krötz steht für konservativen Unterricht mit ganz alten Schulbüchern in Mathematik.
Die Bücher, die Uli Black geschrieben hat, beziehen sich anscheinend auf das Schulsystem – ich habe sie nicht gelesen.
Nachdem ich das Interview gesehen habe, (zu finden bei youtube unter: Kafka kannste knicken: Interview mit dem Lehrer und Autor Uli Black)würde ich sagen, dass er als Lehrer ein Idealist war und das Beste für seine Schüler gewollt hat, wie viele von uns und Sie mit Sicherheit auch. Er hat einen anderen Weg beschritten, der zu diskutieren ist und bei vielen eher Ablehnung hervorruft, weil es eben nicht nur die beiden Extreme gibt, sondern auch Zwischentöne, wie Sie selbst beschrieben haben.
Es ist sicher wichtig, einen eigenen Stil zu entwickeln und sich nicht über Gebühr gängeln zu lassen. Dennoch habe ich im Typus “John Keating” nie mein Vorbild gesehen, denn unterrichten per Charisma vernachlässigt die Sache und macht es denjenigen schwer, auf die das Charisma – aus welchem Grund auch immer – nicht wirkt. Mir ist es am liebsten, wenn meine Schüler sagen, dass sie in meinem Unterricht etwas gelernt haben.
Nachdem ich den Anfang las, dachte ich, achso, mal wieder das: Lernen mit Spaß und Freude. Wieder kommt ein Jungspund daher und will das Rad zum zweiten Mal erfinden. Seit Jahrzehnten schon kann man sowas lesen, die alten Methoden seien überholt, wir bräuchten mehr Spaß und Freude und zum x-ten Male liest man, wie mit diesem Spaß und Freude alles so angeblich besser funktioniert. Nur leider können wir das nie überprüfen. Es bleiben im Wesentlichen immer Behauptungen und die Leistungen der Kinder sind trotz Spaß und Freude in all den Jahrzehnten nicht besser geworden und ihre Schullust nicht wirklich größer. Jetzt setzt uns wieder jemand diesen Floh ins Ohr. Ich möchte Name und Adresse haben und mir das vor Ort genau anschauen und nicht nur so eine Vorführstunde, die vorher x-mal einstudiert wurde und für die alle problematischen Schüler rausgenommen wurden.
OK, habe weiter gelesen, kein Jungspund, aber wieder ein Verfechter der Spaßschule.
Spaßschule lese ich weniger raus. Ich lese, dass der Kollege sehr von sich überzeugt ist, und von den Schulbüchern, die die Kolleginnen und Kollegen geschrieben haben, nichts hält. Eine Einstellung, die man nicht selten im Lehrerzimmer findet: Ich toll – du nicht.
Eine Einstellung, die die Schule und damit die SuS nicht weiterbringt.
Wunderbares Plädoyer für Skepsis & Souveränität im Lehrberuf!
(lt. Hermann Giesecke eine der wichtigsten Eigenschaften von Pädagogen)
Wer sich in Studium und Referendariat nämlich gründlich (aus)gebildet hat, kommt mit einem gestrafften Kernlehrplan aus, kann methodische Entscheidungen ohne Gängelei fällen – und dem Beziehungsaspekt im Unterricht das nötige Gewicht geben.
Ob man das eingeführte Lehrmittel aus dem Fenster werfen lässt, ist nicht nur eine Stilfrage, sondern auch eine des Faches – entscheidend ist, dass man es keineswegs von A bis Z durchbuchstabieren muss. Allerdings braucht es dazu die Leistungsorientierung, den fachlichen Überblick und den pädagogischen Führungswillen, der dem Autor anscheinend eigen war. Bei Novizen im Lehramt ist das nicht selbstverständlich – manchem tut ein solcher Rahmen anfangs gut.
Zu “manchem tut ein solcher Rahmen anfangs gut” – das ist seeehr diplomatisch ausgedrückt, lieber Michael Felten. Als Ferienlektüre empfehle ich Lave&Wenger – wie klar einem durch die Lektüre wird – u.a. geht es um den Weg von Näherinnen und Navigatoren vom Novizen- zum Expertenstatus – wie lang der Weg dazu ist, in unvorhergesehenen Situationen sicher entscheiden und handeln zu können. Vor über 40 Jahren habe ich begonnen zu ‘lehren’, fachlich war ich ganz gut, didaktisch hat es sehr lange gedauert, bis ich den Expertenstatus erreicht hatte (und es ist immer noch Luft nach oben), da besonders in der Hochschullehre die Idee des muddeling through überlebt. Durch Zufall gelingt dies den ‘Naturtalenten’ schnell, was aber leider nicht heisst, dass gerade die die Nachwachsenden beim Aufbau der notwendigen Expertise unterstützen können. /// Lave, Jean, & Wenger, Etienne. (1991). Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
Ich finde die Texte in den Schulbüchern, gerade in den Fremdsprachen, fand ich schon als Schülerin immer irgendwie sehr gestellt. So werden wahrscheinlich kaum Teenager miteinander reden.
Übrigens: Hatte John Keating seine Schüler nicht nur aufgefordert, die Einleitung rauszureißen und nicht das gesamte Buch? Übrigens hätte “Club der toten Dichter” ursprünglich anders enden sollen. Keating bricht im Unterricht zusammen. Als seine Schüler ihn im Krankenhaus besuchen, eröffnet er ihnen, dass er todkrank ist und seine restliche Zeit mit seiner Freundin verbringen möchte. Als er ein letztes Mal in sein Klassenzimmer geht, um seine Sachen zu packen und sich zu verabschieden, kommt es zu dieser legendären “O Captain, my Captain” Szene.
Die meisten Schulbücher für Fremdsprachen kranken nicht an interessanten Inhalten, sondern dass sie nicht sehr strukturiert aufgebaut sind. Es gibt wenige alte Bücher, die eine gute Struktur haben, schon längst vergriffen, und ich hüte sie wie Goldschätze. Mit ihnen könnte man zur Not die Sprache auch alleine lernen.
Mit den quitschebunten Seiten, auf denen jemand alle Schrifttypen ausprobiert hat, kann ich wenig anfangen. Viele Schüler auch nicht.
@Lisa
“Die meisten Schulbücher für Fremdsprachen kranken nicht an interessanten Inhalten, sondern dass sie nicht sehr strukturiert aufgebaut sind.”
Euphemismus pur, stimmt aber leider!
Bei neu anzuschaffenden und neu konzipierten Lehrwerken (hier: Englisch-Lehrwerk) muss man auf die abstrusesten Sachen achten, z.B. exemplarisch:
Der Grammatikteil hinten im Buch (Ja, noch gibt es den!) muss man sich sehr genau anschauen und gut überlegen, ob das hilfreich sein soll, …
@Lisa
Ach ja, kleiner Nachtrag – aber eigentlich selbstverständlich:
Dieser Grammatikteil hinten im Buch ist natürlich nicht vollständig! Viele “kleine” Grammatikthemen fehlen schlicht und ergreifend. (Andere werden dafür unverständlich breitgetreten …)
Und:
“Mit den quitschebunten Seiten, auf denen jemand alle Schrifttypen ausprobiert hat, kann ich wenig anfangen. Viele Schüler auch nicht.”
Na ja, es ist und bleibt eben ein Schulbuch bzw. sollte eines sein. Auch wenn manche Schulbuchverlage mit den Anfang bis Mitte der Nuller-Jahre hektisch auf den Markt geworfenen “Lehrwerken” (mittlerweile immer stärker Leerwerken)meinten, sie könnten “Bravo”, “VIVA”, “MTV” … ähnlich werden … und keiner von den (dachten die wohl in den Schulbuchverlagen?) “kleinen Dummies” (SuS & LK) würde es merken?
Es hat damals schon nicht funktioniert … Und wie wollen die mit Tiktok & Co mithalten?!
Mithalten ist der falsche Ansatz – dagegenhalten mit Anspruch, das kommt mittlerweile wieder besser an, denn die SuS finden es stellenweise schon wieder “cool”, wenn ihnen etwas zugetraut und abverlangt wird, so meine persönliche Erfahrung.
Allerdings muss man das häppchenweise wieder fordern, so wie man beim Sport nach längerer (jahrzehntelanger?) Pause auch nicht nur vom Sofa rutscht, um mit dem Taxi zum nächsten Marathon gefahren zu werden – bei so einer Strategie ist der Misserfolg ja auch “eingebaut”. Will man es besser machen, dann kann man tatsächlich oft auf das Leerwerk einen Bogen machen und nur auf die Textgrundlagen (oft noch ziemlich ok gemessen am Rest) zurückgreifen und auch die eine oder andere Grammatikübung nehmen, nachdem man die Grammatik selber und “freihändig” vermittelt hat, was oft auch viel schneller geht.
Bin ganz Ihrer Meinung.
Wenn man die Lehrwerke (hier Englisch) über Jahrzehnte vor der Neueinführungsentscheidung in der Fachkonferenz begutachtet, danach mit ihnen arbeitet, fällt u.a. auch Folgendes auf:
Anscheinend kann man den heutigen SchülerInnen, auch am
Gymnasium, immer weniger “zumuten”. Anspruchsniveau sinkt immer
weiter. Gleichzeitig aber Noteninflation – und Abiturientenschwemme mit
folglich natürlich immer besseren Schnitten.
Lernen, Arbeiten konnte früher und kann auch heute Spaß machen ohne
derartiges “Motivationsbeiwerk”, oft ja nur Firlefanz.
“Fördern und Fordern”, Spaß im Unterricht gehen auch anders!
Begründung des Verlages für diese offensichtliche Papier-
verschwendung: “schülergerechter, pädagogisch-didaktischer,
Mehrwert für den Lernprozess und die Erreichung der Lernziele”.
Pure Schutzbehauptung! Verschleiern der Realität! Lernniveau
(nicht nur) am Gymnasium inzwischen auf “kleinstem gemeinsamen
Nenner” wegen (zu) hoher Übertrittszahlen ans Gymnasium. Wohl
auch an der Grundschule wegen problematischer Integration von
Nichtmuttersprachlern!
All dies (konstruktiv) Kritisches, auch Ketzerisches, aus berufenem
Mund einer sehr erfahrenen Lehrkraft, die mit Hingabe, viel Herz-
blut, unterrichtet hat, mit Leib und Seele an der Schule war.
Mehr Digitales, mehr Eigenverantwortung, mehr Freiheiten für Lehrkräfte und bessere Arbeitszeiten!!!
Der Beitrag suggeriert wie so viele zuvor: Wenn die faulen Lehrer sich nur mehr reinhängen und mal richtig vorbereiten würden (statt nur Bücher aufzuschlagen), dann klappt das mit Schule und Lernen ganz easy.
Hab ich am Anfang des Berufslebens auch so gesehen und musste dann feststellen, dass man sich bei vollem Deputat und vielen verschiedenen Fächern an der Grundschule mit einem solchen Ansatz kaputtarbeitet. Bücher und Lehrerhandbücher helfen dabei, einen Job (das ist es nunmal) in der dafür vorgesehenen Zeit zu erledigen. Anders geht es im derzeitigen System nicht und ich finde es gefährlich, Berufsanfängern etwas anderes zu raten, sie bleiben sonst nicht lange.
Das ist genau das Problem. Möchte man seinen Job in der bezahlten Zeit schaffen, kommt man um die Bücher nicht herum. Aus der Sicht von Außenstehenden ist man der faule Lehrer, der “nur” das Buch abarbeitet. Versucht man, seinen Unterricht kreativer zu gestalten, was natürlich mehr Zeit erfordert arbeitet man 45 Stunden oder mehr. Dann ist man aus der Sicht von Außenstehender der, der selbst Schuld ist, weil er es nicht gebacken bekommt. Warum wohl spielen Künstler nicht jeden Abend ein neues Programm. Würde eine Lehrkraft einen vorbereiteten Unterricht 15 Mal halten ist es auch wieder der faule Sack.
Wie man es macht, ist es nichts.
Drum mache es jeder so, wie er es für sich, für seine Schüler*innen
und evtl. Nachfragenden (SL/Fach betreuer, Eltern…..) vertreten kann – als er/sie und nicht wie andere.
Ich verstehe die Ablehnung und den Aufstand hier nicht.
Jeder so, dass es allen nützt.
Wir fassen zusammen:
1. Habe extrem hohes Charisma.
2. Suche Dir Stoff für Schuljahr 5 bis 13 JEDES MAL und AKTUELL ANGEPASST zusammen.
Ääähhhhh, ja.
Is klar.
Würden Sie jungen, in den Beruf einsteigenden Pilotinnen, Chirurgen oder Physiotherapeutinnen ihr Schicksal in die Hand geben, wenn deren Berufszunft nach folgendem Grundsatz verfährt: «Jungen Kollegen und Kolleginnen kann ich nur den Rat geben … ihrem Instinkt und Bauchgefühl zu vertrauen»? Wenn Sie diese Frage mit «nein!», für junge Lehrkräfte mit «Ja!» beantworten, was folgt daraus für die Reputation des Lehrberufs und womöglich dessen angemessene Bezahlung im Vergleich zu vorgenannten Berufsgruppen?
Ohne dem Rat uneingeschränkt zuzustimmen: Auch die obigen Berufsgruppen benötigen in gewissen Situationen ein gutes Maß an Intuition (ich halte „Instinkt und Bauchgefühl“ auch nicht für so passend), welches in pädagogischen Berufen wohl eine größere Rolle spielt. Die Intuition geht schließlich auch mit Erfahrung einher.
Ich stimme Ihnen zu, dass diese kein Gegenpol zu einer soliden und qualifizierenden Ausbildung sein darf, das wäre tatsächlich schädlich für den Lehrerberuf (und dessen Reputation).
Zustimmung: Je besser die fachliche Ausbildung, desto mehr Raum für Kreativität.
Pädagogik hat vielleicht – das ist aber nur eine persönliche Meinung, nichts Offizielles – manchmal wirklich mehr mit Kunst und Begabung zu tun als mit Handwerk. Nicht jeder Maler, der die handwerklichen Grundlagen beherrscht, malt auch die Mona Lisa oder Guernica.
Der Pilot dagegen sollte weder den “Reformflug” erfinden noch allzu kreativ sein.
Chirurgen sind oft, wenn auch nicht immer Handwerker, Physiotherapeuten auch.
Der Beitrag zeigt, dass die Lehrkraft in einer anderen Zeit unterrichtet hat. Von daher nicht anwendbar auf heutige Gegebenheiten (sowohl gesellschaftlich als auch bildungspolitisch). Und Handysucht, Inklusion oder Migration ist da noch gar nicht mit eingeschlossen. Und wenn ich dann lese Gymnasium.. ja, damals gab es eine klare Trennung zwischen den Schularten.
Ich wette die Person gehört zu denjenigen, die dafür dankbar sind, dass sie heutzutage nicht mehr unterrichten müssen.
Es geht, zumindest in bestimmten Fächern auch heute noch ohne Buch.
Besser alte Schulbücher als keine Schulbücher.
Fachlich sind die meist besser…
Alte Schulbücher sind oft auch die besseren.
Ein Grund mehr, sie nicht aus dem Fenster zu werfen, trotz johlender Schüler.
Jawohl!
Als Fundus, Grundgerüst, welches selektiv, manchmal auch gar nicht, in den Unterricht einfließt. Ist ja fachabhängig!
In Englisch habe ich die obligatorischen Vokabeln immer komplett lernen lassen.
Die Grammatikvermittlung aber nach meinen eigenen didaktischen Vorstellungen gestaltet, mit eigenem Tafelanschrieb und eigenen Grammatik- und Arbeitsblättern.
Oft en bloc, mit gesamter, größerer Sachlogik im Hinterkopf. Im Buch war’s mir oft zu verstreut in der unit, z.T. auch unlogisch und unvollständig dargestellt
.
Zudem habe ich Übungen im Buch, auch im workbook, nur wohlüberlegt selektiv eingesetzt, diese meistens mit eigenen Übungen ergänzt.
HabeText- und Materialblätter immer topaktuell zusätzlich zum Thema der Buchtexte durchgenommen.
Unabdingbar natürlich im Politikunterricht. Aber auch in Englisch, um meine SchülerInnen mit tagesaktuellem Stoff für das Fach zu gewinnen.
Habe also stets aktuelle Materialien aus der Presse, Internetquellen, z.B. auch Diagramme, Statistiken etc.verwendet
In der Oberstufe, also ab Jahrgangsstufe 10, besonders jedoch in der Kollegstufe (= Jgst. 11 und 12 bzw.noch 13 im G9) kann man sehr kreativ sein.
Doch die Lehrplanthemen müssen vollständig behandelt werden.
Auch in Englisch unterrichtete ich folglich immer am Puls der Zeit in meinen sehr zahlreichen Oberstufenkursen über die Jahrzehnte.Alle meine FachkollegInnen taten das.
In Englisch somit nur Grundlagentexte selektiv aus dem Buch verwendet.
Beachtung der Lehrplanvorgaben für Prüfungsvorbereitung, u.a. für’s Abitur, absolut unabdingbar, zwingend notwendig!
Und dies nicht nur in Geschichte, in allen Fächern!.
Fazit: Lehrwerke, am Gymnasium, veralten inhaltlich in manchen Fächern sehr schnell.
Die Lehrkraft ist auch hier also immer gefordert, Herausforderung – und Chance.
Und ich war wirklich keine “tolle Superlehrerin”, keine Ausnahme.
Einfach eine ganz normale, engagierte Lehrkraft, wie es sie sehr viele gibt.
Für mich ist das Lehramt kein “Job”, sondern eine Aufgabe, eine Berufung!
Man darf natürlich nicht übersehen, dass das Schulbuch in der Schilderung im Text zu der Zeit einen zentraleren Stellenwert im Unterricht hatte (so verstehe ich zeitliche Einordnung zumindest). Heute sind die Möglichkeiten der Ergänzung durch weitere Quellen sehr viel größer, aber auch unübersichtlicher.
Ich nutze ein Schulbuch ebenfalls mal so, mal so, Bücher veralten schon deshalb, weil sich Lehrpläne häufig genug ändern. Aber man kann auch (nur) mit einem alten Buch den Kindern genügend beibringen (wie unzeitgemäß, ich meinte: beim Lernen begleiten), wenn denn die Einstellung (beiderseits) stimmt.
Teile Ihre Meinung.
Ich sah mich überwiegend nicht als Coach/Lernbegleiterin.
Ein Augsburger Fachdidaktiker an der dortigen Uni warnte bei einer Lehrerfortbildung vor der Mutation/Perversion der Lehrkraft zur “Lehrertapete”, als der Begriff “Coaching” in der Fachdidaktik plötzlich ein Hype wurde.
Das gute alte sog. “fragend-entwickelnde Unterrichtsgespräch”, auch kompakte Lehrervorträge, z.B. in Geschichte in der Oberstufe oder auch als Input vor der Partner- oder Gruppenarbeit, pflegte ich dagegen ausgiebig.
Mei, wie altmodisch!!! “Pauker(in) der alten Schule” – Igitt!
Meine KollegiatInnen baten mich oft um einen kompakten Lehrervortrag zum Stoff, ermattet von den ständigen Still-, Partner- oder Gruppenarbeiten in vielen Fächern.
Sie schätzten die mundgerechte Vermittlung der Quintessenz und Knackpunkte des Klausur- oder Abistoffes auf diese Art zur Abwechslung sehr – war ja auch bequemer!
Das ist aber doch “Frontalunterricht!” Igitt!!!
Halt wie Vorlesung an der Uni.
Bei der Stofffülle und Zeitnot in Geschichte manchmal jedoch auch deshalb unabdingbar.
Auch beim “Lernen lernen”, also Vermittlung von Arbeitsmethodik, Lerntechniken, Lerntypen, Lernkanälen, Lesetechniken etc.
Oder auch im Leistungskurs im alten G9 bei der Betreuung/Begleitung der KollegiatInnen beim Abfassen ihrer Facharbeiten.
Nur in den Freiarbeits- oder Projektarbeitsphasen, also beim selbstgesteuerten Lernen, sah ich mich mit Überzeugung in der Funktion bzw. Rolle als Coach.
Didaktische “Moden” kommen und gehen doch. Vieles bleibt in modifizierter Form, manches verschwindet, siehe Sprachlabor.
Ich denke nur an “Einsprachigkeit unbedingt schon in Klasse. 5”, später verpönt und abgelöst vom Credo der “aufgeklärten Einsprachigkeit”, welche ich (heimlich) immer schon praktizierte!
Kritische Distanz ist deshalb angesagt, “Selbst ist die Frau/Lehrerin”, reflektiert und mit Augenmaß, zum Wohle unserer SchülerInnen!
Traumtänzereien sind doch absurd.
Die politischen Rahmenbedingungen und z.B.auch juristische Hemmnisse begrenzen oft sehr, doch Nischen, Graubereiche, Interpretationsspielräume eröffnen auch Freiräume.
Manches ist auch ideologisch aufgeladen: den Begriff “Schulfamilie” in Bayern fand ich völlig fehl am Platz, gar verlogen.
Für die Zusammenarbeit mit manchen Familien also völlig unangemessen.
Denn mein Familienbegriff ist sehr positiv konnotiert, beinhaltet sehr hohes Ethos.
“Schulfamilie” kam mir deshalb jedenfalls niemals über die Lippen. Und in bildungspolitischen “Sonntagsreden” fand ich ihn nur schwer erträglich.
“Schulgemeinschaft”! – in die brachte ich mich mit Leib und Seele, mit viel Herzblut, immer voll überzeugt und sehr engagiert ein.
Dies nun aus dem Mund einer “erfahrenen Pädagogin”, die aber niemals Schulbücher aus dem Fenster hätte schmeißen lassen!
Auch nicht metaphorisch!
Wie alle sind Gejagte. Wir jagen unsere Schüler mit den vorgegebenen Lerninhalten, wir selbst werden mit der Erfolgsstatistik gejagt.
Was müssen damals für Zustände in NRW geherrscht habe. 35 Dienstjahre an 5 Gymnasien und überall das gleiche, außer ihm nur lehrbuchhörige Lehrkräfte, die weder Zeitschriften noch altersgerechte short-storys , Romane , Popsongs etc. eingesetzt haben. Da bin ich doch froh, dass ich das aus meiner Schulzeit in einem anderen Bundesland ganz anders in Erinnerung habe. Meine Schulzeit endete übrigens bevor die Karriere des Herrn Black begann.
Ist das wirklich so, dass sich Gymnasialkollegen so sklavisch an Bücher halten? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Dennoch ist ein Schulbuch ist nur ein Medium und nicht der Bildungsplan. In meinen Augen suggeriert der Artikel eine zu starke Verbindung. Man kann auch mit einem Schulbuch frei arbeiten. Gerade die modernen Schulbücher liefern immer mehr Varianten.
Für die Grundschule finde ich es gut, wenn man ein geeignetes Schulbuch findet, damit man nicht dauernd kopieren muss. Das schont Ressourcen. Ich habe mich noch nie sklavisch an ein Schulbuch gehalten. Ich nehme das heraus, was geeignet ist und ergänze mit anderen Materialien. Wir schauen uns bei Neubeschaffung die angebotenen Schulbücher genau an und diskutieren, welches uns am geeignesten erscheint und schaffen das dann an. Ein wichtiges Kriterium ist, dass man viele Dinge darin verwenden kann.
Für die Lehrkraft, die die Klasse übernimmt, ist die Info wichtig, welche Themen gemacht wurden und nicht, auf welcher Seite man im Schulbuch angekommen ist.
Eine Bemerkung zu den Bildungsplänen:
Einen Bildungsplan finde ich schon wichtig. Man setzt sich doch damit schon in der Ausbildung auseinander. Dann schaut man bei der Unterrichtsplanung, was im Bildungsplan steht. Aber ich finde schon, dass man sich am Bildungsplan orientieren sollte. Damit ist ein allgemeiner roter Faden gegeben. Je nach Klasse kann man Schwerpunkte setzen. In Bayern sind die Lehrpläne in der GS zweijährig aufgesetzt. Damit hat man einen größeren Spielraum.
Natürlich sind Bildungspläne (Lehrpläne) wichtig, schließlich geht es darum, verbindlich gewisse Inhalte und Kompetenzen (was immer man davon hält) zu vermitteln. Für meine Fächer (Mathematik, Physik) kann ich sagen, dass ich noch einigermaßen Spielraum habe, die Reihenfolge und ggf. die Tiefe zu variieren. Man kann über gewisse Themen streiten: Unter G8 (NRW) fand ich die Themensetzungen teils unvollständig und etwas lose, nun unter G9 zwar vollständiger, aber unter den gegebenen Bedingungen etwas zu ambitioniert. Es findet sich aber immer noch etwas Zeit, um sich auch mal über Sinn und Unsinn, Lust und Unlust, Spaß und Pflicht zu unterhalten, ohne gleich alles aus dem Fenster zu werfen.
Danke für den Kommentar. Das leuchtet ein.
“Gerade die modernen Schulbücher liefern immer mehr Varianten.”
Nö, gerade die modernen Schulbücher sind z.B. in den MINT-Fächern (weiterführende Schule) zunehmend fachlich flach, unstrukturiert und erschweren das Verständnis kausaler Zusammenhänge.
Sie ergänzen damit leider immer zielführender° die zunehmend weiter “angepassten (angespaßten)” und fachlich abgespeckten Leerpläne.
Diese Ziele????? erschließen sich immer weniger LuL.
Vielleicht muss man hier nach Schularten unterscheiden. Ich habe für die Grundschule geschrieben. Fürs Gymnasium mag Ihre Aussage stimmen. In der Grundschule haben wir immer mehr Aufgabenstellungen, die unterschiedlich differenzieren. Wir haben allerdings auch noch alle Schüler.