BERLIN. Das deutsche Bildungssystem muss sich grundlegend verändern, um junge Menschen besser auf die massiven Umbrüche durch Digitalisierung, Klimaschutz und demografischen Wandel vorzubereiten. Das ist die zentrale Botschaft des Bildungspolitischen Forums 2025, das nun in Berlin stattfand.

In den Vorträgen der Wissenschaftler auf dem Forum dominierte ein Gedanke: Junge Menschen müssen vor allem in die Lage versetzt werden, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. „Für die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft ist es essenziell, das ‚Lernen zu lernen‘ – also die Fähigkeit, sich immer wieder neue Fähigkeiten anzueignen, die am Arbeitsmarkt benötigt werden“, sagte Prof. Dr. Ludger Wößmann vom ifo Institut.
Auch Prof. Dr. Silke Anger vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) warnte in Berlin vor den sozialen Risiken einer zu langsamen Anpassung: „Andernfalls droht für viele der Verlust der Betätigungsmöglichkeit am Arbeitsmarkt, was zu Armut und größerer sozialer Ungleichheit führen kann.“
Prof. Dr. Kerstin Schneider vom RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung betonte die Rolle der Politik: „Die Transformationen führen zu Veränderungsbedarf in allen Bildungsphasen. Die Politik muss dafür Ziele formulieren und den Bildungseinrichtungen Freiheiten für die notwendigen Anpassungen geben.“
Im Positionspapier: Schule im Zentrum der Kritik
Ein begleitendes Positionspapier beschreibt detailliert, wie Bildung auf den Wandel reagieren muss. „Tendenziell führen die technologischen Transformationen dazu, dass eher weniger enges Faktenwissen benötigt wird, das sich leicht im Internet suchen oder von generativer künstlicher Intelligenz bereitstellen lässt. Stattdessen geht es mehr darum, das ‚Lernen zu lernen‘ – die Fähigkeit, sich im Lebensverlauf die immer wieder neuen spezifischen Fähigkeiten anzueignen, die am Arbeitsmarkt benötigt werden”, so heißt es.
Und: „Eine wichtige Grundlage dafür sind sprachliche, mathematische und naturwissenschaftliche Basiskompetenzen, die es den Arbeitnehmenden ermöglichen, sich selbst weiterzuentwickeln und an stetige Veränderungen anzupassen. Hinzu kommen Kompetenzen wie Anpassungsfähigkeit, Problemlösen, kritisches Denken und Kreativität. Aber nicht nur die Individuen müssen neue Kompetenzen erwerben, auch die Bildungspolitik muss sich kritisch fragen, ob die für die Transformation notwendigen Prozesse im Bildungssystem unterstützt werden.”
Dazu bedürfe es evidenzbasierter Steuerung von Bildungspolitik auf Basis sehr guter Daten und einer transparenten und zielgerichteten Bildungspolitik. Besonders optimistisch, dass das gelingen kann, zeigen sich die Autorinnen und Autoren allerdings nicht: „Die verschiedenen Krisen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass das deutsche Bildungssystem nicht gut darin ist, sich schnell und effizient an Veränderungen anzupassen.“
Handlungsbedarf in allen Bildungsphasen
Sie machen deutlich: Transformation erfordert Veränderungen von der Schule bis zur Weiterbildung. In der allgemeinbildenden Schule geht es vor allem um die Sicherung von Basiskompetenzen und die Förderung jener rund 25 Prozent an Jugendlichen, die als Risikoschülerinnen und -schüler gelten und nicht ausreichend auf eine Ausbildung vorbereitet sind. Hier sei es notwendig, die schulische Arbeit klar auf die Vermittlung der für den Übergang unverzichtbaren Kompetenzen zu konzentrieren.
In der Berufsausbildung müsse es darum gehen, die Inhalte schneller an die durch Digitalisierung und Dekarbonisierung veränderten Anforderungen anzupassen. Hochschulen sollten ihre Studienangebote flexibler gestalten und stärker auf lebenslanges Lernen ausrichten. Für die Weiterbildung brauche es ein transparentes öffentliches System mit klaren Zugängen, finanzieller Unterstützung und modularen Abschlüssen.
Was heißt das für Lehrkräfte? Für sie bedeutet der geforderte Wandel, Basiskompetenzen noch konsequenter zu sichern und zugleich überfachliche Fähigkeiten wie kritisches Denken, Problemlösen und Kreativität stärker zu fördern. Schulen bräuchten dafür aber Freiräume und Unterstützung, so das Papier. Ohne mutige Anpassungen werde es nicht gelingen, die Herausforderungen von Transformation und Demografie zu bewältigen.
Hintergrund: Das Bildungspolitische Forum wird jährlich vom Leibniz-Forschungsnetzwerk Bildungspotenziale (LERN) ausgerichtet, das 28 Einrichtungen der Bildungsforschung verbindet. Die diesjährige Veranstaltung fand in Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend statt. Das Positionspapier wurde von einem Team um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IAB, des ifo Instituts, des RWI sowie weiterer Forschungseinrichtungen erarbeitet.
Hier lässt sich das vollständige Positionspapier herunterladen.


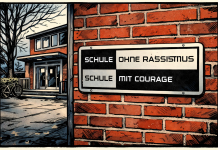







Ich bekomme echt die Krisen, wenn ich sowas lese:
Zunächst geht es doch noch um Schule, in der Grundwissen vermittelt werden soll, in der eine breite, stabile Basis gelegt wird. Es geht nicht um Spezialistentum oder Inhalte, die man einfach wegdiskutieren könnte.
In meinem Kinder-/Jugendalter kam der C64 gerade raus, wir hatten keine echte Informatik in der Schule. Wir haben miterlebt, wie Banken als speziellen, noch kostpflichten Service das Online-Banking einführten und Netzwerke wie StudiVZ und Co. kommen und gehen sehen.
Dennoch können wir uns heute sicher im Internet bewegen, online einkaufen, Filme und Serien streamen, Office-Anwendungen nutzen und Fotos digital bearbeiten. Ebenso experimentieren wir mit LLMs wie ChatGPT, erkennen aber auch die Probleme.
→ Das haben wir alles auch ohne entsprechenden Unterricht geschafft.
Im Gegensatz dazu haben wir heute (nicht wenige!) Kinder in iPad-Klassen, die zwar mit iPad und Stift unterwegs sind und Fragen in ChatGPT eintippen können, aber nichtmal einen Text in Word schreiben können! Auch Grundkenntnisse in Excel sind oft nicht vorhanden.
Auf jeden Fall müssen Kinder und Jugendliche lernen, selbstständig zu lernen. Aber gibt es wirklich jemanden im Bildungssystem, der das bezweifelt?
Natürlich sollen sie kreativ sein, aber Kreativität bedeutet eben nicht, einfach irgendwas zu machen, sondern bspw. solides Wissen aus unterschiedlichen Bereichen neu zu verknüpfen/rekombinieren, um damit ein Problem zu lösen.
Wenn ich einen Inhalt an der Tafel oder auf einer selbstgemalten OHP-Folie erklären kann und Rhetorik beherrsche, dann habe ich eine Grundlage, um auch eine gute Powerpoint-Präsentation zu halten. Stattdessen lernen unsere Kinder, wie man mit Powerpoint bunte, animierte Präsentationen erstellt, aber nicht, wie man vernünftig präsentiert.
Kollegen lassen Schüler Erklärvideos als Klausurersatzleitung erstellen, ohne die Grundlagen zu behandeln: Was gibt es überhaupt für Arten von Erklärvideos? Was sind die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Formen? Ist das die geforderte Anpassung an eine ständig wechselnde Welt oder einfach nur Beliebigkeit?
Auch Kritisches Denken kann man nicht einfach so lernen. Es braucht eine solide Grundlage und Hintergrundwissen, um die einkommenden Aussagen beurteilen zu können.
Wir lernen nicht “Kompetenzen” in einem Vakuum, sondern anhand konkreter Inhalte. Lernen bedeutet eben, ein ausgeprägtes Wissensnetz zu haben, in das ständig neue Inhalte eingefügt werden können.
Gerade wegen einer ständig wechselnden Umwelt ist es doch wichtig, Kindern solide Grundlagen zu vermitteln, anhand derer sie sich später anpassen können.
Die Betonung liegt dabei auf “später”: Kinder sollen und dürfen erstmal Kinder sein, sie brauchen Sicherheit und Stabilität. Unsicherheit und Votalität helfen ihnen nicht, unbeschwert zu starken und gesunden Persönlichkeiten zu werden.
Word und Excel habe ich allerdings auch erst als Studentin gelernt, nicht aber in den Neunzigern in der Schule.
Sehr gute Stellungnahme! Danke!
“Stattdessen lernen unsere Kinder, wie man mit Powerpoint bunte, animierte Präsentationen erstellt, aber nicht, wie man vernünftig präsentiert.”
Das haben Sie völlig richtig erkannt.
Nur: Jetzt fangen Sie mut diesen bösen Sachen an – Rhetirahrick oder so und so Kram, nicht jede Präsentation wäre spitze…
…das hören aber die diversen “Räte”, “Vertretungen” usw. nicht gerne !
Das klingt ja nach…darf man es sagen ? … Arbeit und Lernen. Äh, ich meine natürlich: “psyschische Belastung”, “Stress”, “Bulemielernen”.
…
..
.
Die Sache ist letztlich im Kern eine einfache Frage:
Soll in der Schule gelernt oder betreut/verwahrt/betüddelt werden?
Diese Frage wird ohne “uns” entschieden. Eltern, SuS und (letztlich) die Politik setzen da die Leitplanken.
Unter gegebenen Bedingungen des jetzt real existierenden Systems und dessen diskursiver Schaffung von (Schein)Realität (sowie dessen allergische Reaktion auf richtiges Durchziehen von Stoff oder Fähigkeiten) habe ich als Lehrkraft sehr, sehr viele Anreize, “bunt animierte Präsentationen” mit viel freundlicher “positiver Feedbackkultur” durchrattern zu lassen.
Andersrum dagegen…wie sieht es da mit Anreizen aus?
Rheto-dings?
Biddö watt ? 😀
OHPs in den dritten Stock schleppen, am besten noch Schweissgeruch im frischen Ralph-Lauren-Pulli, den ich mit genau der richtigen, geringen Menge Duftstoff eingesprüht habe morgens ?
Nö. 🙂
Geliefert wie bestellt.
Das ist aber doch “böses” Kompetenzlernen und sollte daher – zumindest gemäß einiger meinungsstarker Foristen – aus der Schule verbannt oder nur peripher vermittelt werden, da Inhalte sehr viel wichtiger sind.
Man muss in der Schule auch nicht Word und Excel lehren, sondern Textverarbeitung und Tabellenkalkulation.
Training auf Produkte kann man schulen, wenn sie zum Einsatz kommen. Es muss nicht das Produkt des Monopolisten sein.
Nein, diese Programme müssen es nicht. Aber wenn die Programme schon auf unseren iPads sind, könnte man sie auch verwenden, gerade weil man sie beruflich sehr wahrscheinlich verwendet…
Worum es mir aber v.a. ging:
Die Programme sind vorinstalliert und die Schüler können nach 2 1/2 Jahren dennoch nicht damut umgehen. Statdessen schreiben sie von Hand mit einem Stift auf den iPads. Sind das die großen digitalen Kompetenzen?
Macht auch Sinn, mit der Hand zu schreiben, so rein lerntheoretisch. Über die Hand ins Gehirn… und haben Sie mal versucht, lange Texte auf dem TABLET zu tippen? Da wird man wahnsinnig, besonders ohne oder mit der Minitastatur. Ergonomisch geht auch anders.
Macht auch Sinn, mit der Hand zu schreiben, so rein lerntheoretisch. Über die Hand ins Gehirn…
Und genau deswegen packen meine Schüler im regulären Unterricht der Sek I auch die iPads weg und schreiben mit einem normalen Stift auf einem Stück Papier. Dann bringt das iPad nämlich keinen Mehrwert.
Witzig dabei: Die Schüler merken selbst, dass sie ohne iPad nicht so abgelenkt sind und sich besser konzentrieren können.
Dennoch finde ich digitale Textverarbeitung für Schüler sinnvoll. Wir nutzen das eher in Wahlpflichtkursen, wenn Texte geschrieben werden müssen, die geteilt werden und gemeinsam verändert werden.
Ich finde nichtmal, dass man iPads nicht auch sinnvoll im Unterricht nutzen könnte, um z.B. mal ein Foto eines Experimentes zu machen, dieses in einem Video festzuhalten oder allgemein dynamische Prozesse im Modell nachzuvollziehen und dies zu filmen. Nur das Schreiben mit einem Stift auf dem digitalen Gerät hat halt keinen Mehrwert und bringt v.a. Ablenkung mit sich.
Die Eltern müssen beim lernen lernen aber mitarbeiten, indem sie das anfertigen der Hausaufgaben kontrollieren. Nicht inhaltlich, aber ob das Kind sie macht.
Hausaufgaben müssen verboten werden, da sie Lernzeit stehlen.
Wieso stehlen sie Lernzeit?
Es gibt Hausaufgaben, die helfen Sicherheit beim Anwenden des Gelernten zu gewinnen und bei den Nacharbeit gibt es nicht wenige, bei denen der Aha-Effekt einsetzt.
Und leider ist es so. Werden Hausaufgaben gegeben, setzen sich Schüler mit den Lerninhalten noch einmal aus einander. Wenn keine Hausaufgaben gegeben werden, wird das Thema für die meißten SuS erst wieder in der nächsten Stunde (mit den ??? In den Augen, was war den in der letzte Stunde noch einmal)
Hausaufgaben nehmen den Schülern Zeit, individuelle Schwächen aufzuarbeiten bzw. Stärken auszubauen, da oft Sachen aufgegeben werden, die keine hohe Priorität für die Schüler haben.
Stimmt, in allererster Linie sind sie Zeitverschwendung.
Vielleicht soll man dann andere Hausaufgaben geben? Damit Kinder das Schulstoff befestigen und in anderen Situationen verwenden können? Braucht man nicht Zeit, um Essay zu schreiben oder eine kleine Recherche zum Thema zu machen? Sind Mathe/Chemie/Physik Aufgaben alle so leicht, dass man da nicht denken soll? Muss man Prozesse in Geschichte/Literatur nicht analysieren? Wann lernt man Fremdsprachen Vokabeln? Wenn man das nicht zu Hause macht, dann wo? Und sind alle Schüler so bewusst, dass sie selbständig ihre Schwäche/Stärke abarbeiten würden? Ich wäre zu faul dafür in der Schule gewesen.
Wenn Sie nur lernen würden
Hausaufgaben sind Lernzeit
Joa! Da fangen die Probleme meist an! Hausaufgaben kontrollieren- auf “erledigt” – von Eltern – ☹️
A never ending story …
Warum sind die ganzen Fachleute eigentlich nicht an den Schulen? Da ist immer nur der schäbige Rest, der ohne jede Ahnung vor sich hinwurschtelt und erleuchtet werden muss.
Schade eigentlich. Ich würde mir solche Experten gerne als Kollegen wünschen.
Mit solchen Wünschen wäre ich gaaaaanz arg vorsichtig.
Und die an einer Schule vereint, damit der begriff “Sonderschule” auch eine sinnvolle Verwendung erhält.
Nein, das wäre super. Ich hätte gaaaanz viel Spaß.
Es ist wie immer, Hauptsache Sie haben Spaß. Und an die armen SuS verschwenden Sie keinerlei Gedanken:)
Doch, die werden dann hochwissenschaftlich und datengestützt beschult. Das kann nur besser werden, als wenn so ein Dino wie ich das macht.
Ganz bestimmt oder?
Auf jeden Fall gäbe es dann einen fairen Wettbewerb bei gleichen Ressourcen und sollten die anderen recht haben, würde ich mich wirklich umstellen.
Ich würde den Experten empfehlen, ihr theoretisches Faktenwissen mal in der Realität zu überprüfen:
“Eine wichtige Grundlage dafür sind sprachliche, mathematische und naturwissenschaftliche Basiskompetenzen, die es (…) ermöglichen, sich selbst weiterzuentwickeln und an stetige Veränderungen anzupassen. Hinzu kommen Kompetenzen wie Anpassungsfähigkeit, Problemlösen, kritisches Denken und Kreativität.“
Nur zu, wir begleiten das gern und evaluieren den Prozess wie die Erfolge.
Ich biete dazu gerne meinen (jetzt) 10er-Grundkurs an.
Das will ich sehen, das ist meine einzige Bedingung. 😀
Man muss halt Aufgaben rechnen, Texte verfassen und Dinge auswendig lernen. All dies für die meisten mit Wiederholungen.
An der Frage wie Digitalisierung und Dekarbonisierung in der Realität zusammenpassen, könnte das Bildungsforum 2025 das lernen lernen.
Faktenwissen allein hat noch nie gereicht, das war auch 1910 schon klar. Aber dass man Fakten wissen muss, um andere Fakten oder KI-Antworten kritisch zu bewerten oder ein Wissensgerüst erstellen zu können, das ist zwar jedem denkenden Menschen klar und wurde in Studien umfassend gezeigt, wird in Lehrer-online-Foren aber immer noch allzu oft ignoriert.
Das Problem ist eher, dass einige Foristen unterschwellig behaupten, Kompetenzlernen solle Faktenwissen ersetzen, um dann gegen ersteres zu argumentieren. Es wird jedoch beides benötigt, allerdings müssen Inhalte und Umfang des tatsächlich erforderlichen Faktenwissens sowie der Kompetenzen laufend anhand der Gegenwart überprüft und an die zukünftigen Entwicklungen angepasst werden. Das von besagten Foristen indirekt gewünschte Verharren in bzw. die Rückkehr zu einer imaginierten Vergangenheit (vor dem “Untergang” der schulischen Bildung) hilft dabei nicht weiter.
Diese Experten sprechen von Veränderung. Warum sprechen sie nicht von Verbesserung? Zum Beispiel, indem man Kindern wieder grundlegende Kompetenzen vermittelt. Man muss Fleiß, Disziplin und Anstrengungsbereitschaft vermitteln – also all die Dinge, die viele Experten immer mehr abschaffen wollen. Soll DAS wirklich der große Wurf sein, auf den das deutsche Bildungssystem seit Jahrzehnten wartet?
Selbst in Deutschland geborene Kinder beherrschen die Sprache immer weniger. Sie wissen, wie man Apps installiert, aber nicht, wie man einen simplen Text versteht. Sie geben sich auch kaum mehr die Mühe, das zu tun. Ich bezweifele, dass man mit den oft genannten Forderungen die Jugend fit auf eine herausfordernde Zukunft macht. Im Gegenteil: Man suggeriert, dass das Eigeninteresse immer die höchste Priorität hat und niemand etwas erwarten darf.
Welcher Experte will denn “Fleiß, Disziplin und Anstrengungsbereitschaft” abschaffen? Herzliche Grüße Die Redaktion
Andererseits: Wie genau soll ich denn solche Dinge einfordern, wenn es nur um das gute Gefühl und den tollen Lernort geht? Natürlich mit den gegebenen Ressourcen im normalen Alltag. Das sagt keiner! Geht ja auch nicht…
Das macht keinen Spaß und ist anstrengend und damit wieder Bulimielernen und Co. Es kommen nur Worthülsen, aber es gibt keine klaren Konzepte dafür. Nur Gespräche, keine Sanktionsmöglichkeiten. Und weil das in der Praxis so ist, kommt es im Forum immer zu solchen Äußerungen.
Ist die Frage echt ernst gemeint?
Ich saaach mal, als Versuch einer ernsthaften Antwort:
Das sind all die “Experten”, die Hausaufgaben und Noten abschaffen wollen!
Da ist Ihre Interpretation. Denjenigen, die Hausaufgaben durch Förderung in der Schule und Noten durch präzise Rückmeldungen ersetzen wollen (diese Details sollten Sie nicht unterschlagen) – geht es nach eigenem Bekunden um mehr Leistung. Angesichts der eher dürftigen Bilanz des tradierten deutschen Bildungssystems ist das auch nicht ganz abwegig.
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Und dennoch sehen wir, wie die Schüler all dieser Reformbewegungen zum Trotz immer unselbstständiger werden und immer weniger Leistungsmotivation zeigen.
Weil es womöglich gegenläufige Entwicklungen gibt? Uns fällt da eine ganze Menge ein – das hier zum Beispiel: https://www.news4teachers.de/2025/09/studie-zwei-drittel-der-eltern-wollen-beste-freunde-ihrer-kinder-sein-wie-geht-das-mit-dem-leistungsanspruch-der-schule-zusammen/
Herzliche Grüße
Die Redaktion
… und wie soll Schule mi diesen gegenläufigen Entwicklungen umgehen? Welche Vorschläge hätten Sie da?
Einige. Hier findet sich davon einiges (und erklärt übrigens auch, warum offene Lernformen und Basiskompetenzen kein Widerspruch sind, im Gegenteil): https://www.news4teachers.de/2022/09/schule-der-zukunft-die-basiskompetenzen-gewinnen-sehr-stark-an-bedeutung-ein-interview-zum-deeper-learning/
Herzliche Grüße
Die Redaktion
Interessanter Artikel1 Allerdings habe ich mir auch die Mühe gemacht, die damaligen Kommentare dazu zu lesen. Hmmm…. vor 3 Jahren ähnliche kommentare wie heute. was hat sich bisher geändert an Rahmenbedingungen, bei Schülern,…?
Impliziert Ihr “wir” also Kolleg*innen sowie “die” Schüler*innen aus “all diesen Reformbewegungen”, denen es nichtdestotrotz auch weiterhin gelingt, selbstständig und motiviert zu arbeiten ? Sehe ich nicht so .
Keine Sorge, ich nehme an, dass die Experten für Bildungsökonomik nichts gegen „Fleiß, Disziplin und Anstrengungsbereitschaft“ einzuwenden haben. Die Anforderungen der Wirtschaft und des Arbeitsmarkts gehen bei dem weltweiten Konkurrenzdruck nur noch weiter. Zum Glück muss ich als Lehrer und Pädagoge diese Realität im Sinne meiner Schüler natürlich im Blick beachten, aber (darf) mich nicht auf diese Perspektive beschränken.
Ich habe den Artikel zunächst wegen der Überschrift („Faktenwissen reicht nicht“) in der gleichen Schiene wie z.B. die Forderungen von Schüler- und Elternvertretern (Bulemie-Lernen und so) vermutet, aber eigentlich sagt er über schulische Veränderungen nur aus, dass es mehr „Freiräume und Unterstützung“ geben soll. Gerne!
Es ist also nicht die Rede von bestimmten „zeitgemäßen“ pädagogischen Konzepten und Ideen, die sich allerdings gerne auf ihre Fahnen schreiben, all die Belange und Kompetenz, die in der Stellungnahme als ökonomische Notwendigkeiten aufgezählt werden, erfüllen und fördern zu können.
Es wird also weder ein Aussetzen von Noten noch ein Abschaffen der Hausaufgaben oder Ähnliches gefordert.
“Basiskompetenzen”. Ich kann es nicht mehr hören. Denn was diese sind und wie sie zu vermitteln sind, das bleibt so schön vage. Vor allem, wenn man diese bitte ohne das böse Faktenwissen vermitteln soll. Natürlich kann ich ganz leicht die 16 Bundesländer googeln. Um mal so ein Beispiel für so ein doofes Faktenwissen zu nennen. Aber warum sollte jemand, der nicht weiß, dass Thüringen ein Teil der BRD ist die 16 Bundesländer googeln, wenn er in den Nachrichten eine Meldung aus Thüringen hört? Ohne das doofe Faktenwissen ist man gar nicht in der Lage, an der Informationsgesellschaft teilzuhaben.
Wo steht denn geschrieben, dass nur noch Kompetenzen ohne Faktenwissen vermittelt werden sollen? Es wird aber die Dominanz reinen Faktenwissens ohne Bezug zur Lebensrealität in Frage gestellt.
Natürlich sollte man die 16 Bundesländer kennen und auch noch ihre Landeshauptstädte. Aber wie sieht es mit allen Ministerprasidenten bzw. Regierenden Bürgermeistern sowie deren Stellvertreter aus? Oder den jeweils höchsten Bergen und längsten Flüssen der Bundesländer, den Regierungsdaten aller deutschen und römischen Kaiser, die Orte und Daten der wichtigsten Schlachten im Dreißigjährigen Krieg und der Napoleonischen Kriege.
Dieses Faktenwissen musste bis in die 80er Jahre noch gelernt werden (zumindest von mir als Schüler an meiner Schule).
Welches Faktenwissen wirklich hilfreich bzw. erforderlich ist, sollte mMn immer wieder hinterfragt und angepasst werden. Eine Abschaffung – wie einige Foristen gerne suggerieren – ist damit aber keinesfalls gemeint. Vielmehr scheinen diese Probleme mit dem Vermitteln von Kompetenz zu haben. Reiner Faktenunterricht ist dagegen so viel einfacher, v.a. wenn man die Inhalte nicht an eine sich verändernde Gegenwart und Zukunft anpassen muss. Denn früher war bekanntlich alles besser.
Es geht doch nicht darum, dass man gar keine Fakten mehr wissen oder lernen soll. Ist es wichtig zu wissen, dass Haydn die Kaiserhymne im Jahr 1797 aufführte? Oder ist es nicht viel mehr wichtig zu wissen, dass die Melodie der Kaiserhymne der Melodie unserer Nationalhymne entspricht? Die Kinder können die Jahreszahl auswendig lernen, aber nach dem Test weiß es doch kein Mensch mehr. Und das ist doch genau damit gemeint. Viel spannender wäre allerdings je nach Alter der Kinder, in welchen zeitlichen Kontext das stattfand und man eine Vernetzung herstellt zu anderen Ereignissen oder berühmten Persönlichkeiten. Die Frage: Kannten Haydn und Mozart sich? wäre demnach viel spannender als jede Jahreszahl auswendig zu lernen. Aber genau das wird ja immer gemacht: Wann wurde wer geboren, wann ist er gestorben, etc.? Zu hinterfragen ob das immer so sinnvoll ist, darum geht es.
Für die Fraktion “Inhalte sind viel wichtiger als Kompetenzen” hat die Jahreszahl bereits einen Wert an sich. Und eine Vernetzung von Fakten würde sich ganz automatisch ergeben, wenn die Schülerhirne mit genug Inhalten geflutet werden.
Außerdem lassen sich Noten doch viel besser geben und begründen, wenn diese auf der Messung operationalisierten Wissens beruhen. Und diese unwichtigen Soft Skills wie Kompetenzen lassen sich zudem besser in die Kopfnoten auslagern.
Dafür wäre es aber schon wichtig zu wissen, dass Haydn die Hymne “Ende des 18. Jahrhunderts, ein paar Jahre nach der Französischen Revolution” aufgeführt hat. Und – bumms – da isses wieder, das pöhse Faktenwissen.
Ich weiß nicht unter welchem Stein die forschen, aber als ich vor 10 Jahren Lehrer war, stand sowas sogar schon in den Lehrplänen drin. In den Lehrplänen!
Aber ohne ein paar fachliche Grundlagen geht es nun mal auch nicht. Wie soll man denn sonst “lernen lernen” ohne zu lernen…
Ich glaube, da musste jemand noch dringend eine Veröffentlichung abgeben und es wurde am Ende nur eine PM.
Forscher sollten forschen lernen; blöd daherreden reicht nicht mehr.
Gut, dass es so geistreiche Kommentare gibt, die Wissenschaftler*innen mal so richtig zeigen, wie Wissenschaft geht (Spaß). Herzliche Grüße Die Redaktion
Das ist eine Frage der Perspektive:
Für durchaus ordentlich dotierte Stellen mit Arbeitszeiterfassung im sicheren, klimatisierten Hinterland reicht das durchaus.
Alle im Artikel genannten Forscher und Experten sind Wirtschaftswissenschaftler. Da ist kein einziger befähigt, sich über pädagogische und didaktische Erkenntnisse zu äußern.
Gerade weil man sich in den letzten 25 Jahren konsequent auf solche fragwürdigen Ratgeber verlassen und das humboldt’sche Bildungsideal dabei über Bord geworfen hat, während die tatsächlichen Experten, die Tag für Tag mit den Schülern arbeiten, durchgehend ignoriert werden, fährt unser Bildungssystem mit Vollgas vor die Wand.
Dazu kommt erschwerend, dass die Schule alles ausbügeln soll, was gesellschaftspolitisch in den letzten Jahren verbockt worden ist.
Dinge, die trotz aller Schulreformen weitaus größeren Einfluss auf die Entwicklung junger Menschen haben, sind Familie, Peergroups und Medien. Die wollen ihre Verntwortung alle gern ausblenden.
Die öffentlich-rechtlichen Medien erreichen junge Menschen kaum und leider auch selten mit klugen Inhalten. Für die “freien” Medien gibt es kaum Auflagen. Die senden die gesamte Nation seit den 1990ern ins intellektuelle Vakuum. Soziale Netzwerke und Algorhythmen, die einseitige Wrltanschauungen geradezu forcieren und den Dümmsten und Lautesten die größtmögliche Bühne bereitstellen, entwerten wissenschaftlich rationale Denkweisen zugunsten aufgeblasener Halbwahrheiten und spaltender Ideologien und Mythen. Vom Umgangston will ich da gar nicht erst anfangen.
Familien haben immer weniger Zeit für ihre Kinder und gehen in der verbleibenden Zeit jedem Konflikt aus dem Weg. Sie meinen es gut, wollen das Beste, nehmen ihrem Nachwuchs aber jede Anstrengung, jede Frustration und jede Bewährungsprobe ab und erziehen sie damit zur Unselbstständigkeit und ersticken echte Kreativität, die Entwicklung von Problemlösungsstrategien und eigene Phantasie schon im Keim. Außerdem wird ständiger Konsum als Heilversprechen vermittelt. Anstrengungsbereitschaft, Leistungswille und Ehrgeiz waren gestern.
Peergroups verstärken dann noch die medial erlebte Einseitigkeit, wenn verschiedene gesellschaftliche Schichten gern unter sich bleiben. Wenn ein Kind mit Migrationshintergrund nahezu ausschließlich unter anderen Migrantenkindern und eher bildungsferneren Familien aufwächst, hört es jeden Tag einen defizitären Sprachgebrauch, erhält weniger Zugang zu privaten Bildungsmöglichkeiten und wird Bildung unter Umständen nicht als etwas Wichtiges begreifen. Diese Kinder gehen alle an dieselbe Schule, während die Kinder reicherer, gebildeterer Familien mit ganz anderen Ressourcen am anderen Ende derselben Stadt in Bullerbü unterrichtet werden. Diese Strukturen müssten vor allen anderen aufgebrochen werden.
Solang in diesen Bereichen kein Umdenken einsetzt, kann man die Schule im wahrsten Sinne dumm und dämlich reformieren und die ganzheitliche Bildung – die nunmal Wissen voraussetzt, das zuerst einmal gelehrt und gelernt werden muss – aufgrund der Träumereien und dem Geschwätz irgendwelcher Wirtschaftslobbyisten dem Ziel opfern, dass Reiche reicher werden und Arme arm bleiben. Diese Richtung hat man gemeinsam mit der Schröder-Regierung beschlossen und eingeschlagen und seit wann funktioniert es bei ubs mit der Bildung nicht mehr. Ach ja! Genau so lang!
Welches Faktenwissen?
Ich meine, wir haben es geschafft in den meisten Schulen die Kreide abzuschaffen. Das ist doch ein epochaler Fortschritt. Da kann sich so schnell nicht um inhaltliche Aspekte gekümmert werden. Wir wollen schließlich nichts überstürzen.
Kurse wie “Lernen lernen” sind ineffektiv. Man muss es an konkreten Inhalten machen.
Zitat:
“Methodentraining […] illustriert die Implementierung von schulischen Reformen, die sich als ineffektiv herausgestellt haben. Diese Reform zielte darauf ab, den Unterrichtsschwerpunkt von der Vermittlung von Inhalten auf die Vermittlung von Methoden zu verlagern[…]. Schülerinnen und Schüler sollten generische Kompetenzen erwerben, die unabhängig von spezifischen Fächern anwendbar sind. Trotz der weitreichenden Einführung und der Implementierung in den Lehrplänen wurde das Konzept des Methodentrainings weitgehend als wenig zielführend bewertet.”
Aus dem Buch: Weniger macht Schule” das auf dieser Plattform auch schon vorgestellt wurde.