GÖTTINGEN. Die staatlich angeordneten Maßnahmen zum Schutz vor dem Covid-19-Virus betrafen den Bildungsbereich stark. Nicht nur Kinder und Jugendliche waren starken Belastungen ausgesetzt, auch die Lehrtätigkeit an Schulen erfuhr massive Einschränkungen. Wie blicken Lehrkräfte aus heutiger Perspektive zurück auf die pandemische Zeit zwischen 2020 und 2022? Welche langfristigen Folgen hinterlässt die Krise für die Arbeit von Lehrkräften? Ein Forschungsprojekt der Uni Göttingen ist diesen Fragen nachgegangen – und hat nun ein Impulspapier veröffentlicht, das auf der Grundlage von Tiefeninterviews mit Lehrkräften entstanden ist.

„Einig zeigen sich alle Befragten darin, dass die größten Auswirkungen der Pandemie auf die Schülerschaft auf der sozialen und psychischen Ebene liegen“, so heißt es in dem Impulspapier. „Während in den höheren Jahrgängen psychische Krankheiten wie Depressionen und Angststörungen von den Schüler:innen selbst teilweise viel konkreter thematisiert würden, zeigen sich die jüngeren Jahrgänge im Verhalten auffällig.“
Es gibt den Lehrkräften zufolge merklich mehr Schüler:innen, „die soziale Schwierigkeiten haben oder in gewissen Situationen anstrengender, schwieriger reagieren, als es vielleicht früher der all gewesen ist“. Die fehlenden Möglichkeiten junger Menschen, sich im Lockdown von der Kernfamilie zu lösen und eigene Erfahrungen zu machen, würden teilweise extremer nachgeholt. „Weiterhin hätten gerade die Jahrgänge, welche die Pandemie in ihrer Grundschulzeit erlebten, teilweise Schwierigkeiten, sich in den großen Klassen der weiterführenden Schule einzufinden. Die jungen Schüler:innen werden als ‚verhaltensoriginell‘ mit einem starken Fokus auf sich selbst beschrieben, die Schwierigkeiten aufweisen, sich in großen Gruppen zurecht zu finden“, so schreiben die Autor*innen.
Und: „Insgesamt stellen die sozial-psychologischen Auswirkungen eine bedenkliche Entwicklung dar. In den Interviews wird zugleich ein hohes Engagement der Lehrkräfte deutlich, für ihre Schüler:innen ansprechbar zu sein und sie in ihren Problemen und Entwicklung zu unterstützen. Dieses Engagement läuft aber Gefahr, durch herausfordernde Arbeitsbedingungen, Belastungen und dem Lehrkräftemangel begrenzt zu werden, was die Beziehungsarbeit mit den Schüler:innen erschwert.“
Sichtbarste Auswirkung der Pandemie auf den Arbeitsalltag der Lehrkräfte ist allerdings die beschleunigte Digitalisierung. „Auch, wenn eine zunehmend digital funktionierende Schule schon vor der Pandemie als eine erklärte Zielgröße galt, wurde wegen der Notwendigkeit, die Interaktion mit den Schüler:innen über die Distanz zu ermöglichen, dem digitalen Ausbau ein starker Schub verliehen.“ Der allerdings weist Tücken auf: „Oftmals könne vorhandene Hardware nicht im Unterricht genutzt werden, weil die notwendige Software nicht installiert sei und technisches Personal fehle, um dies umzusetzen oder zu betreuen“, so heißt es. So könne eine Schule im Sample ihre bereitgestellten Tablets bislang nicht nutzen, weil die personelle Ressourcen fehlten, die Geräte für den Unterricht einzurichten.
„Dennoch geben alle Lehrkräfte im Sample an, Möglichkeiten der digitalen Unterrichtsvorbereitung, Lernplattformen und digitale Tafeln seit der Pandemie zu nutzen und dies als positiv und arbeitserleichternd zu empfinden“, so heißt es.
„Was allerdings durchweg überaus positiv bewertet wird, sind zunehmende digitale Elemente auf der organisatorischen Ebene des Schullebens“
Uneinig sind sich die interviewten Lehrkräfte laut Bericht bei der Bewertung, ob die Tablets im Unterricht überhaupt einen positiven Beitrag liefern. „Einige der Befragten heben deren Möglichkeiten eines abwechslungsreichen und auf individuelle Bedarfe angepassten Unterrichts hervor. Andere sehen die Endgeräte vorrangig für Recherchezwecke als hilfreich an. Darüber hinaus halten sie es für unabdingbar, Schüler:innen mit Stift und Papier arbeiten zu lassen, was mit deren ohnehin hoher Mediennutzung im Alltag begründet wird.”
Eine Lehrerin der Schule, die vollständig Tablets eingeführt hat, gibt dem Bericht zufolge sogar an, bei den unteren Jahrgängen wieder von der Nutzung abzurücken. Sie erklärt dies damit, „weil ich, wenn der Unterricht komplett digital ist, dadurch den Kontakt zu meinen Schülern verliere, die verschwinden förmlich hinter diesem Gerät“. Zudem falle es ihr schwer, die Schülerinnen und Schüler in der Unterrichtsstunde bei der Aufgabenbearbeitung auf dem Tablet zu unterstützen. Fortschritte und Lernerfolge seien auf den Bildschirmen ebenfalls schwerer als auf Papier erkennbar, weshalb der Leistungsstand der Kinder schwerer einzuordnen sei.
„Was allerdings durchweg überaus positiv bewertet wird, sind zunehmende digitale Elemente auf der organisatorischen Ebene des Schullebens. Vorrangig bei den betrachteten Gymnasien wurden im Zuge der Pandemie Klassenbücher digitalisiert. Noten können fortan online eingetragen werden und Informationen über Termine oder Klassenaktivitäten nun statt im Mitteilungsbuch im Lehrerzimmer über das digitale Schulsystem verwaltet werden. Damit würden Prozesse verschlankt und die Informationsbeschaffung vereinfacht, was für die Lehrkräfte eine Arbeitserleichterung darstelle“, schreiben die Autor*innen.
Eine weitere Veränderung des beruflichen Alltags von Lehrkräften durch die Pandemie betrifft die Kommunikation im Kollegium. „Durch die Verlagerung in digitale Systeme bemerken die Befragten veränderte Formen der Zusammenarbeit unter den Lehrkräften.“ Üblicherweise zeichne sich die Lehrtätigkeit durch eine hohe Autonomie in der Unterrichtsgestaltung aus, so heißt es im Bericht. Da die Kooperation zwischen Lehrkräften oftmals in der Schulorganisation nicht strukturell verankert sei, bedeute diese häufig einen Mehraufwand, weshalb viele Lehrkräfte als „Einzelkämpfer“ vor ihren Klassen stünden – so habe es ein befragter Lehrer formuliert.
„Dies scheint sich im Rahmen der Pandemie und im Zuwachs digitaler Kommunikationsmöglichkeiten zu verändern“, heißt es nun. Über schulinterne Messengerdienste sei die Kooperation zwischen den Lehrkräften etwas gestiegen, wie manche Befragte berichten, da der Austausch über die Klassen und die Informationsweitergabe niedrigschwelliger sei. Teilweise würden die Cloudsysteme zur Lernorganisation unter den Lehrkräften auch für den Austausch von Unterrichtsmaterialien genutzt.
„Heutzutage nimmst du es einfach aus der Cloud und fragst im Prinzip gar nicht mehr. Da haben wir eine sehr offene und neue Kultur des Kooperierens“, erklärte ein Befragter in Bezug auf die gesunkene Hemmschwelle, Materialien von Kolleginnen und Kollegen zu nutzen. „Hier zeichnen sich Potenziale der Arbeitserleichterung ab, wenn die Kooperation und Unterstützung unter den Lehrkräften durch technische Möglichkeiten vereinfacht wird.“ News4teachers
Hier geht es zum vollständigen Impulspapier.



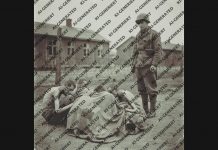






Nun, die Veränderung des Arbeitsplatzes, Digitalisierung, etc. ist nichts Neues für Lehrer. Deren Arbeit ist ist einen ständigen Wandel unterlegen.
Was sich wirklich durch Corona verändert hat ist die Erkenntnis, dass Lehrer quasi Verbrauchsmaterial sind.
Jederzeit opferbar für die Bequemlichkeit der Eltern. Wenn Eltern sich um ihre Kinder kümmern müssen, werden die Kinder dumm, faul und dick. Lehrer aber sind selbstverständlich Verfügungsmasse, die mit richtigem Lüften von jeglicher Ansteckung verschont bleiben.
Bis heute wird bei Lehrern Corona nur unter extremsten Bedingungen als Dienstunfall anerkannt. Komisch, alle stecken sich in engen Räumen mit vielen Leuten an, nur Lehrer nicht.
Liebe Gesellschaft, wenn ihr nicht endlich begreift, dass Lehrer sehr leidensfähige, aber irgendwann auch mit Grenzen behaftete Menschen, sprich MENSCHEN sind,
wird der Lehermangel fortschreiten
und eure Kinder von unqualifizierten Möchte-Gern-Lehrer-kann-doch jeder-Leuten unterrichtet, sorry, betreut, werden.
PISA lässt grüßen!
Volle Zustimmung. Die beschriebenen Tendenzen mach(t)en Lehrer als Verbrauchsmaterial immer leerer. Die zunehmende (politisch gewollte) Abkehr von “Leistung” und “Anstrengung” tut das Übrige.
Viele qualifizierte Exemplare der Gattung Homo konservativus frontalis oldschoolensis zeigen massive Fluchttendenzen aus diesem (Un)bildungssystem oder werden auch zunehmend unbequem.
Möchte-Gern-Lehrer können dann beweisen, ob “kann-doch jeder” realistisch ist.
Viel Spaß! Der wird doch ganz groß geschrieben.
Ich kenne auch Kinder aus ” guten ” Elternhäusern, die alle ein wenig einen Knacks bekommen haben. Während für mich beispielsweise zwei Coronajahre 3, 33 Prozent meines Lebens waren, sind es bei einem Achtjährigen bereits 25 Prozent. Das prägt.
Für Erstsemester an Universitäten und Wechsler in die Sekundarstufe hat es lange gedauert, bis sie ihre Universität oder ihre Schule überhaupt richtig kennen lernen konnten.
Wir reden mehr über die Auffälligen und schlechten Schüler, doch sozialer Rückzug, Depressionen und Ängste spielen bei Kindern und Jugendlichen selbst bei weiterhin stabilen Leistungen eine neue Rolle. Noch nie nach dem zweiten Weltkrieg war eine Generation so unglücklich.
Corona hat sicherlich eine Rolle gespielt – aber die Entwicklungen waren schon lange absehbar.
Corona hat es aus meiner Sicht nur insofern “schlimmer” gemacht, weil vermittelt wurde, dass Lehrer/Schulen Verfügungsmasse sind.
Für einige Kinder (und deren Eltern) bedeutet das offenbar: Lehrer kann eh nichts, ist faul, hat nichts für uns getan (wobei keiner weiß, wie diese Eltern hätten zufriedengestellt werden können…) und hat jetzt bitte schön seine Dienstleistung übers Maß hinaus zu erfüllen…
Die immer schon “verhaltenskreativen” und schwer erreichbaren Schüler haben dazugelernt, es haben sich auch unter dem Einfluss des Ausnahmezustandes während Corona Muster verstärkt, die im “alten” System Schule kaum mehr zu handhaben sind.
Meine persönliche Meinung: Einige dieser Kinder brauchen alles – nur nicht Schule. ihnen täte ein ganz anderes System besser als das, was sie erwarten. Nein, nicht der “intesnivpädagogische Segeltörn” oder sonstige kurzlebige Projekte, sondern eine intensive Anbindung in ihrem Umfeld, praktische Erfahrungen, sich ausprobieren, Raum und Zeit für sich selbst, verschiedene und sichere Bezugspersonen – sie brauchen nicht in erster Linie einen durchorganisierten, von solchen Kindern nicht aushaltbaren Schulalltag!
Eltern fordern, Schule soll es jetzt richten. Diese Eltern gab es immer – nur konnten sie nicht alle Schuld auf Corona und damit auf die Schulen schieben, die ja geschlossen waren (was so ja nicht einmal stimmt – Notbetreuung gab es immer) und deren Lehrer immer nur gechillt haben.
Auf viele Kollegen wirkt Corona wie ein Brennglas auf die Absurditäten des Lehrerlebens. Alle Entwicklungen haben sich beschleunigt, verstärkt, sind ins Absurde abgeglitten (Arbeiten bei 5 Grad und Durchzug oder bei 35 Grad und Windstille, Digitalisierung um der Digitalisierung willen, Unterricht in 30-facher Binnendifferenzierung, weil die Kids ja so gelitten haben…).
Aus meiner Sicht war die Schließung der Schulen zum damaligen Zeitpunkt unabdingbar. Man wusste zu wenig. Wie groß wäre der Aufschrei geworden, wenn Kinder oder im Umfeld die Großeltern verstorben wären?
Hinterher kann jeder behaupten, es sei nicht notwendig gewesen. Präventionsparadoxon.
Wo lag also der Fehler?
Ein Fehler lag darin, den Eltern/Kindern, der Gesellschaft vermittelt zu haben, dass Schulen unter allen Umständen offen gehalten werden können! Es WAR unzumutbar – für Schüler wie Lehrer – dass wir unter solchen Bedingungen arbeiten mussten.
Ein weiterer Fehler lag darin zu vermitteln, dass “digital” alles richten kann. Kann es nicht, Kinder müssen erst lesen, schreiben, rechnen und DENKEN lernen.
Fehler war auch, dass einige Eltern aus den Gegebenheiten schließen: die Schule ist wieder auf, also sollen sich die Lehrer kümmern. Eltern ziehen sich jetzt gerne hinter die Diagnose “Coronaschaden” zurück (wie früher hinter “LRS” oder “ADHS”… kann er/sie nicht, muss er/sie nicht…ich als Mutter/Vater kann eh nichts machen – muss daher auch nichts machen…).
Fehler weiterhin: Man hat der Gesellschaft vermittelt, Kinder könnten nur mit Schule leben. Komisch – in den Ferien können sie durchaus ohne, und die Ferien verlängern viele Eltern gerne noch durch “Krankheit”…
Wenn Lehrer und Schule alles richten kann/soll, was im Elternhaus offenbar nicht zu leisten ist (Erziehung und so unangenehme Sachen…), warum lässt man uns dann nicht machen? Warum wird jede pädagogische Maßnahme hinterfragt, untergraben, mit dem Anwalt gedroht? Die Eltern scheinen eben doch zu glauben, keiner könne mit ihren Kindern richtig umgehen. Aber es ist ja auch nicht Corona, da gehen sie einem nicht den ganzen Tag in ihrer umfassenden Verhaltenskreativität auf den Senkel. Abends zwischen sechs und acht kann man schon mal den Beschützer der Kinder rauskehren und die Lehrer fertig machen.
Die Kinder selbst sind dann fertig von einem (oftmals) Zehnstundentag, nicht mehr ansprechbar, flegmatisch, müde, nur noch zum Daddeln oder Abhängen aufgelegt, alternativ überdreht, aggressiv und genervt, sodass sie in diesem Zustand oftmals nicht mehr objektiv berichten, sondern – wie in der Schule auch – ihre äußerst selektive Wahrnehmung der Dinge und Vorfälle äußern, um Lehrer/Eltern schnell los zu werden. Die Kinder wissen, wer was wie wissen will!
Diese Kinder manipulieren vielleicht nicht absichtlich, wissen aber sehr wohl, wie sie ihre Ziele erreichen. Das ist normal. Normal ist nicht, wenn Erwachsene nichts hinterfragen, unkritisch gegen Schule vorgehen.
Echte Kommunikation findet hier nicht mehr statt. Aus Selbstschutz, weil die Systeme übergreifend überreizt sind, das gilt für die Schule wie auch für Arbeitswelt der Eltern.
Kommunikation digital ist für Lehrer vielleicht einfacher geworden; für alle anderen aber auch. Schnell mal eine Mail an die Schulleitung raushauen und schon bekommt der ungebliebte Mathe-Lehrer den Ärger, den der Sohn/die Tochter ihm schon angedroht hat. Ein immer verfübgares Kommunikationsmittel mit immer verfügbaren Mailadressen oder Telefonnummern lässt keinen Raum mehr für Nachdenken oder Reflektieren – “man” reagiert nur noch aus dem Effekt, lässt sich nicht die Zeit “drüber zu schlafen”, macht im Affekt “Nägel mit Köpfen” – man fühlt sich mächtig, hat Einfluss, lässt sich nichts gefallen.
Schulleitungen und Lehrer können sich davor kaum mehr innerlich distanzieren, weil es ständig und überall ins Private eingreift.
Nein, das ist nicht immer so.
Natürlich nicht.
Viele Eltern kooperieren, sind rücksichtsvoll, kommunizieren angemessen, hinterfragen auch, bevor sie handeln.
Leider steigt jedoch der Anteil derer, die uns das Lehrerdasein verleiden, nach meiner Einschätzung seit Corona nochmal exorbitant und diese Leute greifen zu immer übergriffigeren Mitteln, um ihre Ziele zu erreichen.
Ihre Kinder sind für uns oftmals überhaupt nicht mehr erreichbar.
Wie viele Lehrer haben noch echte Berufszufriedenheit?
Die wäre soooo wichtig, um gute Arbeit zu leisten.
Eltern haben ihren Anteil daran, die KM aber noch mehr, weil sie nicht hinter uns stehen.
Also werden viele den Job gar nicht mehr ergreifen, andere ihn verlassen, einige bis zum bitteren Ende irgendwie aushalten.
Nicht pädagogisch vorgebildete “Ersatz-Lehrer” müssen nicht schlecht sein (wer von uns ist wirklich anfangs angemessen pädagogisch ausgebildet gewesen?)!
Ohne pädagogische Ideen, oder zumindest eine Vorstellung davon, wie Unterricht und Lernbeziehungen funktionieren können, wie Lernen Erfolg haben kann, wird Schule aber nicht gehen. Wenn nicht mehr genug “Altlehrer” da sind oder neben ihrer eigenen Arbeit nicht mehr die Kraft haben, neue Kollegen auszubilden, wird das nichts mehr werden.
Die Spirale wird sich weiter in den Abgrund drehen.
Die “Corona”-Erfahrung hätte uns auch lehren können, dass man nicht alles auf eine Karte, alles auf Schule setzen darf, dass jedes Kind ein sicheres Umfeld auch außerhalb der Institutionen braucht.
Um ein Kind zu erziehen braucht es eben am Ende doch ein ganzes Dorf!
Beispiele? Zeit, um bei Mama/Papa/Oma/Opa am Nachmittag mit in den Job zu gehen; Zeit für die Katze/den Hund/den Garten; Zeit und nette Menschen im Umfeld, im Sportverein oder auf dem Bolzplatz, im benachbarten Pferdestall, die kuchenbackende “Oma” in der Nachbarschaft; jemanden, der das Kind begleitet, wenn es “Langeweile” aushalten und daraus Kreativität entwickeln lernt…
Sie sprechen mir aus der Seele! Danke!
Die Kinder und Jugendlichen haben sicherlich auch sehr stark darunter gelitten, dass ihr notgedrungenes Zuhause-Sein für alle zum größten Problem geworden war.
Die Eltern mussten betreuen, Homeoffice und Homeschooling unter einen Hut bringen und gleichzeitig auf das seelische Wohlbefinden ihrer Kinder achten. Der letzte Punkt ist dabei häufig verloren gegangen, dafür waren irgendwann die Nerven zu blank. Kinder ab Kita-Alter hörten auch sehr häufig die entnervten Klagen der Eltern direkt mit: hoffentlich ist bald wieder Schule und Kita! Das bedeutete für die Kinder ganz einfach: es ist eine schwierige Zeit mit einer schlimmen Krankheit und ich sollte jetzt NICHT zu Hause sein. Ich bin hier zuviel und das größte Problem.
So eine direkte oder unterschwellige Botschaft in einer Notsituation über Wochen wird jeden Menschen zutiefst verstören und verletzen und ganz besonders Kinder.
Was ich in der Zeit, als ich noch aktiv als Tagesmutter arbeitete, an vor Kinderohren ausgesprochenen „Stoßseufzern“ und auch längeren Schimpftiraden gehört und gelesen habe, hat mich schockiert.
Ich ahnte damals schon, dass die Kinder genau deshalb Traumata mitnehmen würden. Eine Gesellschaft, die von der Kernfamilie bis in die Bundespolitik die Kinder selbst in Notsituationen in einer Betreuung außer Haus sehen möchte, gibt den Kindern und Jugendlichen eben nicht den seelischen und sozialen Rückhalt, der notwendig gewesen wäre.
Natürlich wird das jetzt zu Kommentaren führen wie „aber die Eltern mussten doch arbeiten…“. Ja, mussten sie. Und viele wollten auch und zwar auch ohne Systemrelevanz. Es wurde auch überdeutlich, dass eine überwältigende Anzahl Eltern mit der ganztägigen Erziehung und liebevollen Betreuung U3 völlig überfordert waren.
Die Frage war, wie sehr die Kinder und Jugendlichen unter der Pandemie gelitten haben. Da sehe ich genau diesen Punkt ganz oben auf der Liste.
Sehe ich genauso!
“Die Eltern müssen doch arbeiten…” ja – die Gesellschaft will es so und die Eltern können leider tatsächlich mit ihren Kindern oft nichts anfangen, entfliehen der Verantwortung gerne, indem sie die Kinder anderweitig unterbringen.
Aber mal ehrlich:
Könnte Arbeit nicht auch anders aussehen?
Könnte Arbeit nicht effektiver sein? Geht wirklich Quantität vor Qualität?
Muss jeder sich alles leisten können? (Nicht alles, wofür Geld ausgegeben wird, macht nachhaltig Sinn… wenn wir weiterhin gut leben wollen, müssen wir unsere Lebensgewohnheiten ändern!)
Müssten so viele Menschen in prekären Situationen leben, wenn Ausbildung besser wäre?
Könnten nicht alle/mehr Menschen gut/ausreichend verdienen, wenn nicht wenige “exorbitant” (an ihnen) verdienten?
Müssen Mütter/Väter wiurklich bis zum Burnout arbeiten (müssen)? (Nein, ich bin nicht für Frauen am Herd! Ganz sicher nicht! Aber wer sein Kind in den ersten Jahren ganz/mehr zu Hause lässt, darf auch nicht schief angesehen werden! Wir leben im 21. Jahrhundert!)
Wollen wir weiter Schulabsolventen ohne Berufsfähigkeit, weil wir Quantität (Ganztagsbetreuung) vor Qualität (kompakt, konzentriert und menschenwürdig lernen) setzen?
Wenn Eltern und alle anderen Personen rund um ein Kind willens und in der Lage sein sollen, Kindern Bindung, Sicherheit und “Gewünscht sein”, aber auch Zuversicht und den Glauben, das Leben gemeinsam stemmen zu können, zu vermitteln, dann müssen wir alle daran mitwirken.
Lehrer brauchen mehr Zeit für Beziehung und effektive Bildung.
Eltern brauchen mehr Zeit für “einfach miteinander sein”,
Kinder brauchen mehr Zeit für sich selbst, um eigene Interessen, Fähigkeiten und Perspektiven zu entwickeln – auch ohne Kita, Schule, Eltern, Freizeitplanung.
Wenn das soziale Netz stimmt, trägt es auch in einer Notsituation.
Wir haben kein Anrecht auf Leben ohne Ausnahmezustand.
Erstes Ziel von Erziehung und Bildung müsste aus meiner Sicht “Resilienz” sein – ein hiochtrabendes Wort, wenn man an Kinder denkt.
Kinder müssten einfach immer und überall erfahren, mit schwierigen Situationen zurecht kommen zu können, kreativ sein zu können, ihre Phantasie nutzen zu können, sich umzusehen, verschiedene Lebensmodelle zu entdecken, offen und neugierig zu sein. Das ist die Voraussetzung, auch in ungewohnten Situationen keinen Schaden zu nehmen.
Man hätte aus der Pandemie auch ein gemeinsames “Abenteuer” machen können, aus dem alle gestärkt hervorgegangen wären. Ich bin sicher, dass für die Familien, die dies nicht selbst leisten konnten, ausreichend Kapazität vorhanden gewesen wäre, dies mit aufzufangen.
Manche Familien haben das vorbildlich gemacht, haben sich mit Nachbarn zusammengetan, haben gemeinsame Projekte gestartet, die Dinge genommen wie sie waren, vor allem nicht vor den Kindern Schuld verteilt oder Ablehnung signalisiert – diese Kinder haben die Zeit ohne Schule genießen können und haben sich trotzdem hinterher wieder auf die Schule gefreut.
Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Ich hatte übrigens das Glück, dass meine damals fünf Tageskinder genau solche Familien hatten, die sich liebevoll kümmerten. Von Kolleginnen habe ich aber schlimme Sachen mitbekommen. Und bei Kindern, die während oder nach der Pandemie geboren wurden, scheinen die Eltern schon beim Kinderwunsch fest mit einer Betreuung ab dem ersten Geburtstag gerechnet zu haben. Meine Kolleginnen und ich haben zu 70 Prozent Anfragen von Schwangeren erhalten, die Ende des dritten Monats bereits für 18 Monate später einen Platz für ihr noch ungeborenes Kind sichern wollten. Das war vor der Pandemie bis 2019 noch nicht so ausgeprägt gewesen. Kinder werden schon gezeugt in der Haltung, dass sich nach einem Jahr die Gesellschaft um die Kinder kümmern muss. Wenn das so nicht klappt, stehen viele Eltern gefühlt vor einer absoluten Katastrophe.
Interessant wäre mal eine Studie, was Corona mit Lehrer/innen gemacht hat. Bei mir sitzt die oben erwähnte Erkenntnis, dass Lehrer/innen quasi Verbrauchsmaterial sind, noch tief.
Das war auch eine tief verletzende Erfahrung, ebenso in den Kitas. Diese Mär, Kinder seien keine Überträger, weil das politisch nicht gut vermittelbar gewesen ist. Dabei sind Kitas und Schulen schon immer Keimschleudern gewesen. Und dann wurden Lehrerinnen und Lehrer und Kita-Personal bei Ausbrüchen auch noch als Verursacher „ausfindig“ gemacht.