DORSTEN. Der direkte Austausch von Mensch zu Mensch kann den Unterricht auf vielfältige Weise bereichern und ermöglicht das Lernen abseits von Bücherwissen. Dass das auch quasi per Mausklick gelingen kann, zeigte das EdTech-Unternehmen ViewSonic in einer Reihe von hybriden Schulstunden auf der diesjährigen Didacta. Das Besondere: Lehrkräfte können die Schulstunden-Reihe kostenlos auf der Community-Plattform von ViewSonic anschauen und in der Schule nutzen – als Diskussionsgrundlage im Unterricht oder Mikro-Fortbildung für das Kollegium. So zum Beispiel die Schulstunde zum Thema „Digitale Inklusion“, der sogenannten Diklusion, mit der blinden Journalistin Nina Odenius als zugeschalteter Gast. Sie gab Einblicke in ihren Berufsalltag und in ihre Schulzeit – beides für sie ohne digitale Technik undenkbar. Live vor Ort in Stuttgart diskutierten mit ihr gemeinsam die Erziehungswissenschaftlerin Prof. Dr. Ines Oldenburg sowie der Sonderpädagogik-Professor Clemens Hillenbrand von der Universität Oldenburg, die Leiterin der dortigen Lernambulanz Dr. Alissa Schüürmann und der Sprecher des Landesschülerbeirats Baden-Württemberg Johannes Stahl über das Potenzial digitaler Medien für Chancengleichheit.

Für Menschen mit Behinderung sind digitale Medien in Verbindung mit Laptop, Smartphone oder digitalen Tafeln weit mehr als praktische Werkzeuge. Sie bieten die Chance auf Teilhabe und ein weitgehend selbstbestimmtes Leben. Wie das gelingen kann, stellt die junge, von Geburt an blinde Journalistin Nina Odenius eindrucksvoll unter Beweis – indem sie ihre Zuhörer:innen mit in ihren Berufsalltag nimmt. Wie kann ein Mensch, ohne sehen zu können, einen Job bewältigen, dessen Hauptinhalt Lesen und Schreiben sind?
„Meine Behinderung spielt in den wenigsten Fällen eine Rolle, und wenn sie doch mal ein Thema ist, gehe ich sehr offen damit um“, sagt Nina Odenius. „Das digitale Arbeiten eröffnet mir einfach ganz neue Möglichkeiten.“ Dank Videokonferenz könne sie mit vielen Menschen im Gespräch sein, so die Journalistin in der Schulstunde, die ViewSonic per Teams und digitaler Tafel live auf der Bildungsmesse Didacta veranstaltete. Interviews vor Ort erledige sie mithilfe einer Assistenz, die die Fotos macht, Videos dreht und all die Dinge übernimmt, die Augenlicht erfordern. Ihre Artikel schreibt die Journalistin an einem Laptop mit Sprachausgabe und einem Braille-Display. Damit lassen sich Bildschirminhalte vorlesen oder Brailleschrift mit den Fingern lesen.
Inklusion von Anfang an mitdenken: Neues Gesetz, neues Bewusstsein?
Webseiten oder Informationen von Interviewpartnern – nicht immer sind sie so aufbereitet, dass Nina Odenius sie schnell verarbeiten kann. Wird das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG), das im Juni 2025 in Kraft tritt, die Teilhabe von Menschen mit Behinderung nachhaltig verbessern? Die Bildungsjournalistin hofft auf eine einheitliche Linie und bedauert, dass erst ein Gesetz dazu auffordern muss, digitale Barrierefreiheit mitzudenken: Dabei gehe es nicht nur um Menschen mit Sehbehinderung, die von kontrastreichen Webseiten oder vergrößerbarer Schrift profitieren würden. „Barrierefreiheit deckt ja noch viel, viel mehr ab, auch für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, wie zum Beispiel Leichte Sprache.“
Nicht zuletzt geht es darum, ein Bewusstsein für die Belange von Menschen mit Behinderung zu schaffen. Derzeit sei Inklusion beispielsweise kein Thema, das im Unterricht behandelt würde, bestätigt Johannes Stahl vom Landesschülerbeirat Baden-Württemberg. Dass Mitschüler:innen meistens nicht auf Kinder mit Behinderung in ihrer Klasse vorbereitet wurden, kennt Nina Odenius auch aus ihrer Schulzeit: „Die Kinder wurden oft in kalte Wasser geschmissen und mussten gucken, wie sie mit mir zurechtkommen.“
BFSG setzt wichtiges Signal, aber …
Im Bildungssektor haben sich EdTech-Unternehmen wie ViewSonic bereits auf den Weg zu mehr Inklusivität gemacht. Derzeit erprobt der Hersteller digitaler Tafeln immersive Reader, die beispielsweise Texte in gesprochene Sprache umwandeln und Webseiteninhalte vorlesen. Die Live-Untertitelung von Videos oder Simultan-Übersetzungstools sind weitere Features des Unternehmens mit Deutschlandsitz in Dorsten. Sie sollen künftig ermöglichen, Informationen mit verschiedenen oder mehreren Sinnen gleichzeitig aufzunehmen und zu verarbeiten.
Aber was bringen digitale Tafeln tatsächlich im Unterricht? Dieser Frage geht Professorin Dr. Ines Oldenburg, wissenschaftliche Direktorin am Institut für Pädagogik an der Universität Oldenburg, gemeinsam mit ihren Studierenden in der Lehramtsausbildung nach. In Forschungsprojekten und in Zusammenarbeit mit Unternehmen wie ViewSonic untersucht sie digitale Hard- und Software hinsichtlich ihrer Lernwirksamkeit in inklusiven Lernsettings.
Zur Schulstunde „Inklusion“ war die Erziehungswissenschaftlerin auf der Didacta live vor Ort, begleitet von Professor Clemens Hillenbrand, Direktor des Instituts für Sonder- und Rehabilitationspädagogik der Universität Oldenburg. Aus Sicht der Pädagogen setzt das BFSG ein wichtiges Signal, um digitale Medien inklusiver zu gestalten. Doch beide sehen noch erheblichen Handlungsbedarf, insbesondere bei der didaktischen Nutzung digitaler Medien und der Qualifikation der Lehrkräfte.
„Technik allein macht keinen guten Unterricht“
In den Klassenräumen vorhandene digitale Tafeln würden in aller Regel gar nicht interaktiv bedient, sondern als Beamer-Projektionsfläche genutzt, konstatierte Ines Oldenburg. „Das hätte man auch billiger haben können. Eine tolle Technik allein macht natürlich noch keinen guten Unterricht.“ Der Wissenschaftlerin geht es vor allem um die tiefen Dimensionen von Unterricht. Denn diese sind entscheidende Qualitätskriterien für lernwirksame Lehrprozesse, wie zum Beispiel Feedback, konstruktive Unterstützung und Classroom Management.
Dass Lehrkräfte, aber auch Schüler:innen ausreichend geschult werden müssen in der (didaktischen) Anwendung digitaler Medien, darauf verweist Professor Clemens Hillenbrand. Die Notwendigkeit einer Kultur der Weiterbildung belege auch eine bundesweite Befragung von 600 inklusiv oder in Förderschulen unterrichtenden Lehrkräften: „Lehrkräfte müssen selbstwirksam im Umgang mit der Technik sein und sich zutrauen, sie zu bedienen und Neues auszuprobieren,“ sagt Hillenbrand. Lernbedarf bestehe aber auch bei Schüler:innen, gerade im Hinblick auf das anspruchsvollere Lernen. „Die Kinder können meistens zwar gut mit Social Media umgehen, aber für eine anspruchsvolle Recherche, beispielsweise das Verarbeiten der Ergebnisse und das Verwenden von Grafiken, brauchen auch Schüler:innen zusätzliche Unterstützung“, benennt Hillenbrand einen Faktor für erfolgreiches Lernen.
Der Didacta-Schulstunde online zugeschaltet war auch Dr. Alissa Schüürmann. Sie leitet die Lernambulanz der Universität Oldenburg. Aus Sicht der Sonderpädagogin eröffnen digitale Tools Kindern mit Lernschwierigkeiten neue Wege. Vorausgesetzt, die Tools erfüllen drei Kriterien: Erstens, sie motivieren Schüler:innen. Zweitens: Informationen werden auf unterschiedlichen Wegen dargeboten, neben einem Text zum Beispiel auch über Bilder oder eine Sprachausgabe. Und drittens: Lernergebnisse lassen sich in unterschiedlicher Form einspeisen. Gerade im Hinblick auf das anspruchsvollere Lernen, außerhalb der Nutzung von Social Media, besteht auch bei Schüler:innen ein Lernbedarf, so der Wissenschaftler.
Andersherum können digitale Tools Kindern mit Lernschwierigkeiten neue Wege und Chancen eröffnen, so Dr. Alissa Schüürmann. Sie leitet die Lernambulanz der Universität Oldenburg. Aus Sicht der Sonderpädagogin müssen digitale Tools dazu drei Kriterien erfüllen: Erstens, sie motivieren Schüler:innen. Zweitens: Informationen werden auf unterschiedlichen Wegen dargeboten, neben einem Text zum Beispiel auch über Bilder oder eine Sprachausgabe. Und drittens: Lernergebnisse lassen sich in unterschiedlicher Form einspeisen.
Lehrkräfte kontinuierlich unterstützen
Neben einzelnen Tools oder Apps, die das Lernen erleichtern, gilt es jedoch auch ein durchdachtes Unterrichtskonzept umzusetzen, dass alle Kinder unabhängig von ihrem Leistungsstand mitnimmt. Zu den Gelingensfaktoren eines solchen guten digital gestützten Unterrichts zählen für Ines Oldenburg vor allem eine funktionierende Technik und ein technischer Support ohne Warteschleifen seitens der Hersteller. Genauso brauche es aber ein Bewusstsein für den inklusiv gestalteten Unterricht und genügend freie Arbeitszeit, um sich mit digitalen Tools vertraut zu machen und sich in Arbeitsgruppen auszutauschen. „Lehrkräfte müssen kontinuierlich an die Hand genommen werden, um mit Freude auf die Dinge blicken zu können. Und das schon im Studium,“ so Oldenburg.
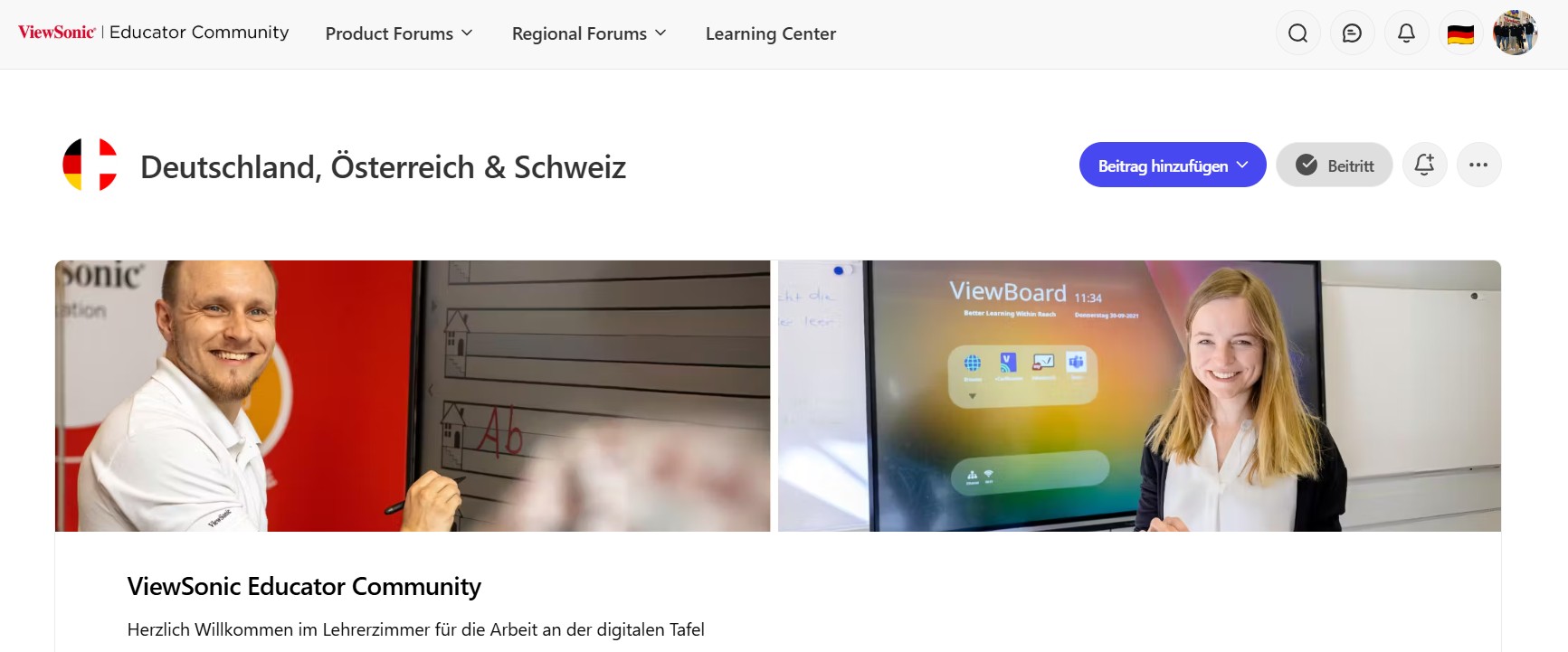 Sie sind Lehrerin oder Lehrer und arbeiten mit einer digitalen Tafel? Dann werden Sie jetzt kostenfrei Mitglied in der ViewSonic-Community und tauschen Sie sich mit anderen Lehrkräften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus! Mit welchem Gerät genau Sie in der Schule arbeiten, ist dabei egal. Es geht um die Vernetzung und das gemeinsame Lernen für sinnvoll gestalteten digitalen Unterricht mit interaktiven Displays. Es erwarten Sie künftig Materialien, Tipps und Anwenderbeispiele bis hin zu aufgezeichneten Schulstunden zu bildungsrelevanten Themen. Außerdem: In jedem Quartal haben Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen die Chance, ein ViewBoard, die digitale Tafel von ViewSonic, zu gewinnen! Also, einfach hier registrieren und loslegen!
Sie sind Lehrerin oder Lehrer und arbeiten mit einer digitalen Tafel? Dann werden Sie jetzt kostenfrei Mitglied in der ViewSonic-Community und tauschen Sie sich mit anderen Lehrkräften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus! Mit welchem Gerät genau Sie in der Schule arbeiten, ist dabei egal. Es geht um die Vernetzung und das gemeinsame Lernen für sinnvoll gestalteten digitalen Unterricht mit interaktiven Displays. Es erwarten Sie künftig Materialien, Tipps und Anwenderbeispiele bis hin zu aufgezeichneten Schulstunden zu bildungsrelevanten Themen. Außerdem: In jedem Quartal haben Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen die Chance, ein ViewBoard, die digitale Tafel von ViewSonic, zu gewinnen! Also, einfach hier registrieren und loslegen! Dies ist eine Pressemeldung der ViewSonic Technology GmbH, Dorsten.
Demokratiebildung: Interaktive Schulstunde mit Saba-Nur Cheema jetzt für den Unterricht nutzen!









