SCHWERIN. Während Bildungsministerien Handlungsleitfäden veröffentlichen, die beschreiben, wie Lehrkräfte Künstliche Intelligenz pädagogisch sinnvoll in den Unterricht einbinden sollen (so jetzt in Mecklenburg-Vorpommern), plaudert eine Oberstufenschülerin aus dem Nächkästchen – und beschreibt, wie der Alltag in den Klassenräumen längst aussieht: ChatGPT liefert Antworten. Und Lehrkräfte merken oft nichts.
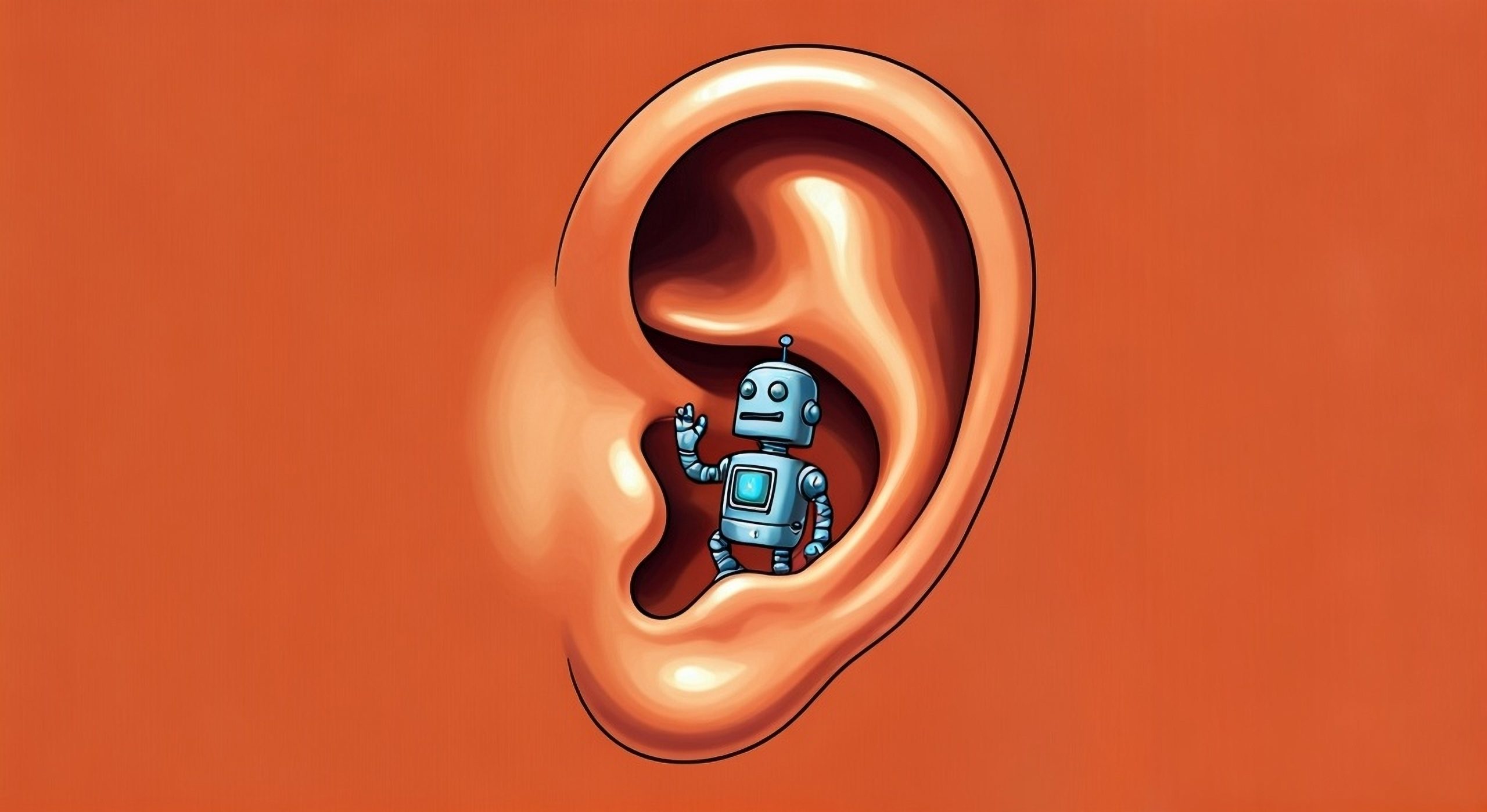
Handy raus, Foto machen, ChatGPT fragen – fertig ist die Bio-Klausur! Was wie ein Albtraum für Lehrkräfte klingt, ist für viele Schülerinnen und Schüler längst Alltag. Eine 17-jährige Oberstufenschülerin beschreibt in einem Beitrag für das Deutsche Schulportal, wie Künstliche Intelligenz den Schulbetrieb verändert und wie leicht es ist, mit ihr durch Prüfungen zu kommen. Titel: “Spicken war gestern – heute scannt die KI die Klausur.”
“Wieder komplette Bioklausur mit Chat gemacht.” – Sätze wie dieser seien im Oberstufentrakt inzwischen normal, erzählt sie. “Mit Erstaunen erlebe ich einen Schulalltag, der für uns Schülerinnen und Schüler ohne künstliche Intelligenz kaum noch vorstellbar ist. Während ein Großteil unserer Lehrkräfte noch in der Einarbeitungsphase steckt, unsicher ist, wie man mit KI pädagogisch sinnvoll umgeht, oder diese bereits als persönlichen ‚Endgegner‘ auserkoren hat, gehört künstliche Intelligenz für uns längst dazu. In der Schule. In der Klausur. In den Hausaufgaben. In unseren Köpfen.”
Die Schülerin berichtet von Klausursituationen, in denen plötzlich das Klicken einer Handykamera durch den Raum hallt – obwohl Handys eigentlich abgegeben werden müssten. “Offenbar scheut sich der eine oder die andere nicht, ein Zweithandy mitzubringen oder einfach zum iPad zu greifen. Aber die Lehrer müssen das doch hören – tun sie in den meisten Fällen aber nicht.” Die Konsequenz: Wer mutig genug ist, riskiert wenig – und bekommt mit ChatGPT immerhin eine Note, die besser ist als ein “Mangelhaft”.
Die Schülerin beschreibt anschaulich, wie selbstverständlich ChatGPT inzwischen im Unterricht eingesetzt wird. Hausaufgaben, so sagt sie, würden “meist in der Pause per KI gelöst und ins Dokument kopiert”. Manche Mitschüler liehen sich sogar auf der Toilette von Jüngeren Handys, um schnell zu recherchieren.
“Ist das noch in irgendeiner Weise fair? Warum sollte man auf einmal, nur weil man den Mut hat, das Handy herauszuholen, eine mittelmäßige oder sogar gute Note bekommen? Gleichzeitig ist es schwer, eine funktionierende Lösung zu finden. Der Nachweis von KI-Nutzung ist fast unmöglich, und falsche Verdächtigungen verunsichern Lehrkräfte wie uns Schülerinnen und Schüler gleichermaßen.”
Zugleich schildert sie, dass KI auch Chancen bietet – wenn sie konstruktiv eingesetzt wird: “Das bloße Lösen von Hausaufgaben per KI bringt wenig Lerneffekt. Doch mit den passenden Prompts wie ‚Erkläre mir die Lösung der Aufgabe in Kindersprache‘ kann man vielleicht doch noch etwas von ChatGPT lernen.” Verbote seien ihrer Meinung nach kontraproduktiv: “Ein Verbot befeuert eher den Drang zur destruktiven Nutzung, was letztendlich allen Beteiligten schadet.”
“Bei Hausaufgaben und bei Hausarbeiten muss deutlich werden, wo die Eigenleistung der Schülerin oder des Schülers liegt und die Urheberschaft muss klar erkennbar sein”
Die Schilderungen der Schülerin zeigen, wie weit verbreitet und wie problematisch der Umgang mit KI an Schulen inzwischen ist. Das hat auch die Politik erkannt. In Mecklenburg-Vorpommern etwa hat Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) nun einen Handlungsleitfaden für den KI-Einsatz im Unterricht vorgelegt. “Bei Hausaufgaben und bei Hausarbeiten muss deutlich werden, wo die Eigenleistung der Schülerin oder des Schülers liegt und die Urheberschaft muss klar erkennbar sein”, meint die ehemalige Schulleiterin.
Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Im Leitfaden heißt es dazu unmissverständlich: “Mithilfe einer generativen KI erstellte Produkte sind als solche schlechter erkennbar als kopierte Inhalte. Eine verlässliche Software, mit der sich KI-generierte Erzeugnisse erkennen und nachweisen lassen, gibt es derzeit nicht und wird es voraussichtlich auch zukünftig nicht geben.” Oldenburgs Lösung: Aufgabenstellungen müssten verändert werden, um sie weniger anfällig für KI-Lösungen zu machen – etwa, indem eigene Experimente, Datenerhebungen oder Umfragen einbezogen werden.
Der Leitfaden wird konkreter. Das Papier entfaltet auf vielen Seiten eine Art pädagogisches Konzept, wie Schule mit KI umgehen soll. Es fordert Aufgaben, die an individuelle Erfahrungen und praktische Erhebungen der Lernenden anknüpfen – etwa Umfragen, Experimente oder Projekte. Lehrkräfte sollen Lernprozesse stärker begleiten und durch mündliche Prüfungsformate absichern. Auch kreative und interaktive Formate wie Präsentationen, Podcasts oder künstlerische Arbeiten werden empfohlen, weil sie auf die persönliche Handschrift der Lernenden angewiesen sind.
Darüber hinaus wird betont, dass Unterricht stärker auf kritisches und kreatives Denken, auf interdisziplinäre Ansätze und auf soziale Kompetenzen ausgerichtet sein sollte. Die Schülerinnen und Schüler sollen nicht nur Produkte abgeben, sondern ihre Entscheidungen reflektieren, begründen und wiederholt überarbeiten – begleitet von kontinuierlichem Feedback der Lehrkräfte.
Auf technische Hilfe beim Enttarnen von unerlaubter Hilfe brauche sie nicht zu bauen. Immer wieder wird im Leitfaden festgehalten, dass eine technische Lösung zur Erkennung von KI-Texten nicht existiert und auch nicht in Sicht ist. Entscheidend bleibe daher die professionelle Erfahrung der Lehrkräfte, die in Gesprächen und Präsentationen einschätzen können, ob eine Leistung eigenständig erbracht wurde.
“Peinlich wird es erst dann, wenn ChatGPT die Frage falsch beantwortet hat und es jeder mitbekommt”
Dass es allerdings einen Gegensatz gibt zwischen Anspruch und Schulwirklichkeit, macht die Schülerin in ihrem Beitrag deutlich. Sie schildert, wie sie selbst KI in vielen Fächern nutzt – von Deutsch über Französisch bis Kunst. “Und, ganz ehrlich: Das tut fast jeder und jede bei uns. Und auch an anderen Schulen. In irgendeiner Form.”
Bei ihren Lehrerinnen und Lehrern erlebt sie allerdings, dass diese oftmals die Entwicklung nicht mitbekommen: „Etwa im Unterricht, wenn plötzlich Schülerinnen und Schüler, die sich sonst eher weniger beteiligt hatten oder weniger qualitative Beiträge geleistet haben, nahezu perfekte Antworten liefern – wohl das Ergebnis einer schnellen iPad-Recherche auf Fragen der Lehrkraft. Das sorgt teils für Neid oder Streit zwischen denjenigen, die dieses Verhalten unfair finden, und den anderen, die dies als ihre einzige Möglichkeit rechtfertigen – die ja sowieso jeder wahrnehmen kann –, das Schuljahr zu bestehen. Peinlich wird es erst dann, wenn ChatGPT die Frage falsch beantwortet hat und es jeder mitbekommt.”
Ihr Fazit: “KI ist da – und sie wird nicht verschwinden. Gerade deshalb brauchen alle Beteiligten, Schüler wie Lehrkräfte, einen reflektierten Umgang damit. Weniger Verbote und Panik, mehr Anleitung und Offenheit. Wir wachsen mit dieser Technologie auf und werden mit ihr leben, arbeiten und denken. Je früher wir lernen, sie verantwortungsvoll zu nutzen, desto eher kann sie in der Schule vom Tabuthema zum sinnvollen Werkzeug werden.” Ob Handreichungen allein Lehrkräften dabei helfen? Wohl kaum. News4teachers
Hier lässt sich der Handlungsleitfaden herunterladen.



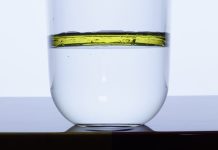






Finde echt witzig, dass immer noch geglaubt wird, das sei “ein Alptraum” für Lehrer oder (noch lustiger) das würde niemand “merken”.
Schulische Realität, 2025:
– das wichtigste Anliegen aller Vorgesetzten ist es, bei der kleinsten Wortmeldung zu “hat mit KI geschummelt” stetig die UNMÖGLICH ZU ERFÜLLENDE 100% Beweispflicht für Lehrer anzuführen.
– dazu wurden diese wiederum von den Bezirksregierungen gezwungen
Berechne neuen Vektor:
1) Spieltheorie: “Der wahre Zweck einer Organisation ist das, was sie tut.”
2) Berücksichtigung: Definition von “effektiv”
Neuer Entscheidungspfad gefunden, Verbalisierung vorbereitet:
“Nun, da sieht man mal, wie gut ich Kevin gefördert habe – mündlich ist es noch schwer für ihn, aber meine Lernangebote haben es ihm ermöglicht, schriftlich sein Potential stärker zu entfalten. Hoffentlich gelingt es mir, ihm auch mündlich die Angst zu nehmen. Das liegt bestimmt an seiner psyyyyyyyychischen Belaaaaaastung durch die vielen Noten im Schulsystem, kein Wunder, dass es ihm damit nicht gut geht – wir haben ja nicht einmal Lernlandschaften !”
Ach nööö. Jetzt also auch noch das.
Während die Schüler ihre Klausuraufgaben ganz entspannt mit Handy oder Tablet scannen und die KI ihnen die Lösungen direkt aufs Display spuckt, sitzt die Lehrkraft brav vorn bei der Klausuraufsicht bewaffnet mit einer Broschüre über „KI in der Schule“, die aussieht, als hätte sie ein Grundkurs PowerPoint gestaltet.
Betrug? Nein, das nennt sich heute „digitale Teilhabe“. Wissen ist überbewertet – Hauptsache die App funktioniert. Endlich Abi für alle – wir schaffen das! Die neue Formel: WLAN + KI = 1,0.
Und das Beste: Manche Lehrkörper wollen den Betrug gar nicht (mehr) sehen. Denn wer nichts merkt, muss nichts tun – und bekommt dafür glänzende Notendurchschnitte. Der Lehrer, der die Täuschung systematisch übersieht, liefert Jahr für Jahr makellose Klausur- Ergebnisse und wird dafür belohnt: als „verlässlich“, „engagiert“ und bald auch als „Freund der Schulleitung“ erntet er “Liebesblicke” von Schülern, Eltern und manchem Schulleiter.
Und jetzt kommt der neueste Geniestreich: Der Textmarker mit Minidisplay, der beim Überstreichen gleich die Lösung liefert. Bald gibt’s sicher auch den Schulfüller mit KI-Chat, der automatisch passende Zitate aus Faust einfügt.
Die Schule wird zur Bühne für technologische Zauberei, während Bildung zur Kulisse verkommt. Abi für alle mit ner Eins vorm Komma – das schaffen wir nun sicher auch noch.
“Während die Schüler ihre Klausuraufgaben ganz entspannt mit Handy oder Tablet scannen und die KI ihnen die Lösungen direkt aufs Display spuckt”
Meine Fresse, sind Sie fahrlässig in Prüfungssituationen! :/
Es wurde schon immer bei Klassenarbeiten / Klausuren betrogen. Die aktuelle Lehrergeneration ist nicht dümmer als die vorhergehenden. Und Schüler waren und sind hier immer sehr kreativ. Mit Praxiserfahrung als Lehrkräft wüssten Sie, dass eine Person alleine hier niemals alles mitbekommen kann. Das geht prinzipiell nicht. Auch beim Fussball hat man drei Schiedrichter (1 Hauptschiedsrichter und zwei Assistenten) und den “Videobeweis”. Bei wichtigen Spielen sogar vier Schiedsrichter..
Rainer lässt schulbedingt vielleicht keine Klassenarbeiten schreiben …
So einfach ist es nicht. Wenn die Schüler raffiniert sind, lenkt einer sie ab, die anderen scannen
Um solchen Dummfug zu begegnen hilft vielleicht das handschriftliche Einreichen der Ergebnisse.
Wenigstens im Nachhinein hätte der Schüler einen dreifachen Durchlauf des KI-Ergebnises durch das Gehirn. Und wenn es falsch ist?
Dann wird die Diskussion um “Lernen nach KI” angestoßen. Ähnlich wie “Lernen nach Gehör”
Lasst sie doch ins Messer laufen. Wenigstens das kann man den Schülern vorher sagen.
Handschrift halte ich auch für weitaus besser als Tippen. Beim Stift auf Tablet bin ich nach wie vor unschlüssig, tendenziell irgendwo dazwischen.
Das Einreichen handschriftlicher Ergebnisse mag gerade eben mit Zettel und Stift gefertigt noch einen rudimentären Effekt haben, wenn einfach abgeschrieben wird, was die KI vorgibt. Denn mit einem Tablet lässt sich bereits heute eine Handschriftenprobe geben und die KI ergänzt ihr Ergebnis dann in dieser „Handschrift“.
Wenn wir nicht sehr früh vermitteln können, warum es sich lohnt, das Lernen zu lernen, wird höchstwahrscheinlich der größere Teil der Schülerschaft den bequemen KI-Weg nutzen. Und nach der Q2 kann man dann ja einfach mit dem schulischen Teil der Fachhochschulreife gehen, ohne eine Prüfung ablegen zu müssen (zumindest in Hessen). Vielleicht sollte man an der Stelle mal das ein oder andere Kolloquium dazwischenschalten für SuS zum Schulabschluss – und für Eltern/Erziehungsberechtigte, die eigentlich auch kein Interesse daran haben dürften, dass ihr Nachwuchs außer tumbes Abschreiben nichts mehr auf die Kette kriegt…
Das ist der Weg zur Menschheitsverdummung….. von Nenschen gemacht, von Menschen gewollt, von Menschen gefördert und gefordert….
Das allein zeigt doch schon – der Mensch an sich ist blöde.
Mehr Beweise brauche ich zumindest nicht.
Doch, wir kriegen das mit, aber
Tatsächlich wünsche ich mir von der Politik die Erlaubnis bei Klausuren Störsender einsetzen zu dürfen, weil ich diese “kreativen” Aufgabenformate nicht als Lösung sehe und die Regelung, dass man jemanden in flagranti erwischen muss, um dann nur den Teil, der wahrscheinlich mit einer KI generiert wurde, nicht werten zu dürfen, den Rest dann aber schon noch, sehr unbefriedigend und den anderen S*S gegenüber unfair finde.
Kreative Aufgabenformate, mündliche Überprüfungen … sind Zeitfresser, denn die müssen alle während der Unterrichtszeit stattfinden. Das hieße dann, dass die S*S viel mehr selbstständig arbeiten müssten und genau in dieser Zeit natürlich wieder auf KI zurückgreifen, da sie unbeobachtet sind. Danach müssten dann erneut Überprüfungen stattfinden, um sicher zu gehen, dass diese selbstständige Arbeit einen Nutzen hatte. …
Es ist naiv anzunehmen, dass der sinnvolle Umgang von den meisten S*S berücksichtigt wird, wenn es um Noten geht. Und immer wenn die Entscheidung, Zeit und Arbeit in etwas zu stecken oder lieber schnell fertig zu werden (also die KI “anzuschmeißen”), wird es schwierig werden. Es gehört unheimlich viel Selbstdisziplin dazu, sich für die erste Variante zu entscheiden. Und Selbstdisziplin ist genau das, was vielen S*S heutzutage fehlt, weil sie gelernt haben, dass ihre gefühlten Bedürfnisse immer am wichtigsten sind.
Es geht also nicht um den sinnvollen Umgang, sondern um die Rückkehr zu mehr Selbstdisziplin. …
Ja, ich weiß, ich bin böse.
So isses. 100%
Du bist nicht böse, sondern realistisch.
Konsequenz – Noten abschaffen.
Dann NUR mündliche Prüfungen für ESA-MSA-AHR-Abschlüsse. Fertig!
Dauert und es fällt sicher viel Unterricht aus, wenn wochenlang rund um die Uhr – wir sind ja Kummer gewöhnt – geprüft werden muss – aber dann muss ja doch das Eine oder Andere gelernt werden….
Was genau spricht eigentlich dagegen den Einsatz von KI in Klausuren zu erlauben?
Der Korrekturaufwand ist nicht mehr zu stemmen. Und: wen interessieren schon von KI aneinandergereihten Worte. Da bietet sich die Korrektur mit KI an, dann hält sich die Zeitverschwendung wenigstens in Grenzen und alle haben ihren Job erledigt.
Es stellt sich ganz generell mal wieder die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Formats “Klausuren”. Wie sinnlos ist eigentlich eine Schule ohne Klausuren?
Die Technologie zu bekämpfen, mittels Jammern, ist schon tragisch-komisch irgendwie, die digitalisierte Schule bekämpft ihre fleischlichen Insassen.
“Das hat auch die Politik erkannt.”
… und bietet als Lösungen
– Fortbildungen durch Experten
– einen sicheren rechtlichen Rahmen
– gute Tools, die Kollegen umsonst nutzen können
– genügend Zeit für die Einarbeitung und Konzepterstellung
Ach ne, eine laminierte Handreichung.
Laminiert? Zum Selbstausdrucken 🙂 Herzliche Grüße Die Redaktion
Nachdem ich das jetzt gelesen habe, werde ich das noch nicht mal ausdrucken, geschweige denn laminieren…
Übrigens auch früher schon mussten die “laminierten Handreichungen” von uns selber ausgedruckt und laminiert werden 😉
Sie haben den Zwischenschritt vergessen.
Ausdrucken, schreddern, laminieren. – Laminiertes Konfetti kann man immer gebrauchen und nachhaltig ist es auch.
Natürlich, aber dafür werden die überwiegend verbeamteten Lehrkräfte ja nicht besoldet – also wird gemäß Dienstanweisung gehandelt, wie weltfremd die auch immer sind. Schließlich haben vorgesetzte Dienststellen immer Recht.
Immer Recht und keine Ahnung!
Mich würden mal d e r e n Kompetenzkreuzchen interessieren….
Das wird dann schwierig mit der Mülltrennung.
Sie sollen das geshredderte, laminiert Konfetti nach der Feier wieder einsammeln und bei der nächsten Psrty wieder schmeißen. Warum habe ich denn extra auf die Nachhaltigkeit hingewiesen?
Ich finde es auch unbefriedigend, aber das ist nicht meine Baustelle. Bei mir ist es auch nicht so, dass regelmäßig mit KI gespickt wird; dazu sind die Noten auch insgesamt zu schlecht. Ab und an passiert es schon und dann gebe ich halt die gute Note. Referate/Handouts verlange ich aber immer seltener als Prüfungsleistung. Ich finde in Deutsch ist das Spicken mit KI deutlich schwieriger als beispielsweise in anderen Fächern. In Mathe sieht das vielleicht schon anders aus.
In Mathe ist zumindest ChatGPT noch ziemlich schlecht, weil das System nicht selbst rechnet und Zusammenhänge nicht logisch versteht, sondern Wort für Wort über Wahrscheinlichkeitsaussagen arbeitet. Da kommen die lustigsten Unsinnigkeiten heraus. Ebenso in Physik.
Noch.
Die neueste Version kann (leider?) sehr gut Mathe. Selbst Oberstufe, mit Erklärungen der Rechenschritte etc. Der Rechenweg ist je nach Prompt z.T. (aber immer seltener) seltsam bis absurd, aber immer seltener falsch. Hab ich selbst mit meinen Klausuren und dem u der letzten Jahre ausprobiert, ein Foto reicht…
Das bietet natürlich viele Chancen, aber für Klausuren ist das ein großes Problem.
Das stimmt, wenn Sie sich auf die kostenlose Version von GPT beziehen, die wahrscheinlich ein Großteil der Schüler nutzt. Die Pro-Version beinhaltet ein besseres Modell, das aber 200 $ pro Monat kostet. Dieses Modell hat (wie Gemini Pro von Google) bei der letzten Mathe-Olympiade eine Goldmedaille gewonnen.
Bei dem stetigen Fortschritt der letzten drei Jahre ist es nicht unwahrscheinlich, dass nach dem nächsten Update die Version für die kostenlose Variante so gut ist wie die aktuellen teuersten Modelle — so wie man heute ohne zu bezahlen LLMs nutzen kann, die mehr Fähigkeiten haben als die in teuren Abo-Versionen von vor ein paar Monaten.
Wer Unterricht immer noch als Vermittlung von abfragbarem Wissen und den Test als geeignetes Mittel versteht, zu entscheiden, ob einer LKW-Fahrer oder Ärztin werden darf, wird wohl umlernen müssen – sei denn, man baut Klausurräume als faradayschen Käfig (Abschirmung elektromagnetischer Wellen). Ist KI nicht die wunderbare Chance, zur Bedeutung von individuellen Kontakten und eigenem, argumentierendem Denken zurückzukehren?
Nicht Wissen allein, sondern Fähigkeiten – auch soziale – sind in Zukunft notwendig.
Warum nicht im Unterricht einmal sagen: Macht mal ChatGPT&Co auf und lasst die Frage beantworten: Was sagt Augustinus über die Unsterblichkeit der Seele? Oder: Welche Bedeutung hat KI Ukraine-Krieg?
Wahrscheinlich genügt die erste Welle von Antworten, um ein engagiertes Gespräch anzuregen. Die Lehrerin wird dann Moderatorin des Gesprächs, das sie immer wieder ordnet, zusammenfasst, gestammelten Ansichten zum Verständnis verhilft … und nicht Erklärerin von fertigen Texten.
Na und? Bildung hin und her, aber wer darf nun Medizin studieren? Jeder, der nachweisen kann, dass es ihm um die Kranken und nicht um das Geld geht, systemisch denken und nicht nur einen Organismus als Summe von einzelnen Organen betrachten kann, im Blick behält, dass es um Menschen und nicht um die Reparatur einer Maschine geht … und aufgrund seiner Beobachtungen und der Laborwerte versteht, welche Fragen er an die KI stellen sollte.
Ist KI nicht die wunderbare Chance, sich wieder dem (Mit)Menschen zuzuwenden?
Da habe ich eine supergute Idee für Sie!
Von der ersten Generation Chirugen, die nach dem Schema “Nicht Wissen, sondern Gefühl und ‘richtige Haltung’ regelt wer Arzt wird!” werden SIE, Sie ganz persönlich, am offenen Brustkorb operiert.
Immerhin sind “wissens- und könnensorientiert” (am Ende gar noch nach Noten selektiert, ach Du Schreck!) ausgebildete Chirugen kapitalistisch-fossiles Teufelszeug, so jemanden können Sie ja unmöglich als Arzt wollen.
Wieso wollen Sie nicht über eine kompetenzorientiert gebaute Brücke fahren?
Die Ramedetalbrücke und die Carolabrücke waren aber schon deutlich älter …
Dem damaligen “Stand der Technik” und Verkehrsaufkommen entsprechend, war die Carolabrücke gar nicht schlecht.
Dass das Verkehrsaufkommen und die Masse der Transportgefährte exorbitant steigen würden, konnte die Bauingenieure dazumal nicht einrechnen.
Alles zu seiner Zeit
(Oder wie man heutzutage sagt: im historischen Kontext sehen.)
Ich weiß, dass Sie das wissen. 😉
Sehen’se, das gleiche lässt sich für die Rahmedetalbrücke, die Leverkusener Brücke, die Schiersteinerbrücke usw. usf. ebenfalls sagen.
Sie alle sind dem Stand der technik entsprechend den damaligen Bedürfnissen entsprechend kompetent geplant worden. Die Bauausführung zu den damaligen Zeitpunkten war dann schon weniger kompetent. Die späteren Wartungen, Erweiterungen etc. erfolgten bei steigendem Verkehraufkommen an fehlenden finanziellen Ressourcen, weil inkompetente Nieten in Nadelstreifen mit BWL-Halbwissen die Zielvorgaben für die einzuhaltenden Budgets gemacht haben.
Ingenieurskunst bestand nicht mehr darin, Neues zu entwickeln sondern Altes günstiger herzustellen oder instand zu halten.
Und so wurden aus Scheiße Bonbons hergestellt. Dabei wurden folgende Erfolge dauerhaft erzielt. Form und Farbe der Produkte konnten sich mit Vergleichsprodukten messen lassen. Das Problem des nicht ausgereiften Geschmackbildes wartet allerdings noch auf die finale Lösung. Man kann eben nicht alles haben.
@Dickebank Diese Brücken wurde kompetenzorientiert gewartet.
Nee, auch die Brückenprüfer und deren Vorgesetzte waren ebenfalls älter. Hinzu kommt, dass der damalige Verkehrsminister heute MinPrä ist mit Kompetenz in Darstellungskunst.
*ähm*
*schwitz*
“Also, ach ja, ha ha, also…ich bin ja eh auf Fahrrad umgestiegen wegen CO2, äh, da lasse ich anderen solidarisch die Vorfahrt!”
*Uff!*
// Warum nicht im Unterricht einmal sagen: Macht mal ChatGPT&Co auf und lasst die Frage beantworten: Was sagt Augustinus über die Unsterblichkeit der Seele? Oder: Welche Bedeutung hat KI Ukraine-Krieg?
Wahrscheinlich genügt die erste Welle von Antworten, um ein engagiertes Gespräch anzuregen. Die Lehrerin wird dann Moderatorin des Gesprächs, das sie immer wieder ordnet, zusammenfasst, gestammelten Ansichten zum Verständnis verhilft … und nicht Erklärerin von fertigen Texten. //
Was für eine tolle Bildung: Die Schüler als Vorleser und Eintipper für ein Gespräch zwischen verschiedenen KIs, mit dem Lehrer als Moderator. Leonie: “Meine KI antwortet auf Abduls KI: …”
Herr, schmeiß Hirn!
Eine Möglichkeit wäre es, die Digitalisierung von Schule wieder zurückzufahren und wieder mehr auf analogen Unterricht zu setzen – ohne iPad und ohne W-Lan, sondern klassisch mit Buch, Stift und Papier.
KI wird einigen Schülern spätestens nach dem Abschluss auf die Füße fallen: Zum einen werden viele Berufe obsolet werden, insbesondere in den Bereichen Verwaltung und Wirtschaft. Wer handwerklich nicht geschickt ist, könnte in der Zukunft arge Probleme bekommen. Zum anderen werden sie feststellen, dass Menschen aufgrund von Charakter und Können eingestellt werden. Beides kann nicht durch die KI angeeignet werden.
Wenn die KI dein Abitur zu verantworten hat, dann kann der künftige Arbeitgeber auch gleich die KI anstellen, anstatt dich.
Das geschieht, keine Frage. Wir haben zwar i-Pads für alle, aber mehr und mehr Kollegen lassen sie im Unterricht nur noch für Recherchen und spezifische Aufgaben einsetzen, etwa Tabellenkalkulation.
Fürs Schreiben wieder Heft und Stift – das hilft sogar beim Denken!
Betrug durch KI wird damit aber nicht unterbunden. Da hilft es nur, in Klassenarbeiten nach alter Väter Sitte durch die Reihen zu tigern.
Absolut richtig – das majestätische Tigern durch die Reihen ist nicht nur Klausuraufsicht, das ist hohe Kunst der pädagogischen Präsenz.
Bei einer Bio-Klausur meinte ein Schüler, ich würde ihn umkreisen wie ein Geier das Aas.
Wer bei einer Bio-Klausur die Aufsicht mit einem Geier vergleicht, zeigt nicht nur Kreativität, sondern auch solides Fachwissen. Ein biologisch korrekter Analogieschluss mitten im Prüfungsstress? Da kann man fast schon Bonuspunkte für bildhafte Fachsprache vergeben.
Der Schüler quasi als Aas, das von Geier umkreist wird?
Nicht ich, ein Schüler formulierte so. Ich konnte es auch kaum fassen.
Sie wollen ernsthaft Unterricht wie im Mittelalter machen? Schule muss auf die Zukunft vorbereiten und die Arbeitswelt wird von KI beherrscht werden. Digitalisierung in der Schule ist doch völlig alternativlos. Ja, Können wird ein Einstellungskriterium sein, insbesondere das Können der KI-Nutzung.
“Unterricht wie im Mittelalter” – Geht es noch polemischer? Wie wäre es mit Unterricht, der auf das Können der Schüler fokussiert ist und nicht auf das Können einer KI? Das eine schließt das andere im Übrigen nicht aus. Früher ging man auch in den Computerraum, um mal was im Internet zu recherchieren. Den omnipräsenten Einsatz von KI braucht es in einer Schule ganz sicherlich nicht.
Das war nicht wirklich polemisch. Wir haben nur unterschiedliche Auffassungen von “Können”. Mein Vater beschreibt die Diskussion heute mit der um die Einführung des Taschenrechners. Heute kommt kein Mensch mehr auf die Idee, das Können um die Nutzung von Logarthmustafeln und damit verbunden der überschlagsmäßigen Abschätzung der Ergebnisse als wirklich wertvoll zu betrachten. Oder das schriftliche Dividieren in allen möglichen Schwierigkeitsgraden. Braucht man nicht, macht die Maschine, so einfach ist das.
“Können” bedeutet heute und besonders in der Zukunft, KI sinnvoll einzusetzen. Das wird schon in näherer Zukunft eine Kernkompetenz sein. Jedenfalls erheblich mehr als das Wissen, welcher große Fluss durch Ägypten fließt oder was nun genau das 10. Element des Periodensystems ist. Und genau deshalb muss die KI in der Schule zum Einsatz kommen. Im “Mittelalter” waren Stift und Papier sicher ausreichend, heute müssen wir unsere Kinder digital zukunftssicher machen und dafür ist ein Computerraum bzw. ein bisschen Internetrecherche in etwa so hilfreich wie eine Schere zum Bäumefällen.
Diese Antwort klingt schon wesentlich differenzierter. Danke dafür und ich gebe Ihnen in Teilen auch recht. Es braucht den gesunden Mittelweg. KI kann und muss natürlich in der Schule stattfinden. Aber es geht ja auch um die eigene kognitive Entwicklung. Einen Suchbegriff bei Google eingeben, konnten Kinder schon immer. Beim Auswerten der Suchergebnisse tun sich die Abgründe dann aber auf.
Stimmt, aber auch das Auswerten von Suchergebnissen ist doch wieder Geschichte. Immer, wenn es mehr ist als die Öffnungszeit von Lidl, macht es die KI und fasst es zusammen.
Nur fehlt da die Kompetenz, die Infos der KI auf Richtigkeit zu überprüfen. Dies ist besonders dann wichtig, wenn die KI mit vielen Falschinformationen gefüttert wird und man als Schüler nie gelernt hat, diese zu hinterfragen. Dies geht ja nur mit eigenen erworbenen Kompetenzen, die nicht von der KI generiert wurden.
Nicht auszudenken, was passiert, wenn die KI in falsche Hände gerät. Schon jetzt kann man ja Politikern Dinge in den Mund legen, die diese nie gesagt haben und die dann als Pseudowahrheit über die sozialen Netzwerke verteilt werden. Naive Geister hinterfragen zu wenig.
Wer nicht einmal eine Schere bedienen kann – dem sollte man keinesfalls Kettensägen geben.
Aber hey, das ist nur meine private, kapitalistisch-fossile Meinung – in meinem Unterricht ist “KI” natürlich gerne gesehen, genau wie Tablets und Videos und Smartphones.
Denn das bewirkt gute GEFÜHLE und strahlende Kinderaugen – “so modern bei Ihnen, voll krass!”.
Und darum geht es ja, wie ich mir (auch hier) ständig anhören muss/darf.
Es wurde und wird bestellt.
Diese Drohne liefert ab.
Für einige wenige Spezialisten ist Ihre Prognose sicherlich richtig. Für die ist sicheres Schreiben und Rechnen allerdings die Basis im Verbund mit logischem Denken. So wie es ja schon heute für Programmierer gilt.
Die meisten Menschen werden allerdings nur Anwender von KI sein oder gar von dieser ersetzt.
Versteckt in anderen Anwendungen wird KI im Hintergrund laufen, ohne dass es der Anwender “mitbekommt” (etwa so, wie bei manchen Übersetzern – etwa deepl.de – schon jetzt).
Im Mittelalter wurde ganz anders unterrichtet.
Im Grunde schaden sich die Schüler langfristig nur selbst, wie die vielfachen negativen Folgen (weniger kritisches Denken, weniger Wissen usw. vgl. diverse Studien) durch Anwendung von KI zeigen.
Das ist wie wenn man etwas Bewegung für die Gesundheit braucht und mit dem E-Scooter fährt und denkt, das nützt.
Aber unsere Schüler werden die KI schon reflektiert und sinnvoll einsetzen.
Jaaaaa…ganz bestimmt werden sie das. Das tun sie schließlich mit den sozialen Medien und ihren Bildschirmzeiten auch schon 🙂
So die Hoffnung… 😉
Das war Ironie. Aber von vielen “(Medien)pädagogen” genau so immer wieder verbreitet.
Ich weiß 🙂
Muss ich wirklich rechtssicher das Schummeln nachweisen? Ich habe mir folgenden Weg überlegt: Am Anfang des Schuljahres werde ich verkünden, dass ich mir im Zweifel vorbehalte, Lösungswege und Gedankengänge nach der Klausurrückgabe von einzelnen SuS erklären zu lassen. Wenn Sie dann dort versagen und trotzdem darauf beharren, dann regel ich das über die mündliche Leistung, wenn es regelbar ist (d.h. die Diskrepanz zwischen Klausur und realistischer Zeugnisnote nicht zu groß). Kein Richter wird richtig dokumentierte mündliche Noten umdrehen (können), wie sollte er auch.
Wenn aber ein 5er-Schüler mehrfach sehr gute Leistungen in den Klausuren abliefern sollte und dummdreist versucht, damit durchzukommen, werde ich sie einfach auch ohne jeden Nachweis als Täuschungsversuch werten. Soll der Schüler doch klagen und ggf. einem Richter erklären, warum er in der Klausur zwar brilliert, aber ansonsten selbst über rudimentäres Wissen nur unzureichend verfügt.
Hausaufgaben werden schon seit Jahren von mir nicht mehr in die Benotung mit einbezogen (was ich zu Beginn des Schuljahres auch verkünde), weil ich auch schon früher Mami, Papi oder Geschwister hätte mitbewerten müssen.
Lassen Sie LOCKER…statt zu versuchen, eine Stacheldrahtrolle immer fester zu drücken und sich wundern, wieso es immer mehr weh tut:
Wenn der Schüler nicht geständig ist, einfach ab da:
– kein feedback mehr geben: “Dein Text ist perfekt so wie er ist, da braucht es keine Rückmeldung.”
– wegignorieren
– mündliche Note VON ANFANG AN entsprechend runter
– freiwillige Leistungsfeststellungsprüfung anbieten, falls es Beschwerden gibt (mit den richtigen Kollegen versteht sich, war dann leider 5, Schadebanane 🙁 )
– im Zweifelsfall die schlechtere Note geben, das ist nicht verboten
– bei jeder Klausur alles vorne ablegen lassen, wirklich ALLES, Ihren, Stifte, Mäppchen kontrollieren (damit es für die ANDEREN unbequem wird und die den dann einstilen)
– den offensichtlichen Vorwurf NIE aussprechen vor SuS/Schülerversteherlehrern
Also ja – geht schon mit Reduktion über mündlich, sich mit solchen Leuten Arbeit sparen, es unbequem gestalten.
Nix von der Liste oben ausser die freiw. Prüfung kostet Zeit oder Aufwand. Und das sind so 20 Minuten, ist ja erträglich.
„Während ein Großteil unserer Lehrkräfte noch in der Einarbeitungsphase steckt, unsicher ist, wie man mit KI pädagogisch sinnvoll umgeht, oder diese bereits als persönlichen ‚Endgegner‘ auserkoren hat, gehört künstliche Intelligenz für uns längst dazu.“
Liebe Schülerinnen und Schüler: Glaubt bitte nur nicht, Ihr wäret deshalb beim Thema KI schon weiter als Eure Lehrerinnen und Lehrer.
… aber der Glaube kann doch Berge versetzen:)
Das Bild finde ich übrigens passend und lustig zugleich.
Da sitzt doch die Intelligenz nicht zwischen den Ohren sondern als kleines Roboterchen im linken Ohr.
Danke an die Redaktion, die die KI zu so einem Bild anstachelte.
🙂
Moment, die Klausuren werden bei mir immer noch mit Zettel und Papier geschrieben. Handys werden abgegeben, Smartwatches auch. Nun versucht gelegentlich vielleicht einer, mit dem Zweithandy zu arbeiten. Dazu müsste er/sie den Klausurtext erstmal abfotografieren und dann die Aufgaben und dann die Lösungen abschreiben. Dass das alles nicht auffällt, halte ich immer noch für unwahrscheinlich. Natürlich nehme ich meine Aufsicht ernst und hoffe, dass das die KuK auch machen.