BERLIN. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will die Krisenvorsorge an Schulen verankern. In einer Doppelstunde pro Schuljahr sollen ältere Schülerinnen und Schüler lernen, welche Bedrohungsszenarien denkbar sind – und wie man sich darauf vorbereitet. Während aus Teilen der Politik Zustimmung kommt, warnen Schulleitungen und Lehrkräfte vor einer Instrumentalisierung der Schulen.

„Mein Vorschlag ist, dass in einem Schuljahr in einer Doppelstunde mit älteren Schülern darüber diskutiert wird, welche Bedrohungsszenarien es geben kann und wie man sich darauf am besten vorbereitet. Kinder sind wichtige Wissensträger in die Familien hinein“, sagte Dobrindt dem Handelsblatt. Der CSU-Politiker will das Thema bei der Innenministerkonferenz Anfang Dezember in Bremen auf die Tagesordnung setzen.
In einer Zeit wachsender Unsicherheiten gehe es darum, „Vorsorge statt Verunsicherung“ zu schaffen, so Dobrindt weiter. Er kündigte zudem einen „Pakt für den Bevölkerungsschutz“ an, mit dem Warnsysteme verbessert und Schutzräume ausgebaut werden sollen. Die Vorbereitung auf Krisen dürfe kein Nischenthema sein, betonte der Minister: „Wer Vorräte, Batterien oder ein Kurbelradio zu Hause hat, sorgt nicht für Panik – er sorgt vor.“
Zustimmung von CDU-Ministerpräsident Rhein – Kritik von Linkspartei
Unterstützung bekommt Dobrindt aus Hessen. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) nannte die Idee „vollkommen richtig“: „Wir müssen gewappnet sein. Schülerinnen und Schüler müssen wissen, was um sie herum passiert und wie man sich schützen kann.“ Sein Kultusminister Armin Schwarz (CDU) ergänzte, man habe bereits gemeinsame Aktionen mit der „Blaulichtfamilie“ und den Jugendoffizieren der Bundeswehr. Weitere Angebote könnten etwa in Projekttagen umgesetzt werden.
Die Linkspartei reagierte dagegen empört. „Hier sollen ganz offensichtlich Ängste geschürt werden“, sagte Nicole Gohlke, stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, der Nachrichtenagentur AFP. Sie sprach von „Panikmache, gerade bei Kindern und Jugendlichen“. Die Schule müsse „unbedingt ein Schutzraum bleiben“.
Grünen-Innenexperte Leon Eckert zeigte sich offener: „Jungen Menschen in der Schule aufzuzeigen, wie sie sich und anderen in Krisensituationen helfen können, begrüßen wir.“ Allerdings müsse das Thema in ein breiteres Konzept eingebettet werden. Eckert schlug vor, den bundesweiten Warntag „zu einem bundesweiten Übungstag auszubauen, um Menschen in Krisenvorbereitungen einzubinden“.
Lehrerverband VBE: „Vorsorge ja – aber nachhaltig!“
Auch der Verband Bildung und Erziehung (VBE) äußerte sich grundsätzlich positiv, warnte aber vor Symbolpolitik. VBE-Bundesvorsitzender Gerhard Brand erklärte: „Katastrophen und politische Ereignisse machen nicht Halt vor den Toren der Schule. Schülerinnen und Schüler wachsen in einer Mediengesellschaft auf und sind tagtäglich mit Nachrichten jeglicher Art konfrontiert. Dies zu thematisieren, gehört bereits heute zum Unterrichtsalltag.“
Eine einzelne Doppelstunde pro Jahr sei jedoch „wenig nachhaltig“. Brand betonte: „Für eine nachhaltige Lösung braucht es mehr als 90 Minuten pro Jahr. Zudem muss das Umfeld der Schule eingebunden werden – etwa das Technische Hilfswerk oder die Feuerwehr.“ Angesichts der Überlastung der Lehrkräfte sei das aber nur mit zusätzlichen Ressourcen möglich. „Sonst bleibt die Verantwortung erneut an den Schulen hängen“, warnte Brand.
Schulleitungsverband: „Schulen sind Orte der Bildung, nicht der Bedrohung“
Deutliche Kritik kam vom Allgemeinen Schulleitungsverband Deutschlands (ASD). Vorsitzender Sven Winkler sagte: „Schulen sind Orte der Bildung, nicht der Bedrohung. Wer über Krisen spricht, muss über Bildung, Vertrauen und Resilienz sprechen – nicht über Angst.“ Eine Ausweitung des Bildungsauftrags auf zivilschutznahe Themen lehne der Verband ab.
Winkler mahnte, Lehrkräfte seien „Pädagoginnen und Pädagogen, keine Katastrophentrainer“. Es fehle an rechtlicher Klarheit, Fortbildungen und Ressourcen. Ohne diese Voraussetzungen drohe die Verantwortung erneut bei den Schulleitungen zu landen. „Statt Angstpädagogik brauche es eine Bildung, die auf Resilienz, Solidarität und Selbstwirksamkeit zielt“, so Winkler.
Er plädiert für altersgerechte Unterrichtsformate und Kooperationen mit Feuerwehr, DRK oder THW im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE): „Krisenkompetenz entsteht nicht durch Alarmübungen, sondern durch Dialog und Vertrauen. Schule darf nicht zur Bühne sicherheitspolitischer Symbolik werden.“ News4teachers / mit Material der dpa


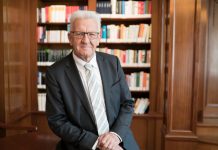








Ich wäre ja für Minister*innen, die ihren Job machen, damit ich kein Kurbelradio brauche. Ich werde nicht in der Schule Krieg spielen.
Reicht schon, wenn Sie Katatrophe spielen.
So ein paar zusammengebrochene Strommasten wie im Westmünsterland sind statistisch gesehen wahrscheinlicher. Daneben hätten wir noch die häufiger auftretenden Extremwetterlagen.
… oder 3 Tage Stromausfall für ca. 50.000 Menschen in Berlin kürzlich (auch Krankenhäuser und Pflegeheime betroffen), weil irgendwelche Idioten 2 Strommasten in Brand setzten.
Es geht vorrangig um Katastrophenschutz.
Und der geht alles was an.
BBK = Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrohenhilfe.
Den Katastrohen wird jetzt geholfen, sie werden nicht mehr geschützt.
😉
“dass in einem Schuljahr in einer Doppelstunde mit älteren Schülern darüber diskutiert wird”
Was heißt hier “diskutiert”?
Jeder gute Pädagoge weiß, dass nur eigene Erfahrungen, also geübte Praxis, den maximalen Lerneffekt haben:
Also: Schützengräben ausheben, Drohnen bauen und steuern, “Klassenreisen” in den nächsten Wald mit Zelt und Tarnkleidung,…
Nur so gelingt effektiver Kompetenzaufbau! Fragend entwickelnder Unterricht (“diskutieren”) ist doch sowas von gestern…
Aber der Unterricht in den Flakstellungen anno 45 hatte sowohl qualitativ als auch quantitativ schwere Mängel.
Ja, das stimmt … es wurde didaktischen nicht ausreichend reduziert … z.B. hätte man von deutscher Staatsseite sicherstellen müssen, dass gegen die Flakhelfer und Schützen nicht geschossen resp. Bomben auf sie geworfen werden.
Die gemachten Realerfahrungen war für viele doch nachhaltig verstörend oder sogar lethal.
Der Unterricht litt unter gravierenden Unterrichtsstörungen, die von den Lehrkräften nicht in erforderlichem Maße eingedämmt worden sind. Wie immer totales Versagen der faulen Säcke. Hat sich ja bis heute nichts dran geändert
Ein Wochenende mit einem THW Bergungszug ins Übungsgelände. Mit der gleichen “Infrastruktur”, wie die Helfer. Ich würde das befürworten.
Erstmal klein anfangen:
DUCK AND COVER
“dass in einem Schuljahr in einer Doppelstunde mit älteren Schülern…”
Was soll denn dieser Humbug bringen..
Das ist kein bisschen nachhaltig.
Bestenfalls erhöht es die Unsicherheit.
Wenn die Herren Krieg wollen, dann wäre ZV wie in der DDR angebracht.
Und vor allem sollten die Herren und Damen dann mal selber an die Front.
“Bestenfalls erhöht es die Unsicherheit. ”
*Kicher*
Das ist mit einigen (politischen) Themen so. Insbesondere im Bereich von Populismus.
[Ich gehe davon aus, dass Sie “Schlimmstenfalls” meinen. Oder “Bestenfalls senkt …”]
ZV bedeutete aber “Zivilverteidigung”, hat erstmal nichts mit “Krieg wollen” zu tun, sondern mit “sich im Ernstfall verteidigen/schützen können”.
Gegenstück ZS = Zivildchutz.
BVS = Bundesverband für den Selbstschutz. Heute Aufgabenbereich des BBK. War alles schon mal da.
Ja, Geschichte wiederholt sich manchmal. Aber dank neuer Namen merken viele es nicht. 🙂
Zusammenschluss aus ZV und ZS ist die ZVS – und die ist eine verwaltungsrechtliche Katastrophe, die nur zivile Hochschulen, nicht aber die der BW betrifft. Ob sich letztere vor Zivilisten schützen müssen, ist nicht einmal sicher.
😉
Der Trump hat ja ehrlicherweise sein “Verteidigungsministerium” in “Kriegsministerium” umbenannt…
Dann lässt der Einsatz des Militärs im Inland auf einen Bürgerkrieg schließen und eine Verteidigung der Verfassung kann ausgeschlossen werden.
Was ist denn daran ehrlich, bitte schön?
Das lenkt doch nur den Blick auf die ideologische Verbohrtheit des großen hohlen Kürbises … bald ist Halloween!
Und DumbDonny fliegt durch die Welt, um bei speichelleckenden Angsthasen Geschenke einzusammeln.
Eine Art umgekehrter Santa Claus … mein Gott… wann nimmt der Mann endlich die Einladung zu einer Cabriolet-Fahrt durch Dallas wahr?
Kann sich noch jemand an BVS-Schulungen erinnern, die an Schulen als freiwillige Veranstaltungen angeboten worden sind?
Apropos das GY meiner Jugendzeit hatte ebenso wie die Kreisverwaltung und andere öffentliche Gebäude einen “Knallkeller”.
Die Behörden der Länder und des Bundes hatten eigenständige, behördeninterne Selbstschutzorganisationen, die für Brandschutz und Bergung ausgestattet waren.
Das gewählte Bild bringt das krankhaft und potentiell gefährliche, realitätsferne Denken hinter solchen “Forderungen” perfekt auf den Punkt.
Absolut treffend gewählt, 100%.
Wobei man immer zu zweifeln beginnt, ob die nicht alle KI-generiert sind. “Früher” stand das hier immer noch dran, “jetzt” verdächtigerweise nicht mehr.
Besonders die Superfrau, die mit ihrem Sechskantschlüssel die Infrastruktur repariert und kriegstüchtig macht.
Und ich dachte schon es wäre ein Maulschlüssel:)
Maul- und Klauenschlüssel ?
Stimmt. Wo sind die toten Zivilist*innen, die Russland beschoss?
Und Moment mal! Ich glaube, das ist gar nicht die echte Bekleidung des THW! (augenroll)
Keine Ahnung, wie Sie da jetzt auf die (mittlerweile wohl jedem bekannten) russischen Kriegsverbrechen kommen.
Welche “Krisensituation” soll da sonst dargestellt werden?
Erdbebenzentrum Deutschland? 😉
Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Und das ist leider nicht mal Polemik.
Wenn Sie keine besseren Einfälle haben, nehme ich weiterhin das naheliegenste Szenario.
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_100970066/russlands-cyberangriffe-auf-deutschland-experte-ordnet-die-gefahr-ein.html
https://www.deutschlandfunk.de/russland-nato-kriegsgefahr-deutschland-100.html
“Vorsorge statt Verunsicherung”
Die sollen beim Jahrhunderhochwasser (eher Hochwasser im Hochwasserjahrhundert) selber ein neues Häusle bauen, weil die Politik bei Klimaschäden keine Solidargemeinschaft zusammenbringt – außer bei Ernteschäden jener, die für mehr klimaschädliche Subventionen streiken?
In BW haben wir bereits “Katastrophentage” – auch organisatorisch 😛
Aber da werden Schüler:innen mit ehrenamtlicher und beruflicher vertraut gemacht, lernen das TW kennen etc.
Im Theorieteil könnte ich zum Beispiel über die fast enmalige Stabilität des europäischen Stromnetzes und die letzten fünftausend Aussagen der Union über blackouts richtigstellen…
Sorry fürs venting, bei uns in der Schule hängt ein Plakat, was jede Familie an Vorräten anlegen soll. Das frustet ungemein 🙁
Wurde eigentlich schon erhoben, welche Brücken Panzerbewegungen überhaupt aushalten? Für lkw gibt es ja schon viele Beschränkungen, Panzer und andere Militärfahrzeuge sind noch eine ganz andere Hausnummer.
In Berlin sicher noch nicht. Da wird jetzt erstmal geprüft, ob die Brücken die neuen (teuren) Straßenbahnen aushalten.
So viel schweres Gerät hat das Wachbataillon nun auch nicht. Und gebraucht wird allenfalls der Ring um das Bundeshauotdorf.
https://www.berliner-kurier.de/berlin/die-neue-xxl-strassenbahn-der-bvg-zu-schwer-fuer-berlins-bruecken-li.10002527
Deshalb ja die Infrastrukturmittel aus dem Sondervermögen. Oder hat jemand gedacht, dass damit die Schlaglöcher vor seiner Haustür ausgebessert werden würden?
Und ja, es wurden die Magistralen in west-/östlicher Richtung vom Transportkommando der BW und der NATO in Augenschein genommen, ebenso die parallel verlaufendenden Ausweichrouten. Es wird nicht mehr lange dauern und es wird wieder die alten gelben MLC-Verkehrsschilder (Military Load Classification) geben.
Vor allem auf den Eisenbahntrassen zwischen den Seehäfen im Westen und der östlichen Grenze des NATO-Gebietes gibt es viele Brücken, die statisch unzureichend oder in bedenklichem Zustand sind und deshalb überholt oder neugebaut werden müssen.
Jepp, genau diese Schilder sind mir von früher her noch sehr vertraut … Jetzt, wo du sie erwähnst, realisiere ich, dass ich sie lange nicht mehr gesehen habe.
Also, wir achten mal auf sie und haben damit eine Art “Fiebertermometer für anstehende Krisenzeiten”.
Hat denn jemand der Kollegen in der Ausbildung gelernt, wie man sich im Fall einer Katastrophe verhält???
War ich da krank oder auf dem Klo????
Was tut man im Falle eines Raketenangriffs, einer Flut, eines Blackout???
Mein Wissensstand umfasst die Bestandteile
a) schnell laufen
b) laut um Hilfe rufen.
Das wars!
Kann ich den SuS gerne so weiter geben.
Ja, ich habe Ersatzdienst gem. KatSG geleistet, bevor ich Lehrer geworden bin. Und ich dürfte nicht der einzige gewesen sein.
THW ist unser Leben, THW hat montags zu…
Nee, Betreuungseinheit, Sanitätsdienstorganisation – Unfall ist schon bitter und dann noch …
Punkt A ist schon verkehrt. Die Doktrin lautete “Stay put”.
Du hast das sog “freeze” vergessen…. Ich stelle mich tot . .. wenn die unliebsame Realität mir den Job nicht blöderweise abnimmt.
Völlig off the records, aber ich denke jetzt an Videos von Duck and Cover:
Eine Kombination der Meinung, dass der Atomkrieg unvermeidbar ist, und dem Optimissmus, die Explosion einer Atombombe durch Ducken zu überstehen 😀
Ungeachtet des alltäglichen Wahnsinns, Zivilschutz würde alle betreffen, also auch Schüler*innen. Ungeachtet, wie viele Stunden oder Projekttage da reingehen, das Vertrauen darauf, dass es einen Plan für den Katastrophenfall gibt, kann Stabilität geben… Die Regierung HAT einen Plan, den Sie in diesen Stunden mitgeben will, ja?
*kicher*
*stellt Popcorn bereit*
Wenn sich das Kichern auf den grenzenlos scherägen Pessi- als auch Optimismus von Duck and Cover bezieht, teile ich es uneingeschränkt.
Wenn Sie auf einen Plan der Regierung warten, haben Sie hoffentlich viel Popcorn dabei
Eine Regierung, die nicht mal mit Drohnen- und IT-Provokationen/Wegwerfagenten eines aggressiven 2. Weltlandes umgehen kann mag gerne “Pläne” haben – die sind für mich jetzt nicht soooooo relevant. 🙂
Außerdem ist die Sache in ‘Schland 25 etwas kompliziert:
Wenn ich Wasser, Nahrung, Alltagsbedarf für drei Wochen im Keller hab – bin ich dann “phöser Nahsipreppah” oder “braver Bürger, der auf das Bundesamt für Kaputtgehschutz” gehört hat ?
Ist wieder eine dieser Quantenfragen – die richtige Antwort hängt von Zeitpunkt und Ort der Frage ab. 😀
Genau- diskutieren wir ein wenig, labern also eine Doppelstunde mit den Klassen. Ahnungslos, inkompetent, nicht didaktisch- methodisch aufbereitet, evtl. noch mit Schüler:innen, die durch Kriegs- und Fluchterfahrung traumatisiert sind und getriggert werden könnten. DANKE für einen weiteren populistischen, wirkungs- und verantwortungslosen Schnellschuss aus der Politik!