BERLIN. Die Bildungsministerkonferenz im Rahmen der KMK hat erstmals ein bundesweites „Zielbild zur Rolle und Arbeit der Schulaufsicht“ verabschiedet. Damit liegt nun eine gemeinsame Grundlage dafür vor, wie Schulaufsicht in Deutschland arbeiten soll, welche Aufgaben sie übernimmt und welche Haltung und Kompetenzen dafür entscheidend sind – zumindest in der Theorie.

Michael Bax, Schulleiter der Leonore-Goldschmidt-Schule in Hannover-Mühlenberg, hat sich längst seine eigene Meinung über die deutsche Schulaufsicht gebildet. Sie fällt – freundlich formuliert – verhalten aus. „In Niedersachsen erlebe ich die Schulaufsicht oft als reine Kontrollinstanz. Das ist enttäuschend, weil ich denke, dass dort viel mehr möglich wäre“, schreibt Bax in einem im vergangenen Dezember auf dem Deutschen Schulportal erschienenen Kommentar. „Meist treten die Schulaufsichtsbeamten nur in Erscheinung, wenn es um formale Prozesse geht – etwa bei der Weiterleitung von Meldungen an das Kultusministerium. Inhaltlich passiert wenig. Häufig scherzen wir, die Schulaufsicht sei nicht mehr als ein ‚hochbezahlter Postbote‘.“
Bax ist kein Querulant, sondern ein erfahrener Schulleiter, der weiß, wovon er spricht. Seine integrierte Gesamtschule liegt in einem sozial herausfordernden Stadtteil, Innovation und Kooperation sind für ihn tägliche Notwendigkeit. Was er vermisst, ist eine aktive, beratende Schulaufsicht, die Schulen bei der Entwicklung unterstützt: „Sie hat den Überblick über viele Schulen und könnte uns durch Impulse und Ideen unterstützen. Warum bringt sie nicht die Erfahrungen aus anderen Schulen ein, schlägt Kooperationen vor oder hilft uns bei komplexen Entwicklungsfragen?“
„„Ich frage mich manchmal, ob wir die Schulaufsicht in ihrer jetzigen Form überhaupt brauchen“
Ob sich das nun ändern wird? Die Bildungsministerkonferenz (BMK), die im Rahmen der KMK tagenden Runde der Schulministerinnen und Schulminister also, hat nun erstmals ein bundesweites „Zielbild zur Rolle und Arbeit der Schulaufsicht“ verabschiedet. Das Papier, das den Ländern als gemeinsame Grundlage dienen soll, beschreibt detailliert, wie Schulaufsicht künftig arbeiten und wahrgenommen werden soll. Es geht um nichts Geringeres als die Neudefinition eines zentralen Steuerungsinstruments des Bildungssystems.
In der Vorbemerkung heißt es programmatisch, die Schulaufsicht solle „handlungssicher und zeitgemäß die Verantwortung für die Erfüllung ihres Auftrags verlässlich übernehmen können“. Damit soll „ein gemeinsames Verständnis über die Rolle und Arbeit der Schulaufsicht“ geschaffen werden, um Prozesse länderübergreifend zu vereinfachen. Zugleich betont das Papier die Notwendigkeit der Kooperation: „Diese Herausforderungen können nur durch eine Zusammenarbeit der Schulen mit allen Partnern bewältigt werden – etwa in der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe sowie weiteren Partnern im Sozialraum.“
Die BMK beschreibt die Schulaufsicht als eigenständiges Berufsfeld, das durch vier zentrale Säulen geprägt ist: Haltung, Aufgaben, Kompetenzen und Instrumente. Diese Struktur soll künftig die Arbeit in allen Bundesländern leiten.
„Die Schulaufsicht berät und stärkt gemeinsam mit den Unterstützungssystemen die Schulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben”
Zentraler Gedanke der Haltung ist das Bekenntnis zur „Steuerungsverantwortung in einem umfassenden Sinne“. Schulaufsicht, so das Papier, sei authentisch, handele empathisch und konsequent – und richte sich an übergeordneten Zielen aus: Kompetenz- und Leistungsentwicklung, Bildungs- und Chancengerechtigkeit sowie Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler. Bemerkenswert ist die Betonung des partnerschaftlichen Ansatzes: Um „die Ziele einer gerahmten Eigenverantwortlichkeit der Schule zu realisieren“, müssten Schulaufsicht und Schulleitungen „in gemeinschaftlicher Verantwortung eng zusammenarbeiten“. Hier setzt die KMK deutlich auf Kooperation statt Hierarchie – und damit genau auf das, was Bax seit Jahren vermisst.
In der zweiten Säule verweist das Zielbild zunächst auf die verfassungsrechtliche Grundlage: „Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates“ (Art. 7 GG). Diese Schulaufsicht umfasse Dienst-, Fach- und Rechtsaufsicht. Neu ist jedoch die Betonung der beratenden und unterstützenden Rolle. Wörtlich heißt es: „Die Schulaufsicht berät und stärkt gemeinsam mit den Unterstützungssystemen die Schulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere bei der Wahrnehmung der schulischen Eigenverantwortlichkeit, bei der Entwicklung von Schulprogrammen, bei der internen und externen Evaluation und der Fortbildung der Lehrkräfte.“
Damit, so könnte man sagen, reagiert die KMK direkt auf die Kritik aus der Praxis. Denn Bax fordert genau das: regelmäßige Schulentwicklungsgespräche, „um gemeinsam Ziele für die Schule zu definieren, Entwicklungsfelder zu identifizieren und Unterstützungsbedarfe zu klären“.
Das Zielbild konkretisiert die Aufgaben weiter: Schulaufsicht solle die Schulen „zielorientiert, kooperativ, kommunikativ, ermutigend und wertschätzend begleiten“. Sie unterstütze unter anderem bei Qualitätsentwicklung, Personalplanung, Krisenmanagement und Kooperationen. Darüber hinaus fordert das Papier klare Rollen, Verantwortlichkeiten und ein „gut funktionierendes systemisch-strukturelles Zusammenspiel“. Schulaufsicht, Schulleitungen, Qualitätssicherung und Unterstützungsstrukturen müssten „in einer geordneten Verantwortungsarchitektur“ zusammenwirken.
Die dritte Säule formuliert die Anforderungen an die handelnden Personen. Schulaufsicht sei Führungsarbeit, heißt es. Sie müsse tragfähige Arbeitsbeziehungen aufbauen, „die durch Vertrauen und Transparenz gekennzeichnet sind“, wertschätzend kommunizieren und konstruktives Feedback geben können. Zu den zentralen Kompetenzen zählen außerdem die Fähigkeit, Kooperationen zu fördern, rechtliche und organisatorische Anforderungen zu erfüllen und „auf der Grundlage systemischen Denkens angemessenes schulaufsichtliches Handeln zu planen, zu begründen und umzusetzen“.
Interessant ist der Hinweis auf die „horizontale Beratung“ – also Gespräche auf Augenhöhe zwischen Schulaufsicht und Schulleitung. Auch dies ist eine klare Abkehr vom traditionellen, hierarchisch geprägten Aufsichtsverständnis, das Bax kritisiert: „Gespräche sollten auf Augenhöhe stattfinden. Schließlich sind Schulaufsichtsbeamte meist ehemalige Lehrkräfte oder Schulleitungen wie wir.“
„Ein wichtiger Beitrag zur Schulqualität ist die Befähigung der Schulaufsicht als Führungskraft und ihr Umgang mit den Zukunftstechnologien“
In den abschließenden Empfehlungen wird es konkreter. Die KMK fordert, die Schulaufsicht müsse „mit adäquaten finanziellen, räumlichen und personellen Ressourcen organisiert“ werden. Zudem solle sie professionalisiert werden – durch systematische Fort- und Weiterbildung, auch schon vor Amtsantritt. Denn, so das Papier: „Ihre Professionalität wirkt sich maßgeblich auf die Leistungsfähigkeit des Systems aus.“
Ein weiterer Punkt betrifft die Digitalisierung: „Ein wichtiger Beitrag zur Schulqualität ist die Befähigung der Schulaufsicht als Führungskraft und ihr Umgang mit den Zukunftstechnologien, um gemeinsam mit der Schulleitung datengestützt die Schul- und Qualitätsentwicklung erfolgreich zu gestalten.“ Schließlich plädiert die KMK für eine klare Aufgabenteilung und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schulaufsicht, Schulleitungen und Unterstützungssystemen. Diese Kooperation sei „das Fundament für ein effektives und effizientes Zusammenwirken im Rahmen einer ganzheitlichen Bildung in gemeinschaftlicher Verantwortung.“
Für Praktiker wie Michael Bax dürfte die große Frage bleiben, ob diese Ambitionen tatsächlich in den Schulalltag vordringen. „Unsere Aufsichtspersonen haben oft wenig Ahnung von den Besonderheiten der einzelnen Schulformen“, kritisiert er. „Viele kommen aus dem Gymnasialbereich und wissen nichts über integrierte Gesamtschulen. Das macht die Zusammenarbeit schwierig.“ Seine Erfahrung steht damit exemplarisch für die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Brax: „Ich frage mich manchmal, ob wir die Schulaufsicht in ihrer jetzigen Form überhaupt brauchen. Viele von uns Schulleitungen könnten die Aufgaben selbst übernehmen – oder direkt mit dem Ministerium zusammenarbeiten. Wenn es Schulaufsicht geben soll, dann muss sie anders arbeiten: kreativer, gestaltender und vor allem mit einer klaren Beratungsrolle.“ Immerhin: Diese Ansprüche sind nun offiziell. News4teachers
Hier geht es zu den vollständigen Leitlinien.
“Äußert sich ein Lehrer kritisch, meldet sich die Schulaufsicht und droht”







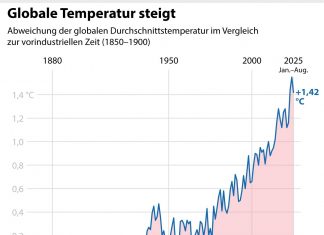


Alle meine bisherigen Schulleitungen waren um jeden Tag froh, an dem das Schulamt nichts von ihnen wollte.
Was verspricht man sich bitte davon?
Im Schulamt sitzen Menschen ohne Ambition mit dem Gemüt eines Hängeregisters.
Lasst doch bitte um Himmels Willen die Schulräte weiterhin mit A16 in ihrem Büro „arbeiten“. Was abheften oder so. Irgendwas, das niemandem schadet.
Wenn diese Gestalten sich „konstruktiv“ in Schulentwicklung einbringen, kann man sicher sein, dass keine stattfindet. Außer auf der Homepage und einmal für den Fototermin.
Lass mal stecken!
A 16 ist dafür zu viel Geld.
Ich würde vorschlagen, dass das Abheften von irgendetwas in einem Büro mit einer kommunikativen Arbeit kombiniert werden sollte: 18 Stunden Büro 23 Stunden in der Schule unterrichten. Das wäre winwin für fast alle.
Witzig. Die Menschen ohne Ambitionen mit dem Gemüt eines Hängeregisters sind oft eh schon in irgendwas mit Schule tätig.
Based +1
Da muss ich jetzt mal widersprechen: Selbst zum Abheften sind sie nicht zu gebrauchen! Als ich mir meine Akte angeschaut habe, war ich entsetzt, wie schlampig sie geführt wurde,- das hätten meine Viertklässler besser hingekriegt!
Ich habe Schulaufsicht immer nur als Behinderung unserer Arbeit erlebt, nicht mal Bewerbungsverfahren konnten sie rechtskonform und angemessen durchführen.
Wenn man die Schulen wirklich entlasten und pädagogisch sinnvoll arbeiten lassen will, sind Schulämter einfach nur störend!
Und wo arbeiten dann die vielen toxischen Persönlichkeiten, die aktuell in der Schulaufsicht tätig sind?
Darauf haben alle gewartet, endlich! Welch ein Durchbruch! Die revolutionäre Erneuerung der Schullandschaft ist nicht mehr aufzuhalten! Endlich, nach langem Warten, melden sich die erfahrensten Praktiker des Schuldienstes und bringen Überblick und Erfahrung ein.
Oder wir nehmen die Leitlinien und spielen in der nächsten Konferenz Bullshit-Bingo.
Diese tollen Schulentwicklungsgespräche mit dem Schulrat bringen doch eh nichts. Viele SchulleiterInnen möchten gut dastehen und so werden Probleme unter den Teppich gekehrt und gar nicht erst erwähnt und alle sind froh, wenn der Schulrat wieder weg ist.
Von der allseits gefürchteten und arbeitsintensiven QA braucht man auch gar nicht erst anfangen..das bringt die Schulen nicht weiter und das dort gebundene Personal wäre als LehrerIn in den Schulen besser aufgehoben.
Die QA ist eine reine PR Kampagne und Beschäftigungsmaßnahme. Schulen und insbesondere Schulleitungen machen sich dabei viel zu viel Stress.
Einfach bei “QA” alles weitermachen wie zuvor.
Es hat keinerlei (ernsthafte) Folgen, es wird nur geredet.
Es dauert alles einfach immer zu lange
Warum beginnt die KMK nicht erst einmal damit, die regionalen Schulaufsichten auf einen “gemeinsamen Nenner” zu bringen?
https://www.schulaufsicht.de/beitrag/der-strukturelle-rahmen-fuer-die-schulaufsicht-in-deutschland/
https://www.juraforum.de/lexikon/schulaufsichtsbehoerde
Wäre es nicht höchste Zeit, die “Kleinstaaterei” im Bildungssystem erst einmal zu beenden? Danach könnte die KMK vielleicht wirklich mehr erreichen als nur Papiere mit schönen Worten zu verabschieden, die im Moment jeder “Fürst” nach seinem Gutdünken,nach den Gesetzen seines Bundeslandes, seiner Kommune auslegen kann.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinstaaterei
https://geschichte-wissen.de/blog/kleinstaaterei-thueringen-1700-regionalgeschichte/
Hier noch die Quelle des Zitats:
https://www.news4teachers.de/2025/10/kulturrat-gegen-genderverbote-in-der-juengeren-generation-vielfach-etabliert/#comments