DRESDEN. Lehrkräfte in Deutschland sind sehr unterschiedlich zeitlich belastet, trotz formal gleicher Arbeitszeit. Das illustriert aktuell der Abschlussbericht der Arbeitszeituntersuchung (AZU), die das Sächsische Kultusministerium in Auftrag gegeben hat. Die Ergebnisse der AZU hinsichtlich der gemessenen Gesamtarbeitszeit sind umstritten (News4teachers berichtete). Als gesichert kann aber die aufgezeigte erhebliche Ungleichverteilung der Arbeit gelten. Unterschiede gibt es demnach nicht nur zwischen den Schulformen – sondern auch schon zwischen den Fächern.
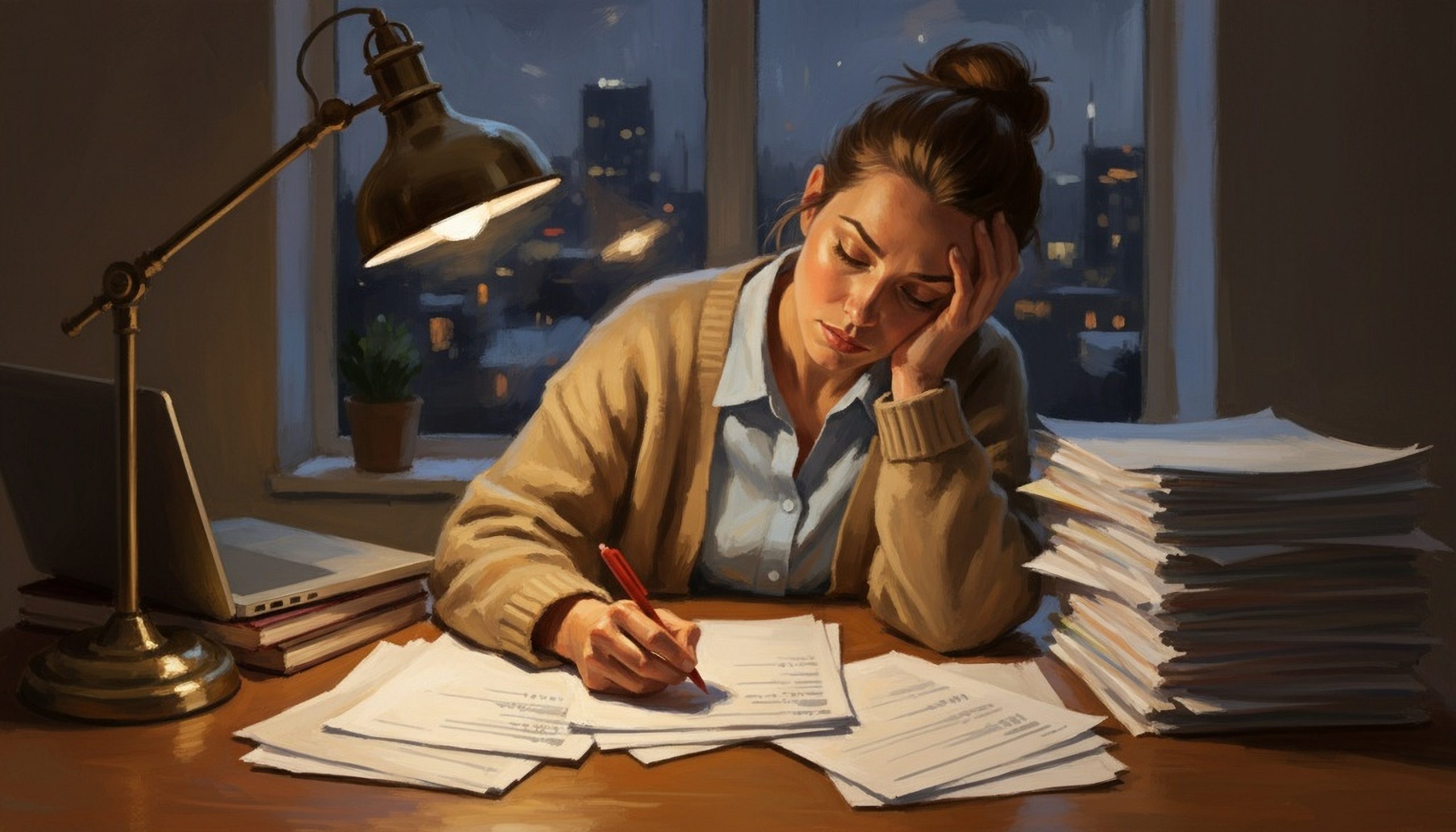
Lehrkräfte leisten nicht alle gleich viel – und das hat System. Der Abschlussbericht der Arbeitszeituntersuchung (AZU) in Sachsen zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Schularten und Fächergruppen.
Laut Bericht liegt die durchschnittliche Arbeitszeit von Vollzeitkräften in Schulwochen an Gymnasien und beruflichen Schulen deutlich über jener an Grund- oder Förderschulen. Der Bericht hält fest: „Knapp 30 Prozent der Vollzeitlehrkräfte arbeiteten zwischen 40 und 44 Stunden pro Schulwoche, weitere knapp 30 Prozent lagen über 44 Stunden, rund 12 Prozent überschritten sogar die Marke von 48 Stunden.“
Damit arbeitet mehr als jede zehnte Lehrkraft im Beobachtungszeitraum regelmäßig über 48 Stunden pro Woche. Zugleich zeigen die Daten eine große Streuung – der Bericht spricht von „großen Unterschieden zwischen den Arbeitszeiten der einzelnen Lehrkräfte“. Gymnasiallehrkräfte überschritten laut Kurzbericht ihr Soll „häufiger und in höherem Ausmaß als andere“. Bei Lehrkräften an berufsbildenden Schulen und Förderschulen fielen die Arbeitszeitbilanzen „ausgeglichener“ aus.
Unterschiede nach Fächern und Aufgaben
Die Untersuchung zeigt darüber hinaus, dass sich die Arbeitszeiten auch innerhalb der Schularten deutlich unterscheiden. So heißt es im Bericht: „Daneben zeigten sich bei einzelnen berufs- oder schulbezogenen Faktoren, wie zum Beispiel die Ausübung einer Klassenleitung oder der Unterricht in den Fächern Deutsch oder MINT, signifikante Zusammenhänge mit höherer Mehrarbeit.“
Mit anderen Worten: Lehrkräfte in bestimmten Fächern und mit zusätzlichen Funktionen arbeiten nachweislich länger.
Der Bericht fasst zusammen: „Ein zentrales Ergebnis waren die großen Unterschiede zwischen den Arbeitszeiten der einzelnen Lehrkräfte.“ Diese Unterschiede hängen – so wird betont – nicht mit individuellen Arbeitsweisen zusammen, sondern mit den Strukturen schulischer Arbeit und der ungleichen Verteilung von Aufgaben.
Rackles: „Das Deputatsmodell ist ungerecht“
Diese strukturelle Schieflage hatte bereits ein Gutachten des früheren Berliner Bildungsstaatssekretärs und heutigen Bremer Bildungssenators Mark Rackles (SPD) aus dem Jahr 2023 beleuchtet. Rackles analysierte darin im Auftrag der Telekom Stiftung die Lehrerarbeitszeit in Deutschland insgesamt – und sprach von einer „strukturell ungerechten Verteilung“. Er betonte: „Lehrkräfte leisten zwar formal die gleiche Wochenstundenzahl, faktisch aber höchst unterschiedliche Gesamtarbeitszeiten. Die Gleichbehandlung im Deputat führt zu realer Ungleichbehandlung.“
Rackles argumentierte, dass das gegenwärtige System der Unterrichtsverpflichtungen die komplexe Realität der Lehrerarbeit nicht abbildet. Während alle Lehrkräfte dieselbe Zahl an Unterrichtsstunden zu leisten haben, unterscheide sich der tatsächliche Zeitaufwand je nach Fach, Schulart und Zusatzverantwortung erheblich. „Die derzeitige Deputatsregelung berücksichtigt Korrekturaufwand, Abiturprüfungsvorbereitung, Projektkoordination oder Elternarbeit in keiner Weise ausreichend“, schrieb er.
Er nannte drei Hauptquellen der Ungerechtigkeit:
- Fachabhängiger Zeitaufwand – Korrekturfächer mit schriftlichen Prüfungen verursachen überdurchschnittlich viel Nacharbeit.
- Ungleichgewicht zwischen Schularten – Lehrkräfte an Gymnasien und beruflichen Schulen leisten deutlich mehr Stunden, ohne entsprechenden Ausgleich.
- Mangelnde Erfassung außerunterrichtlicher Tätigkeiten – insbesondere Schulentwicklung, Inklusion, Elternkommunikation und Ganztagskoordination.
„Die ungleiche Belastungsverteilung ist nicht nur pädagogisch, sondern auch arbeitsrechtlich problematisch“, heißt es in seinem Gutachten. „Gleiche Unterrichtsverpflichtung darf nicht länger als Synonym für gleiche Arbeitsbelastung gelten.“ Rackles plädierte für eine grundlegende Neuordnung der Lehrerarbeitszeit: „Die Zuweisung von Arbeitszeit nach Deputatstunden ist international überholt und abzulösen durch ein neues Zuweisungsmodell mit höherer Transparenz und Gerechtigkeit.“
Er schlug ein Jahresarbeitszeitmodell vor, das alle Tätigkeiten erfasst – Unterricht, Korrekturen, außerunterrichtliche Aufgaben – und in dem fächer- und schulartspezifische Unterschiede verbindlich berücksichtigt werden. „Nur wenn die reale Arbeitszeit differenziert erfasst und gesteuert wird, kann eine gerechte Verteilung erreicht werden“, schrieb Rackles. „Das jetzige System erzeugt strukturelle Mehrarbeit für bestimmte Gruppen von Lehrkräften, ohne dass dies sichtbar oder ausgleichbar wäre.“ Und das sei, so Rackles, „weder rechtlich noch pädagogisch zu rechtfertigen“.
Die sächsische AZU bestätigt den Befund. Das Fazit der Autoren lässt keinen Zweifel: „Das Deputatssystem bildet die Vielfalt der Tätigkeiten und Anforderungen nicht adäquat ab.“ News4teachers
Hier lässt sich das vollständige Gutachten von Mark Rackles herunterladen.










Klar, die Lehrkräfte an GS und FöS sind mit A13 überbezahlte Teilzeitkräfte.
Und jetzt wundern sich vermutlich alle, warum bei der hohen Belastung so viele Lehramt für die SekI+II studieren. Alles Masochist*innen, ich sag’s euch.
In den Debatten damals hieß es immer, “keiner” wolle mehr Grundschullehrer werden, weil die weniger verdienen als die anderen Lehrämtler. “Gegner” sagten immer, die meisten Lehrer haben sich die Schulart und die Fächer nach Neigung ausgesucht und nicht nach dem Gehalt. Ihre Ausführungen kann man auch als Bestätigung verstehen.
Nur bei der Forderung nach A13 ging es primär nicht um die Bezahlung sondern um die Anerkennung des Hochschulabschlusses als Grundlage für den Einstieg in die Laufbahngrupp II, zweites Einstiegsamt nach bestandenem Vorbereitungsdienst. Nach wie vor ist es ja so, dass – hier in NRW – die GS-Lehrkräfte sowie Lehrkräfte an HS und RS 2,5 Deputatsstunden mehr unterrichten müssen als Gymnasial-, Berufsschul- und Gesamtschullehrkräfte. Bei 40 Unterrichtswochen sind das also 100 Deputatsstunden mehr. Das entspricht dann unabhängig von der Ratszulage einer 9,8% niedrigeren Vergütung bei gleicher Eingruppierung.
Hinzu kommt, dass vor allem GS-Lehrkräfte häufig ihre Wochenstundenzahl an die des Jahrgangs anpassen müssen, in dem sie eingesetzt sind, da das Lehrerdeputat höher ist als die Unterrichtsstundenzahl der SuS. Das betrifft nicht unbedingt jede sondern betrifft die Anzahl der Lehrerstunden an den Unterrichtsbedarf in Abhängigkeit von der genehmigten Stellenzahl.
„Das entspricht dann unabhängig von der Ratszulage einer 9,8% niedrigeren Vergütung bei gleicher Eingruppierung.“
Das ist falsch. Die Arbeitszeitstudien belegen, dass Gymnasiallehrkräfte TROTZ geringeren Deputats eine höhere durchschnittliche Wochenarbeitszeit haben als Grundschullehrer. Hätten beide dasselbe Deputat, würde die Schere noch weiter auseinandergehen. Die gleiche Eingruppierung ist logisch, gleiches Deputat nicht.
Dann heulen Sie nicht und wechseln an eine GS.
Wow, welch erwachsene und sachliche Antwort
Nicht ich heule, sondern Sie trollen.
Warum? Sie waren mal ein angenehmer Gesprächspartner.
An der Grundschule haben wir schon allein 5 Unterrichtsstunden mehr pro Woche. Dass Lehrkräfte am Gymnasium mehr Korrekturzeiten haben, ist unstrittig. Ich glaube aber schon, dass ein Vormittag mit Grundschülern fordernder ist als ein Oberstufenkurs.
Nun ja, ich denke eher, dass sich das nichts nimmt. 30 Leuten Mathe beizubringen, die zu großen Teilen keinen Bock haben (ja, das ist die Regel im Grundkurs), ist ein hartes Brot. Noch härter sind pubertierende 8-9 – Klässler…
Wie gesagt, ich denke, das Stresslevel ist vergleichbar.
Puuuuuuh, bitte mal einen Vormittag in einer Grundschule hospitieren. Ich bin ja sehr für Lehreraustausch zwischen den Schulformen.
Oka, mach ich am 1.11.:)
Das geht in diesem Jahr nicht mal in Niedersachsen, Allerheiligen fällt auf den Sonnabend.
Spielen wir jetzt das Spiel „Schlimmer geht immer?“ 😉
Nein PRIMUS-Schule, die volle Leidenstour von 1 bis 10. Müsdte also noch um drei Jahrgangsstufen aufgestockt werden.
Ich gebe Ihnen recht, was soll diese Diskussion? Ich habe an der Berufsschule und am Fachgymnasium unterrichtet, ganz bewusst. Wir sollten mehr Respekt gegenüber der Arbeit anderer haben, wenn sie gute Arbeit leisten und auch diese gern tun. Psychologen würden sagen, es tut den Menschen nicht gut, sich ständig mit anderen zu vergleichen.
Ich habe, da seinerzeit in einem Schulverbund angestellt, zwischenzeitlich auch mehrere Jahre in dessen Grundschulbereich gearbeitet. Von daher: ich weiß schon, wovon ich schreibe.
Und Sie?
Ach Frau Kollegin, ich habe ein Jahr GS gemacht als Gym Lehrer. Ist nicht einfach, ist anstrengender als Sek 1 und sek 2 zu unterrichten, ganz klar. Aber warum muss denn das eigene immer das anstrengendste sein? Kann man nicht anerkennen, dass wir am Gym es auch nicht leicht haben? Muss es denn dauernd ein Wettkampf sein? Ich korrigiere weit mehr als Sie, meine Ferien sind weitestgehend verplant. Natürlich ist es gechillter mit 10. Klässlern zu arbeiten, die schreiben aber auch Tests und Übungsaufsätze auf ganz anderem Niveau als ein Drittklässler. Einigen wir uns doch drauf, dass unsere Jobs beide nicht leicht sind? Dieses ewige gegeneinander der Lehrerschaft hilft doch am Ende immer nur den Kultusministerien, um uns dann öffentlichkeitswirksam gegeneinander auszuspielen
Puuh, dann kommen Sie gerne in fünften bis neunten Klassen vorbei. Sie werden sich wundern. Auch auf dem Gymnasium. Erst gestern sagte mir ein “verhaltensorigineller” Schüler zu einem Film, er könne sich da einen “wixen”. Gymnasiales Niveau. Nur ein Beispiel.
Nun, ich kann tatsächlich beides vergleichen (ziemlich genau 50:50-Abordnung, Vollzeit, Gy + GS NRW). Von dem Stress- und Lautstärkepegel einer 28-köpfigen 3./4.-Klasse, die man im Laufe eines Vormittags (Hohlstunden gibt’s nicht) mit erheblichem Mehraufwand im Classroom Management durch unterschiedliche Fächer schleust, macht man sich als Gy-Lehrer tatsächlich keine Vorstellung. Auch nicht bei anspruchsvollen 8./9. Klassen – die darf man idR nach einer Stunde oder einer Doppelstunde wieder verlassen… Und EF-Grundkurse mögen sich zwar fachlich schwer tun, haben aber immerhin eine Arbeitshaltung entwickelt (oder können diese mit sanftem Druck zumindest einnehmen), bei der man insgesamt sein Stoff-Soll durchziehen kann.
Nun, ich hab das anders empfunden als Sie. Das mag auch damit zusammenhängen, dass ich in meinen Grundschulklassen innerhalb von vier Wochen tatsächlich eine ARBEITSathmosphäre im Raum hatte: lautes Geschreie oder Gerufe gab es bei mir nicht während des Unterrichts. Ich habe allerdings erstmal Klasse zwei unterrichtet: über Erstis kann ich keine Aussagen treffen.
Was ist ein EF-Grundkurs?
„Erst ab Klasse 2“ sollte dort stehen.
Ich war SekI-Lehrkraft an einer GE in NRW. Vollzeit privilegiert, da GE-Lehrer auch bis Jhg. 10 wie Lehrkräfte der SekI+II ein Deputat von 25,5 Tunden haben, im Gegensatz zu den GS-Lehrkräften die 28,0 Stunden unterrichten müssen. So kommen die annähernd 10% Gehaltsdifferenz ohne Berücksichtigung der Ratschläge zustande.
Ich habe im Zuge des Vorbereitungsdienstes die Befähigung für das Lehramt GHR mit dem Schwerpunkt HRGe erworben. Zum Vorbereitungsdienst gehörte ein Pflichtpraktikum an einer GS. Deshalb weiß ich aus eigener Erfahrubg, warum ich mich für die SekI und nicht für die Primarstufe entschieden habe.
Diese ganzen Abkürzungen….wer soll die alle kennen? Finde ich arrogant….bin vielleicht auch entweder zu alt oder schon zu lange raus….
Nein, nicht unbedingt. Das hängt von der Klasse/ dem Kurs ab! Natürlich darf man auch da die Vor-und Nachbereitung der Stunden nicht außer Acht lassen. Fachlich und methodisch-didaktisch leider überhaupt nicht vergleichbar. – Außerdem gibt es am Gymnasium nicht nur Kurse, sondern auch 5./6. Klassen, die je nach Grundschule gewissenhaft aufs Gymnasium vorbereitet wurden oder eben nicht. Auch Gymnasiallehrer in Sachsen setzen sich zunehmend mit Zuständen auseinander, die so nicht mehr lange ertragbar sind.
Der Oberstufenkurs braucht aber mehr Vor- und Nachbereitung, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Komma, weill…
Jetzt vergessen Sie aber “nebenbei”, dass wir ja auch fünfte und sechst Klassen haben, und siebte und achte und neunte in der Vollpubertät. Ich weiß nicht, was da anstrengender ist. Bei Hospitationen in der GS in der Klasse meines Sohnes fand ich dessen Klasse jedenfalls nicht unbedingt anstrengender.
Es geht doch nicht um Heulen, sondern um den Fehler in der Argumentation.
Welches Argument ist denn falsch?
Die Gymnasiallehrer, die an unsere Grundschule abgeordnet waren, sind alle sang- und klanglos baden gegangen. Dabei waren es Sport – und Musiklehrer. Die Lieblingsfächer der Kinder….
Ich würde gerne mal GS Lehrkräfte sehen, wenn sie Aufsätze der Oberstufe korrigieren müssten
Meinen Sie, das könnten wir nicht?
Und wie stehts mit Ihnen? Können Sie Physikklausuren korrigieren, oder Geschichtsklausuren, oder jegliche Klausuren, die gerade nicht Ihre Fachbereiche sind?
überheblicher Idiot!
Da Ihr Leseverständnis wenig ausgeprägt zu sein scheint, da sie nicht den Post in den Kontext einbezogen haben und dann ein ad hominem brauchen, spreche ich zumindest ihnen die Kompetenz ab
„Ihnen“ bitte!
O ja, ich auch…..
Tja, ich war als Sek I/II Lehrkraft an eine Grundschule abgeordnet (freiwillig) und die wollten mich am liebsten behalten. Mir hat es dort auch sehr viel Spaß gemacht und meinen Horizont erweitert. Ich habe übrigens Deutsch und Sachkunde (-> fachfremd) unterrichtet.
Was sagt uns das jetzt? Zwei Geschichten aus dem Nähkästchen…
Mit anderen Worten sagt uns das gar nix!
Das möchte ich aber bezweifeln mit den Lieblingsfächern. Das ist wie in anderen Fächern auch, manche mögen sie, andere nicht……Kommt auch immer drauf an, was vorher dort im Unterricht gelaufen ist bzw. ob es überhaupt Unterricht gab…..
Ich hüte mich normalerweise vor abwertenden Urteilen, aber wer als ausgebildeter Sportlehrer an einer Grundschule versagt, hat seinen Beruf verfehlt.
Weil Grundschule ja bekanntlich jeder kann, ne.
Kollegiale Grüße von der entspannten Basis
Hirnloses ad hominem. Gratuliere
Da können Sie einmal sehen, welche langfristigen Folgen ein Beschäftigungsverhältnis im ÖD hat. bei beginn das gehirn in der Hutablage verstauen und nicht – wie im eigenen Fall – vergessen, es mit dem Eintritt in den Ruhestand wieder mitzunehmen.
„Hinzu kommt, dass vor allem GS-Lehrkräfte häufig ihre Wochenstundenzahl an die des Jahrgangs anpassen müssen, in dem sie eingesetzt sind, da das Lehrerdeputat höher ist als die Unterrichtsstundenzahl der SuS.“
Also nein, das stimmt doch nicht. Niemand wird gezwungen in TZ zu arbeiten, nur weil er in Klasse 1 eingesetzt wird und dort nur 20 – 22 Stunden stattfinden. Alle Kollegen werden gemäß ihres Deputats eingesetzt, welches mit entsprechenden Anträgen jährlich geändert werden kann (also theoretisch). Aber das geschieht auf Betreiben der Kollegen und nicht auf Betreiben der Schule und korreliert schon gar nicht mit der zu unterrichtenden Klassen (-Stufe).
Mal als Verständnisfrage: wenn alle Kollegen Vollzeit arbeiten würden, hätten Sie rein planerisch doch ein Riesenproblem?
Beispiel: zweizügige Grundschule, Jahrgänge 1-4, Sie brauchen durchgehend 8 Kollegen, damit jede Klasse betreut ist. Klasse 1 – 20 Wochenstunden, 2 – 25 Wochenstunden usw. Am Ende haben Sie weniger Wochenstunden Unterricht, als durch die 8 Kollegen in Vollzeit anfallen. Ihnen wird also mindestens ein Kollege abgezogen. Wie betreuen Sie dann dessen Klasse? Unsere Grundschulen hier können nur durch Teilzeitkräfte funktionieren!
Ja, dann hätten wir ein riesiges Problem….an meiner alten Schule gab es für ein Jahr bis auf eine Ausnahme nur VZ-Kräfte und ich durfte deswegen eine doppelte Klassenführung übernehmen, da nicht genug Köpfe da waren…..
Und genau, GS und ich würde auch behaupten alle Schulen funktionieren nur mit TZ-Kollegen, weil es sonst zuwenig Köpfe gibt…..daher ist es auch Wahnsinn alle Kollegen in die VZ zu zwingen….macht überhaupt keinen Sinn.
Eben darauf hatte ich abgespielt. Ich habe auch nie behauptet, dass der Dienstherr die Lehrkräfte zwingt ihre Stundenzahl zu reduzieren. Der “Druck” entsteht durch die Sachzwänge, also Kopfzahl auf der einen und Lehrerstundenzahl auf der anderen, um doppelte Klassenleitungen zu vermeiden. Der kollegiale Druck ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Da bedarf es nicht einmal einer SL, die sich einmischt.
Bei uns wird niemand gezwungen zu reduzieren oder aufzustocken….das ist die persönliche Entscheidung eines AN. Wie bitte, sollte der kollegiale Druck wirken? Wer macht den?
Sorry, aber hier liegen Sie falsch.
Wissen Sie wie die Urlaubsabsprachen in Betrieben laufen, also wer wann und wie lange in den Urlaub gehen kann?
Dann können Sie nachvollziehen, wie sich solche Prozesse entwickeln bzw. wie sie ablaufen.
Urlaubsabsprachen sind aber keine Deputatsentscheidungen…..der Vergleich hinkt gewaltig. Wie soll denn nun der Druck beim Deputat aussehen?
Klar, fragen wir als SL auch mal nach, ob Interesse besteht die oder andere Stunde zu erhöhen, aber wenn die Antwort „Nein“ ist, dann ist das so…..dadurch hat die Kollegin dann keine Nachteile….und wir gehen ganz sicher davon aus, dass die Kollegin schon ihre Gründe haben wird….
Nun gut, ihre Erfahrungen als Führungskraft sollte man respektieren. Aber , wenn die Schülerzahlen sinken, dann können auch AN in die Teilzeit gezwungen werden. In Mecklenburg- Vorpommern wurde das über Jahre praktiziert. Ich hätte mir gewünscht, dass man derartige Zeiten nutzen würde, um qualitativ zu arbeiten, zum Beispiel die Lehrpläne etc. zu überarbeiten. Nun steht man in diesem Bundesland wieder vor dieser Situation, jedoch beginnend in den Kitas. In einigen Jahren dann ein Schulproblem. Es werde es beobachten.
dickebank:
„Hinzu kommt, dass vor allem GS-Lehrkräfte häufig ihre Wochenstundenzahl an die des Jahrgangs anpassen müssen, in dem sie eingesetzt sind, da das Lehrerdeputat höher ist als die Unterrichtsstundenzahl der SuS.“
Ja, was bedeutet dann dieser Satz?
Woher kommt die hohe TZ-Quote u.a. bei Lehrkräften im Primarbereich?
Ist das die Antwort auf meine Frage?
Weil es fast unmöglich ist, in der Grundschule bei guter Gesundheit Vollzeit zu arbeiten.
Das ist aber kein typisches GS-problem.
Alternative: Die überwiegend Zahl der LK in der Grundschule sind Frauen. Wenn da Kinder kommen, ist es leider immer noch üblich, dass die Mütter reduzieren und nicht die Väter in ihren ach-so-wichtigen Karrieren.
Wieso nur in der Grundschule…..Vollzeit arbeiten plus Wochenenden voller Korrekturen kann einen auch ganz schön kaputt machen…
Viele arbeiten aus familiären Gründen in Teilzeit. Einige Kolleginnen aber auch, weil sie es durch die hohe Arbeitsbelastung/Stress/mentale Forderung nicht schaffen, Vollzeit zu arbeiten.
“Das ist kein GS-typisches Problem”, “die hohe TZ-Quote u.a. bei Lehrkräften im Primarbereich” – noch deutlicher kann man doch nicht werden.
Ich selbst habe aus familiären Gründen ein Jahr Teilzeit mit halber Stelle (13/25,5) unterrichtet – und ich war nicht an einer GS.
Aber fehlen nicht Lehrkräfte für den OGT?
Wieso? Die OGS-Stunden sind in den Mehrbedarfen mit eingerechnet…..eigentlich sollten sie vorhanden sein…..Fakt ist natürlich, dass man diese Stunden lieber in den Unterricht stecken würde….und so manche OGSen sehen sich mit der Dickfälligkeit der SL konfrontiert….
In Brandenburg geht die GS bis zur 6. Klasse. Die haben 31 Wochenstunden, teilweise mehr durch Sonderklassen für Musik oder Sport. An unserer 3-zügigen Schule gibt es 25 Kollegen. Die Schulleitung arbeitet schon mal weniger Stunden und ein paar wenige Kollegen arbeiten freiwillig verkürzt. Einige sind schwerbeschädigt oder bekommen Abminderung wegen des Alters. Die meisten arbeiten jedoch voll. In GS gibt es ja auch DaZ und Teilungsstunden. Dadurch kommt das von der Stundenzahl schon hin.
Meiner Meinung nach sind tatsächlich besonders Lehrer der 1. Klasse, Deutsch-, Fremdsprachenlehrer und generell Klassenlehrer besonders belastet. Wenn das alles auch noch kombiniert auftritt, wird es zu einem zeitfressenden stressigen Job. Für die Kinder macht man es gern, aber für die eigene Familie bleibt nicht viel Zeit.
Dann hat die Klasse 1a Unterricht in den Stunden 1-4 und die Klasse 1b Unterricht in den Stunden 5-8.
Unterricht im Schichtbetrieb gab es schon einmal, als es bedingt durch Kriegsschäden nicht genug Schulgebäude gab.
Die Rechnung geht nicht auf, weil alle Schüler:innen am Morgen 5 Stunden betreut sein müssen und es dafür in den meisten BL kein/kaum zusätzliches Personal gibt, diese Zeiten decken die Lehrkräfte mit Unterricht +Aufsicht ab.
Sie vergessen jedoch, dass die SuS der zweiten Schicht auch irgendwie zur Schule kommen müssen. In veränderte Schulzeiten spielt der Busverkehr (problematisch im ländlichen Raum) und natürlich auch die Betreuung der Kinder bis zum Schulanfang mit rein.
Sooo einfach ist es halt nicht.
Bei uns in NRW gibt es keine 2. Schicht (5.-8. Stunde)
Wir hatten das Problem auch schon vor etlichen Jahren, das Land schaut auf die Zahlen und meint, man könne abordnen.
Das Land meinte dann auch, es müsse unseren Stundenplan überarbeiten … aber sie rechnen wohl noch, wie es in Stunde 1-4 möglich sein soll, alle Klassen zu besetzen, wenn man weniger Lehrpersonen als Klassen hat.
Kommt dies aus anderen Gründen vor (Unterversorgung, Krankheit), gibt es in NDS pädagogische Mitarbeiterinnen an den Grundschulen, die einspringen, um zu beaufsichtigen. Unterricht dürfen sie offiziell nicht halten. Die Schule versucht dann, es gleichmäßig auf alle Klassen zu verteilen oder legt Klassen zusammen oder lässt im Notfall sogar Klassen zu Hause (dann wieder mit Notbetreuung, sodass man dennoch Personal einsetzt, dies müssen aber keine Lehrkräfte sein).
Stimmt.Gerade an beruflichen Schulen gibt es sehr viele Teilzeitlehrkräfte (vor allem wirtschaftliche, soziale etc) Ausrichtungen. Wenn die alle in Vollzeit gehen würden. – phew
Es gibt auch keine „genehmigte Stellenzahl“. Die Stellenzahl für eine Schule errechnet sich aus dem Grundbedarf (reine Schüleranzahl) und den Mehrbedarfen (diese bestehen aus Zusatzbedarfen für OGS, für Integration, für Anrechnungsstunden für ganz unterschiedliche Dinge, usw.). Hinten raus kommt dann der tatsächliche Stellenbedarf einer Schule. Eine 100% Abdeckung entspricht dann genau den Bedarf einer Schule, um die ermittelten Unterrichtsstunden abzudecken. Eine Unterschreitung bedeutet, dass weniger Stunden als benötigt zur Verfügung stehen, ein Überschreiten bedeutet das Gegenteil, so dass die Schule über mehr Stunden verfügt, die sie einsetzen kann.
Natürlich hat das Schulamt die Stellenbesetzung im Blick, aber es ist gar nicht möglich, die Ausstattung immer bei 100% zu halten. Erst bei einer massiven Überschreitung auf z.B. 120% (was bei uns etwa 40 Stunden ausmachen würde) würde wahrscheinlich eine Kollegin versetzt werden….aber btw so eine Ausstattung hatten wir noch nie….
Echt, Sie haben noch Anrechnungsstunden zu vergeben?
Mit Anrechnungsstunden meine ich auch Z.B. meine SL- Entlastungsstunden, die Unstat-Stunde, die Logineo-Stunde, usw…..nicht nur die Stunden für die Kollegen….…..aber ja, wir haben jedes Jahr 4 (sic!) Anrechnungsstunden zu vergeben….und jetzt kommen tatsächlich noch 3 für die Startchancenschulen hinzu (Jubel….)
Startchancenschulen – wo? Welche Chancen? Wieder ein Feldversuch???
Nö! Sie sind aber auch nicht uptodate, oder?
Mit genehmigt meinte ich, dass der festgesetzt wird anhand der aufgestellten Kriterien.
Und wir wissen auch, dass eine zugewiesene Stelle nicht zwangsläufig eine besetzte Stelle ist.
Ja, genau, deswegen gibt es auch nie genau die 100%…..wenn wir Anspruch auf dem Papier haben, dann sind wir folglich nicht bei 100% sondern niedriger…wenn es eine VZ-Stelle wäre, wären wir bei ca. 88 %……wo wir aktuell auch rumkrebsen….
In NDS kommt die Abordnungsverfügung auch für wenige Stunden und bereits, bevor die Schule zu 100% versorgt ist. (95 nicht die neue 100)
Ja, das ist möglich, denn es gibt Schulen, die sind so eklatant unterbesetzt, dass 95% schon fast charmant ist….
Ich habe schon Schulen erlebt die so bei 93% bis 94% lagen bzw. bei Schuljahresanfang – vor dem Nachbesetzungsverfahren – auch noch gut 5% darunter. An einer Schule, die entsprechend der amtlichen Planungsdaten einen Bedarf von 90 VZ-Stellen hat, kann sich jeder ausrechnen, was die 93%ige Stellenbesetzung ausmacht. Die 6 fehlenden Lehrkräfte führen zum einen zu Stundenstreichungen und zum anderen – basierend auf Absprachen – zu Dauervertretungen, die durch Deputatserhöhungen Einzelner aufgebracht werden. Letzteres führt dann längerfristig zu erheblichen Problemen.
Jede Schule hat ihre eigenen 100%, nicht wahr?
Eben, was nicht passt wird passend gemacht.
Wieso? Größere Schule, mehr Kinder= höherer Stellenbedarf = mehr Unterrichtsstunden
Und Beförderungsämter wegen “dem” Stellenkegel. Win-win so zu sagen. Hat nur der Genitiv nix von
Aber ganz bestimmt nicht an einer GS…..das höchste der Gefühle wäre an sehr großen GSen ein zweiter Konrektor…..habe ich aber nur von gelesen und noch nie erlebt.
Also ich habe meine Fächer nach Neigung und meine Schulform nach Inhalten im Studium ausgesucht. Ich wollte ein ansprechendes Studium, das mich rundum fördert und Spaß macht und zudem auch wirklich auf die Schulrealität vorbereitet. An der TU Dortmund war das Studium für Sek 1 für mich ideal organisiert.
Grundschullehrerin verdienen immer noch weniger Geld als die Kolleginnen an den Gymnasien, da sie die Ratszulage nicht bekommen.
Angestellte Lehrkräfte an Gymnasien bekommen die auch nicht, trotz zweitem Staatsexamen.
Aber ja, das sollte alles mal auf den Prüfstand.
Mangel erkannt und domkumentiert. Wie sieht dann das Modell zur Behebung des Mangels aus? Der Punkt Bezahlung wird hier nicht erwähnt, müsste dann in diesem Modell auch mit einfließen.
Bei aller Kritik an diesem sächsischen Taschenspielertrick, wohl in allen Kollegien gibt es leider Lehrkräfte, welche die gängigen Vorurteile über unseren Beruf bestätigen.
Hier wünsche ich mir eine Doppelstrategie:
Enerseits die klare Benennung, dass das Bildungssystem unterfinanziert ist und die Schule eine Schule ist, keine Ersatzfamilie und keine gesellschaftliche Reparaturwerkstatt,
andererseits aber auch die klare Ansprache an jene schlimme Kolleg*innen, die Eltern, Schulverwaltung, Wissenschaft und Politik wohlfeile Argumente liefern.
Es gibt einen Unterschied zwischen Solidarität und Korpsgeist.
Na da arbeitet die Politik aber sehr akribisch daran, dass man die Arbeitsbelastung der angeblich nicht ausgelasteten Lehrkräfte weiter erhöhen kann. Nehmt euch in Acht wenn ihr Grundschullehrer oder Sportlehrer sein. Ich sehe dunkle Wolken aufziehen….
Kooperation mit Sportvereinen und die Sportlehrkräfte können in korrekturintensiven Fächern eingesetzt werden.
Oh, das erkenne sogar ich als Laie, dass Sie gerade suggeriert haben, als Sportlehrer bräuchte es kein Studium.
Meine GS hatte eine Kooperation mit einem Sportverein. Diese “Jungtrainer” boten im Nachmittagsbereich verschiedene AGs an und unterstützten im Sportunterricht die Sportlehrer. Aber sie durften aus Versicherungsgründen keine Sportstunden(auch nicht vertretungsweise) erteilen.
das habe ich selbst erlebt. Als ich mal wieder zur Vertretung (obwohl kein Sportlehrer) eingesetzt war, wies mich der vom Verein darauf hin. Ich einigte mich mit dem jungen Mann wie folgt: Er erteilt den Unterricht, da er die Klasse besser kannte als ich und ich unterstütze ihn und übernehme die Verantwortung, wenn etwas passiert. Es war eine tolle Sportstunde für die Kinder.
Vor unzähligen Jahren, als der Ganztag in BW eingeführt werden sollte, hatte ich mal eine Fortbildung im Landtag. In einer Diskussion über Vereine im Ganztag in der Schule habe ich auf diese Problematik aufmerksam gemacht und bin von den Landtagsabgeordneten platt gemacht worden. Für mich sehr unangenehm. Da ich mit der Schulleitung schon ziemlich viele Gesetzestexte gewälzt hatte, habe ich nicht klein beigegeben.
Drei Tage später ging ein Brief bei meiner Schulleitung ein, dass das Problem erkannt worden ist und wenig später wurde es gesetzlich gelöst. Eine Entschuldigung für die echt heftigen Aussagen gegen meine Person während der Diskussion kam nie. Damit kann ich bis heute gut leben.
Ich kann damit gut leben, weil sich damals mit meinem Engagement etwas verändert hat. Ich konnte etwas bewegen. Heute unmöglich.
Das ist doch auch verlogen, wenn ehrenamtliche ausgenutzt werden. Permanent liest man, dass nicht Lehramtstudierte unfähig sind. Und dann machen ehrenamtliche gratis tolle Stunden.
Wer bemerkt das Problem?
Tscha, ein klassisches Dilemma. Für die Schüler war es damals die beste Lösung, da ich als Nicht-Sportlehrer so eine tolle Stunde nicht gewuppt hätte. Der junge Mann vom Verein war eh für diese Stunde eingeteilt, als Unterstützung. Wie hätten Sie gehandelt? Übrigens hatte ich nicht das Gefühl, dass sich der junge Mann von mir ausgenutzt fühlte. Ich hatte ihn ja gefragt, ob er die Stunde gern übernehmen würde. Er sagte: “Ja gern, aber…” Daraufhin kam es zu der internen Absprache.
Und die haben auch morgens Zeit? Wo leben Sie denn?
Ehrenamtliche Schwimmtrainer, die in einem Unternehmen im Mehrschichtensystem arbeiten.
Diejenigen, die Spätdienst haben, können eben auch am Vormittag.
“Lehrkräfte in Fächern wie Deutsch, Englisch oder Französisch arbeiten im Mittel mehrere Stunden pro Woche länger als Kolleginnen und Kollegen in naturwissenschaftlichen oder musisch-praktischen Fächern. Diese Differenz zieht sich durch alle Schularten – ist aber an Gymnasien am ausgeprägtesten.”
Ich frage mich, wie solche Unterschiede zustande kommen und ob das zwischen den Bundesländern so anders ist.
Zumindest bei uns schreiben wir in den Naturwissenschaften natürlich Arbeiten/ Klausuren und auch Tests.
Ebenso sind auch wir Klassenlehrer – mit allen entsprechenden Aufgaben. Und gerade an Gesamtschule mit Oberstufe müssen wir uns in der Sek I um Inklusion und Sprachbildung kümmern (sicher mehr als an Gymnasien) und haben dennoch Sek II-Unterricht mit Abiturprüfungen. Und da es bei uns wenige MINT-Lehrkräfte mit Sek II-Fakultas gibt, sind wir i.d.R. in jedem Jahr mit beiden Fächern im Abitur eingesetzt
Ein zusätzlicher Aufwand bei Naturwissenschaften ist es aber, dass man Experimente vorbereiten muss, wieder abräumen, spülen etc. Es passt nicht immer, aber wir versuchen doch, fast in jeder Chemiestunde zumindest ein kleines Experiment zu haben.
Für ein Chemie-Experiment in einer Oberstufenklausur ist man locker zwei Nachmittage mit Ausprobieren und Vorbereiten beschäftigt. Danach muss alles wieder abgeräumt und gereinigt werden.
Und wenn man am Puls der Zeit sein will, probiert man immer wieder neue Experimente aus und baut sie in den Unterricht ein.
Ich finde all das auch nicht sonderlich schlimm, habe mir meine Fächer ausgesucht und finde sie noch immer toll. Nur kann ich kaum glauben, dass wir Naturwissenschaftler deutlich weniger arbeiten als die Deutsch- oder Englisch-Kollegen.
Letztendlich hängt die Arbeitsbelastung vermutlich damit zusammen, wie hoch der eigene Anspruch und die eigene Motivation sind.
Wie vieleArbeiten und Tests schreiben Sie denn in den Jahrgängen?
Die Korrektur eines Tests ist vom Arbeitsaufwand übrigens nicht vergleichbar mit der Korrektur einer Klassenarbeit oder Klausur.
Jetzt hören Sie auf, zu heulen, nur weil Sie die Fakultas für die falschen Fächer haben:)
Sie haben wohl auch schon vor längerer Zeit aufgegeben, sinnvolle Beiträge zu schreiben. Jetzt erschöpfen sich Ihre Beiträge in Trollereien.
Ja, ist schade, find ich auch
Dann sollten wir Debatten um die richtigen Themen führen und aufhören die Lehrerschaft nach dem Alter der unterrichten SuS aufzuspalten. Und das auch noch auf der Grundlage von vom Dienstherren bestellten Gefälligkeitsgutachten.
Forsträte und Brandräte haben auch die gleiche Eingruppierung, die Arbeitsbelastung lasse ich andere beurteilen.
PS der Standesdünkel von StR geht mir gehörig auf den Senkel.
Dass Gymnasiallehrer im Schnitt eine höhere Wochenarbeitszeit haben als Grundschule- und Oberschullehrer, haben auch schon vorige Arbeitszeitstudien ergeben. Standesdünkel von Studienräten habe ich hier in der Diskussion nicht festgestellt.
Und wenn es gerecht zugehen soll, muss eh die Arbeitszeit individuell erfasst werden. Ch verstehe nicht so ganz, was Sie erbost.
Doch, immer dann wenn die Arbeitsbelastung zur Begründung einer Änderung der Eingruppierungsregelungen herangezogen wird. Letztere betrifft die SekI-Kolleg*innen mit einem Beförderungsamt für die “Mitarbeit bei xyz” am stärksten. Hierfür gibt’s am GY und am BK A14.
Da haben wir es in BB ja richtig gerecht: niemand kriegt die 14, alle bleiben bis ans Arbeitsende in der 13, egal welche zusätzlichen Ämter man innehat. Für die großen Fachkonferenzleitungen (Ma, D, Fremdsprachen) gibts eine Abminderungsstunden, alles andere: Gotteslohn.
Dafür bekommen die Gyms auch mehr Geld.
Klingt logisch für mich. Mehr Arbeit, mehr Geld…
Dienstrecht nicht verstanden.
Nee. Bekommen alle in allen Schulformen E/A13. Schulleitungen bekommen mehr.
An unserem Gym gibt es auch für Fachleitung, Zusatzaufgaben etc. keine A/E14 oder so, höchstens ne Abminderungsstunde, aber die gibt es an den anderen Schulformen dafür auch: unsere Grundschule vor Ort verteilt die großzügiger als hier im Gym (Klassenleitung z.B: an der GS eine Abminderungsstunde, bei uns nix).
Für Klassenleitung eine Abminderungsstunde finde ich mehr als gerechtfertigt, durfte ich leider nicht erleben.
Und die haben tatsächlich mehr Arbeit? Die Studie sagt, dass marginal mehr Arbeitsstunden gearbeitet wird, aber sie sagt nichts darüber aus, wie verdichtet die Arbeit wirklich ist….
Maximal dissonanter Klang bzw. Mehrarbeit oder gar Mehrgeld hat hier weniger als nichts mit Logik zu tun…
Das widerspricht aber dem Alimentierungsprinzip und dem Prinzip der Daseinsvorsorge. Die Besoldung bzw. deren Höhe wird ja dem Amt angemessen, nicht aber dem Arbeitsumfang des Amtsinhabers.
Hauptamtliche und Berufsfeuerwehrleute werden ja auch vergütet, wenn es nicht brennt.
Für Lehrkräfte heißt das, ihr jeweiliges Amt wird entsprechend der Anforderungen an die Qualifikation vergütet. Im speziellen spielt dabei die Gruppengröße der Unterrichtsgruppen oder die Jahrgangsstufe/Altersgruppe der Schülerschaft keine Rolle. Die Richterbesoldung z.B. ist auch nicht von der Instanz abhängig, in der die Stelle angesiedelt ist. Es spielt also keine Rolle, ob das ein Amts- oder ein Land- oder Oberlandesgericht ist. Ebenso ist es für die Besoldung uninteressant, wo das Richteramt in der Gerichtsbarkeit angesiedelt ist.
Ein PHK als Kontaktbeamter hat auch eine andere Arbeitsbelastung als ein PHK in einem SEK. Wenn es unterschiedlich hoge Bezüge bei gleicher Besoldungsgruppe gibt, dann ist das die Folge von Amtszulagen, die die jeweiligen Besoldungsgesetze und Verwaltungsordnungen regeln.
Schon klar.
Amtsangemessen ist das Zauberwort für alles.
Dass die Hütte brennt, weil Leute mit z.T. höherer Qualifikation, aber ohne Amt, die das gleiche machen weniger bekommt, fällt dann unter den Tisch. Hauptsache, die Herren und Damen Beamten können sich auf ihren Prinzipien ausruhen und weiterhin die Augen vor der Realität verschließen.
Oben hieß es, der Ehrenamtliche hat eine bessere Stunde gemacht als der mit Amt, später wird argumentiert, das Amt wird bezahlt. Woanders geht es darum, dass die Tätigkeiten an GS und GYM gar nicht vergleichbar sind.
Und wie löst man das? Klar, mit dem AMT. Aber die Sache mal durchdenken – und nicht nur formaldoof zu lösen ist zu viel verlangt.
Wie wäre es denn, die VZ GS Kräfte anderweitig einzuplanen und hier mal Ideen zu entwickeln. Klar, wir ruhen uns auf dem Status quo aus, weil der so bequem und amtsangemessen ist.
Sie haben das Prinzip der Vergütung von angestellten Lehrkräften treffend dargestellt.
In der Sek I haben wir als Gesamtschule das Fach “Naturwissenschaften” als Hauptfach, mit 3-4 Stunden pro Woche. Entsprechend schreiben wir auch 3-4 Klassenarbeiten pro Schuljahr, ähnlich wie die anderen Hauptfächer.
In der Sek II ist es dann normal wie sm Gymnasium auch.
Bei Tests kommt es sehr auf die Jahrgänge an, aber in Jg-9 und Jg-10 schreiben wir schon alle 1-2 Wochen einen kurzen Test. Das läppert sich dann.
Wie gesagt, ich möchte da auch nicht jammern. Wir haben uns unsere Fächer doch ausgesucht. Ich hätte gar keine Lust gehabt, Sport oder Kunst zu studieren. Ebenso unterstelle ich, dass ein Deutschlehrer nicht Mathe studiert hätte, nur weil das vermeintlich (!) einfachere Korrekturen bedeutet.
Am Ende hat jedes Fach und jede Schulart doch besondere Belastungen. Zumindest das zeigt sich in der aktuellen Studie. Wir können froh sein, dass es genügend Grundschullehrkräfte gibt, die mit vermeintlich weniger Arbeitszeit dennoch eine höhere psychische Belastung haben.
Was die höhere psychische Belastung betrifft: Ich bezweifle, dass 7-10.Klässler einfacher zu händeln sind. Schon mal ne neunte gehabt, mitten im Pubertätsschub?
Regelmäßig, aber wir haben ja auch noch ein bisschen anderen Unterricht, inklusive Sek II.
Aber gut 28 Stunden die Woche mit Grundschülern würden mich vermutlich in die Anstalt bringen – und zwar keine Bildungsanstalt.
Da sind die Menschen halt verschieden.
Also ab zum ZDF:)
Nun ja, eine hohe Anzahl von ehemaligen Lehrkräften arbeitet als Comedian. – Good luck!
O, Smileys funktionieren hier nicht, dann so: :)))
Richtig, oder gehen Sie doch einmal in eine achte Hauptschulklasse……viel Spaß…!!!
Ich schließe mich Ihrer Argumentation voll und ganz an!
Das Gleiche gilt für Physik!
Wenn ich in Mathe alle Folgefehler bei längeren Rechnungen suche, dauert die Korrektur auch ewig.
In Musik kostet das fachfremde Unterrichten viel Zeit nebenher (fachfremd wegen Mangel an Anwärtern, die das studiert haben und der Versuch, den Unterricht trotzdem am Laufen zu halten).
Musikinstrumente pflegen, praktische Übungen vorbereiten, häufig Klausurersatzleistungen, die zeitaufwändig sind, Beteiligung an Schulveranstaltungen oder anderen Veranstaltungen für außerschulische Auftraggeber mit musikalischen Beiträgen (alle schauen zu, nur eine oder einer arbeitet noch am Abend oder am Wochenende) – das macht musische Fächer nicht weniger zeitaufwändig.
Das ist für solche Aktionen eher wie eine zweite Klassenführung, besonders sobald der Veranstaltungsort außerhalb der Schule und außerhalb der Regelunterrichtszeit liegt.
Natürlich kann man die Frage stellen, weshalb solche Aktionen dann durchgeführt werden … der Applaus ist für die SuS eine große Bestätigung – hier Punkten auch die, die im Sportunterricht immer die letzten sind. Es handelt sich um echte Gemeinschaftsaktionen (miteinander, nicht gegeneinander), die Selbstbewusstsein auf eine andere Art schaffen. Außerdem “verlieren” sich manche SuS in der Musik … das wirkt im stressigen Alltag stressmindernd. Die Bestätigung bei Auftritten ist für viele SuS nach anfänglichem Lampenfieber eine große Erfahrung, an der sie wachsen und dann gelassener anderen Problemen begegnen – sie trauen sich mehr zu (Aussage von SuS)!
Leider ist der Stellenwert hierfür in unserer Gesellschaft nicht besonders groß.
Den Erfolg kann man nicht in Zahlen messen, denn er fließt nebenher in alle Bereiche des Lebens ein und er ist für die SuS auch erst nach längerer Zeit sichtbar (oft erst nach der Schulzeit)!
Genau so ist es!
Dem kann ich voll zustimmen und sehe gleichzeitig, dass diese Argumente, gedreht auf Sport , auch passen. Wer in Mathe oder Musik eher Deko ist, findet vielleicht im Sport (mit seiner Mannschaft, für die Schule) Bestätigung. Die Kinder sind eben verschieden…
Sie sprechen mir aus der Seele. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ein Plädoyer für die musische Erziehung, die leider oft viel zu kurz kommt.
Also in der Sek II gleicht sich der Korrekturaufwand langsam an, in der Sek I sind wir mit Nawi-Fächern immer schneller durch als mit Sprachen oder Gesellschaftswissenschaften. Hab ja beides, von daher kann ich bestätigen, dass in der Sek I Nawi schneller geht. Die Mathe und Physik-LuL haben auch das Abi immer als er erstes fertig.
Und Sport schreibt in der Sek I gar keine Arbeit.
Weiters Problem ist ja auch, dass manche LuL nur in der Sek I sitzen und andere immer die Sek II bekommen. Das wird leider nicht immer gleichmäßig verteilt. Wenn man mal mit 5 oder 6 Kursen parallel durch die Oberstufe ist, dann hat man nach der Klausurenphase keinen Fragen mehr. Hier kann aber die Schulleitung was tun, ich habe mich dann irgendwann mal beschwert, als mir noch ein Kurs aufgedrückt werden sollte.
Die beste Lösung hierfür ist, die eigene Klasse heranzuziehen und Verantwortung für die Qualität des unterrichteten Faches zu übernehmen.
Ich habe es satt, ständig die SuS von Kollegen weiter unterrichten zu müssen, die ihre Arbeit zuvor nicht richtig erledigt haben. Mit dieser Vorgehensweise sind dann alle in beiden Stufen vertreten.
Ist ein Schüler der Meinung, sich nicht mit der Klassenlehrkraft zu verstehen, kann er eben in die Parallelklasse gehen.
Den hohen zeitlichen Aufwand für den Unterricht in Naturwissenschaften kann ich auch von meiner Schulart her bestätigen. Es grüßt eine ehemalige Realschullehrerin für Chemie und Biologie (fachfremd auch Deutsch, Englisch, Musik und Bildende Kunst, damit ich auch eine Klassenleitung übernehmen konnte).
Richtig, und bei musisch- praktischen Fächern kommen außeruntertichtliche Tätigkeiten hinzu wie Wettkämpfe, Auftritte, Darstellung der Schule in der Öffentlichkeit, oft zeitlich sehr unregelmäßig. Ich hatte z. B. in der Vorweihnachtszeit in den drei Wochen im Dezember bis zu 9 oder 10 Auftritte mit Schülern im Umkreis und an der Schule, Altenheime, Kliniken, Altkollegenweihnachtsfeiern….
Will damit nur sagen- es ist alles schwer vergleichbar…..
Natürlich gibt es diese durch Schulform und Unterrichtsfach bedingten Unterschiede. Jeder weiß das. Und jeder weiß auch, dass Solidarität der weniger belasteten Kollegen nicht existiert. Deshalb muss das endlich mittels Arbeitszeiterfassung angegangen werden.
Die Kollegen, die deshalb aufschreien, sind die, die deswegen mehr arbeiten werden müssen. Und denen es bisher scheißegal war, dass andere dabei (fast) draufgehen.
Es geht nicht nur um unterschiedliche Motivation, Fächerkombination und Schulform. Es geht auch um den Standort. Mehr Arbeitszeit ist sicher einfacher in schicken Gebäuden mit guten Schülern in Hamburg Blankenese abzuhalten, als im tiefsten Brennpunkt Duisburg Marxloh, mit alten Gebäuden und verdreckten Toiletten und teilweise gewalttätigen und schwer erziehbaren Kindern, die keinerlei Deutsch sprechen. Wird an solchen Schulen noch mehr aufgesattelt, dann sehe ich die Krankmeldung flattern.
Statt Stundenreduzierung, die ich in solchen Fällen für dringend geboten halte, gab es in Berlin zeitweise einen Gehaltsaufschlag. Das betrachte ich eher als “Schweigegeld”, denn nichts an den unhaltbaren Zuständen wurde besser dadurch. Inzwischen ist es wieder abgeschafft worden wegen der Sparmaßnahmen. Geld weg. Und die unhaltbaren Zustände sind immer noch da.
Auch Beratungsgespräche und Ordnungsmaßnahmenkonferenzen gehören zur Arbeitszeit.
Ich sehe nicht, dass Sportlehrer an Brennpunktschulen unangemessen mehr belastet würden.
Im Gegenteil: Korrekturfachlehrer würden auch an Brennpuktschulen entlastet.
Sportlehrer sind aber z. B. einer enormen Lärmbelatung ausgesetzt, die körperlichen Anforderungen sind auch nicht ohne (Geräte auf und abbauen, Hilfestellung leisten…). Ich war kein Sportlehrer, hatte aber das “Vergnügen” in den ersten 3 Berufsjahren an der Hilfsschule auch Sport unterrichten zu “dürfen” und wurde auch später oft als Vertretung, manchmal auch nur als 2. Lehrerin (für die Mädchen) eingesetzt. Ich hätte das ungern mehrere Stunden, an mehreren Tage der Woche machen wollen.
Jeder hat seine Fächer aus freien Stücke gewählt, er wurde nicht dazu gezwungen. Jetzt hier so ein Geschrei zu machen, weil man die Chance sieht, Gehör zu finden in der allgemeinen Zeiterfassungsdiskussion, ist einfach nur schäbig. Und wenn bei Ihnen die Solidarität der weniger belasteten Lehrkräfte nicht vorhanden ist, dann trifft das ja wohl nicht pauschal zu. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade solche Erbsenzähler bei der Zeiterfassung dann unglaublich kreativ werden.
Ihr letzter Satz disqualifiziert Sie dann endgültig. Arrogant und ignorant, ziemlich gefrustet, was? Beruf verfehlt? Nett, solche Kollegen.
Grundständige Lehrkräfte ja, Seiten-/Quereinsteiger sind da von Entscheidungen der Schulaufsicht abhängig.
So vehement, wie Sie permanent gegen die Arbeitszeiterfassung argumentieren, muss sich bei Ihnen ja ein großes Minus zur Sollzeit ergeben. In diesem Fall ist es nur richtig, dass Sie dann mehr als jetzt arbeiten müssen – schließlich bekommen Sie genauso viel Gehalt wie Ihr Kollege, der deutlich im Plus ist.
Sie täuschen sich, ich habe mal ein Jahr meine Stunden berechnet (ohne jeden Gedanken an die Schule aufzuführen), und bin erheblich über mein Soll gekommen, hat mich halt interesssiert. aber ich werde es Ihnen nicht vorrechnen. Ich habe dann eine Zusatzfunktion aufgegeben, bin aber immer noch sehr engagiert. Ich verstehe nicht ganz, dass hier in naiver Form die Leute, die die Zeiterfassung kritisch sehen, sofort in das Schema “hat nicht so viel Aufwand wie ich” gepresst werden. Diese gegenseitigen Anfeindungen nerven nur noch.
Umso weniger verstehe Ihre Argumentation.
WEIL ES GANZ EINFACH SO NICHT FUNKTIONIERT, WIE DIE KOLLEGEN SICH DAS VORSTELLEN. Ich betone nochmal: es ist doch viel zielführender, wenn man endlich an den Dienstherrn geht und eine klare Arbeitsreduzierung fordert, es wird immer mehr draufgepackt, und das muss aufhören. Für Inklusion, Integration uind Individualbetreuung braucht es pädagogische und psychologische Assistenten, die Zeiten, in denen man vor braven Schülern steht, die alles machen und umsetzen, was man sagt, sind lange vorbei, aber der Dientsherr geht immer noch vom Idealfall aus, und damit werden die Zusatzaufgaben einfach nur draufgepackt. Man wird nie und nimmer eine gerechte Arbeitsverteilung im Lehrerberuf erreichen, dafür ist er zu vielfältig, und das ist gut so. Wir haben es in der Schule nicht mit Aufträgen, die man abarbeiten kann, zu tun, und die oft getroffene Aussage, “wenn mein Stundenmaß voll ist, dann lege ich halt den Stift weg” ist absoluter Quatsch, das können Ärzte auch nicht sagen, wenn die Pateinten versorgt werden müssen.
Wer im Lehrerberuf die Erbsenzählerei anfängt, der sollte einen Bürojob anstreben, mit Stempeluhr, dann beim Heimgehen warten, bis der Zeiger eine Minute weitergesprungen ist. Ja, sehr erstebenswert, diese Einstellung.
Genau Personen wie Sie sind der Grund, warum wir heute noch mit dem Arbeitgeber diskutieren müssen. Es ist nicht Ihre Aufgabe, die Fehler des Arbeitgebers zu korrigieren. Auch diese selbstlose Denkweise ist ein Virus unter den Lehrenden.
Ich lege alles zur Seite, wenn die Zeit gekommen ist, und arbeite nicht weiter. Soll der Arbeitgeber doch meine Zeit erfassen und dann nachweisen, dass ich mit meiner Arbeitszeit im Minus bin.
Eigentlich ist der momentane Zustand ein Segen für die Lehrkräfte, die wissen, wie man damit umgeht.
Dann tun Sie das, aber offenbar haben Sie meine Antwort nicht so richtig gelesen oder erfasst.
Im Übrigen korrigiere ich nicht die Fehler des Arbeitgebers, sondern mache für mich das Beste daraus und setze mich auch manchmal über Vorgaben hinweg. Man eckt an und zieht meist den Kürzeren beim Dienstherrn, aber das ist mir egal, als Angestellter, Beamte sollten auch mal den Mut aufbringen, den Dienstherrn anzugehen, anstatt die Schüler darunter leiden zu lassen.
Eine deutliche Reduzierung kann man viel besser begründen, wenn überhaupt erstmal erfasst, wie viel die (meisten) Kollegen mehr arbeiten.
Der Arbeitsaufwand der Lehrer wurde schon -zig fach erfasst und dargelegt, aber der Dienstherr ist wie eine steinerne Wand und findet immer wieder “Experten”, die dies widerlegen. Er sitzt leider am längeren Hebel und kann den renitenten Lehrern das Leben schwer machen. Eine Arbeitszeiterfassung brächte erhebliche Unruhe in das Lehrerkollegium, und damit können sie leicht gegeneinander ausgespielt werden.
Nicht Stein- sondern Gummiwsnd
Gummi wäre ja noch flexibel!!!
Wirft Sie als Anrennenden aber kräftig zurück, während die Steinwand (siehe Mauerfall) irgendwann bröckelt.
Oh ja, da haben Sie Recht, so betrachtet …… Also her mit den Rammböcken.
Ich weiß genau, was Sie meinen…..aber so arbeitet nicht jeder…..es gibt Kollegen, die brauchen mehr Zeit für die Aufgaben(Vorbereitung, Nachbereitung, Korrektur, dies, das jenes) und ist gibt Kollegen, die sausen durch ihre Aufgaben (und machen den Job wirklich gut). Da ist es schwierig und die Arbeitszeiterfassung bestraft letztlich diejenigen, die sausen können…..
Dafür gibt es aber die Arbeitszeitaufnahme durch REFA-Fachkräfte. Thema: Leistungsabhängige Entlohnung.
Btw weiß eigentlich noch irgendjemand, dass REFA für “Reichsausschuss für Arbeit” heißt? Und RAL der “Reichsausschuss für Lieferbedingungen” ist?
Das ist doch meine Argumentation, warum eine individuelle Zeiterfassung utopisch ist. Ich bin auch kein “Sauser” und verzettlele mich oft in Details, aber das ist nun mal mein Problem. Es geht um die Fülle der Zusatzaufgaben, die auch mit einer Fülle von Sondersitzungen einhergehen. Man sollte Schule wieder auf Unterricht und Wissensvermitllung fokussieren, Alltagsfertigkeiten und gesellschaftliche Probleme können nur mit Zusatzangeboten bewerkstelligt werden, es ist nicht Aufghabe des Lehrers, alle Bereiche abzudecken und damit der Prellbock für Fehlentwicklungen zu sein. Ich denke da nur an eine psychisch sehr auffällige Schülerin, die ihren Mitschülern Angst machte, die Eltern auf die Barrikaden gingen und die Schule das Ministerium um Eliminierung der Schülerin bat. Die lapidare Antwort war, dass die Lehrer das “im Zuge der Inklusion” schaffen müssen. Und das ist eine Unverschämtheit seitens des Dienstherrn.
Hat diese Schülerin ebenfalls um “Eliminierung” von den ihr lästig Gewordenen gebeten und wäre sie an der nächsten Schule weniger auffällig ?
Sie verkennen deutlich die Situation und sollten sich nicht dazu äußern. Die Schülerin müsste dringend in Therapie, aber dazu kann man ja keinen zwingen.
Das sind ja alles offene Geheimnisse. Aber genauso wie die Ergebnisse der Studie bestritten werden von denen, die immer über zu viel Arbeitsaufwand jammern, bestreiten die Lehrer unterschiedlicher Schularten den unterschiedlichen Arbeitsaufwand und die Lehrer verschiedener Fächer bestreiten den unterschiedlichen Aufwand pro Fach. Und genauso bestreiten die Beamten ihre Vorteile gegenüber den Angestellten usw.-usf. Alle verteidigen verbissen ihre “Privilegien” und wollen nichts davon abgeben. Siehe auch Rentenreform, siehe auch Bürgergeldreform, Krankenkassen, Migration und und und… Alle wissen, es geht nicht fair zu und es muss (sollte) sich was ändern, aber bitte immer nur bei den anderen.
Damit Sie an dieser Stelle ein positives Erlebnis haben:
Ich bin Beamter.
Ich gestehe hiermit, dass ich davon Vorteile habe.
Diese Vorteile halte ich angesichts der ihnen gegenüberstehenden Pflichten (die schon bald sehr, sehr viel weniger “theoretisch” werden könnten als gedacht) für vollkommen berechtigt.
“Lehrkräfte leisten nicht alle gleich viel – und das hat System”
Auch das kann man nichts fett genug schreiben.
Auf diese Weise kann man immer auf irgendwelche Durchschnittswerte verweisen oder gleich ganz auf die Gruppe der weniger leistenden.
Damit wälzt man wieder die Verantwortung auf die Einzelpersonen ab. Schaut her – die anderen kriegen es doch auch hin. Wer mehr Zeit braucht macht selber was verkehrt.
Sch… System
Ich erinnere mal an die A-13-Debatte. Wie haben da die Grundschullehrer vehement bestritten, dass Gymnasiallehrer mehr Aufwand haben als sie. Nun haben wir einen wissenschaftlichen Beweis, aber der wird ja auch schon wieder zerredet.
Und wie oft hieß es, Lehrer mit “Korrekturfächern” hätten nicht mehr Aufwand als andere. Das SOLLTE sich endlich mal im Stundensoll oder halt in Anrechnungsstunden niederschlagen. Wäre aber ähnlich wie die kleineren Klassen mit mehr Lehrern verbunden und die haben wir ja nicht.
A13 war keine Frage des Arbeitsaufwandes, sondern eine Frage der Ausbildung. Da in vielen Bundesländern alle Lehrkräfte 10 Semester inklusive Masterstudium studieren, war eine weitere ungleiche Besoldung schlicht nicht mehr zu rechtfertigen
Trotzdem empfanden es viele als ungerecht. Eben, weil die Lehrämter nicht zu vergleichen sind. Weder in der Ausbildung noch in der Praxis. Jetzt ist es bestätigt worden. Das heißt, das einzige Gleiche ist die Dauer der Ausbildung. Nur die Dauer! Die Anzahl der Jahre.
Nein. Nicht nur die Dauer. Auch die Qualität. Und das Beamtenrecht gliedert die Zuordnung zu den Laufbahnen (mittlerer Dienst, gehobener Dienst und höherer Dienst) nach der Qualität der Ausbildung. Höherer Dienst ist und war immer die Zuordnung akademisch ausgebildeter Beamte mit Mastertitel.
So gesehen ist es zumindest in NRW immer noch nicht ganz rechtssicher, dass Grundschullehrer nicht im höheren Beamtendienst sind. Schließlich muss die Besoldung auch eine Entschädigung für die langwierige Ausbildung darstellen
Es ist letztlich doch nur die Dauer. Sie betreiben Augenwischerei. Oder ist die Ausbildung der Grundschullehrer früher qualitativ schlechter gewesen, als sie kürzere Zeit studierten? Was genau war damals qualitativ schlechter? Die Lernergebnisse in den Schulen waren bekanntlich besser.
Früher studierten die angehenden Grundschullehrer nicht an der Universität, sondern an einer pädagogischen Hochschule. Das war der Unterschied und die Grundlage für die unterschiedliche Einordnung.
Das stimmt so auch nicht ganz. Zumindest an den pädagogischen Hochschulen der DDR wurden Lehrkräfte für die Klassen 5 bis 12 ausgebildet, also Unterrichtsbefähigung bis zum Abitur. Parallel dazu gab es Universitäten, die den gleichen Studiengang für Lehrkräfte anboten.
Trifft genauso alle SekI-Lehrkräfte. Die A13-Besoldung ist ja nicht automatisch an die Laufbahngruppe II, zweites Einstiegsamt geknüpft. So wird auch an das Übergangsamt zwischen gehobenem und höherem Dienst besoldet. Dazu gehören Erste Polizeihauptkommissare und Oberamtsräte. Sie erhalten A13, gehören aber weiterhin zum gehobenen Dienst. Bei Lehrkräften an GS und in der SekI entspräche das einem “Oberlehrer” – nur diese Amtsbezeichnung ist gestrichen.
Die staatliche Alimentierung beruht aber auf dem akademischen Grad des Abschlusses. Und Master ist Master, egal an welcher Hochschule der akademische Grad erworben.
Mag sein. Es ist trotzdem ungerecht. Es wird nicht gerecht alleine dadurch, dass es nunmal so ist, wie es ist. Dann dürfte/bräuchte man nie etwas verändern. Alles ist so, wie es ist, weil es nunmal so ist.
Und hier haben wir wieder einmal den Mindset, der mich zum Trollen bringt.
Ja, und nachts ist es kälter als draußen…..das ist nun mal so
Meine Nachbarin studiert Lehramt Primarstufe und sitzt in ALLEN Fächern mit Leuten aus der Sekundarstufe in den Kursen.
Ja, so ist das heutzutage, daher ist die gleiche Bezahlung schon auch angemessen…
Es ist, wenn überhaupt, nur in Sachsen “bestätigt” worden. Wie das Ganze in anderen Bundesländern mit mehr sozialen Brennpunkten aussieht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Wenn ich überlege, wie eine Kollegin von mir in einer Grundschule in einem absoluten Brennpunkt arbeitet, in deren Klassen nur zwei Kinder Deutsch sprechen können und der Unterrichtsinhalt manchmal nur daraus besteht, dass man mit Drittklässlern 30min üben muss, sich in einen Sitzkreis zu begeben, kann ich definitiv sagen, dass es mehr als nur belastend ist. Ich hab schon 40-Stunden-Wochen gearbeitet, bevor ich Lehramt studiert habe. Und ich kann einfach sagen, dass mich ein Schultag mit 4h in der Grundschule mehr schlaucht, als ein 9h-Arbeitstag in anderen Branchen, einfach weil man richtig “performen” muss.
Ich bin aktuell im Referendariat für die Grundschule, was natürlich generell nochmal mehr Aufwand ist, als der Alltag als “fertige Lehrkraft”, aber ich sehe ja, wie viel meine Kollegen arbeiten. Und die schlagen sich regelmäßig die Nachmittage, Abende oder sogar ganze Wochenenden um die Ohren, nur weil sie nochmal eine coole Idee hatten und die natürlich so ideal wie möglich umsetzen wollen. Da wird dann überlegt, wie man das dreifach differenzieren kann, wie das Arbeitsblatt doch noch mal besser gemacht werden kann, erkundet neue, digitale Tools für die nächste Unterrichtsstunde oder man schnibbelt halt das ganze Wochenende an laminierten Materialien, die man dann in einer Stunde benutzt und die dann für einen Weile wieder im Schrank landen. Und das wird dann abgetan mit “ach, ich mach das ja beim Fernsehen”. Ich sehe also, wie häufig Arbeit nicht als solche gewertet wird, weil man ja etwas nebenbei macht. Und da schießt natürlich sofort der Gedanke in den Kopf, ob so etwas überhaupt auch miterfasst wurde, oder ob die Lehrkräfte in der Grundschule das abgetan haben und deswegen nicht erfasst haben, so wie ich es in meinem schulischen Umfeld auch erlebe.
Im Endeffekt hängt dieser Beruf total davon ab, in welchem Umfeld man landet. In Grundschulen wird inzwischen viel in Jahrgangsteams oder Fachgruppen vorbereitet, gemeinsam, was total entlastend sein kann, um sich dann auf andere Dinge konzentrieren zu können, die auch noch alle anfallen.
Wichtig ist, dass wir alle wertschätzend unseren Kollegen gegenüber sind, denn wir haben alle eine Belastung, auch wenn sie auf eine andere Art und Weise sich bemerkbar macht. Sei es die Lärmbelastung und die fordernden, aufmerksamkeitsbedürftigen Kinder in der Grundschule, anspruchsvolle Eltern, ein hoher Anteil an DaZ-Kindern, Inklusion, die Lärmbelastung in der Sporthalle oder beim Musizieren, oder der Korrekturaufwand in den typischen Korrekturfächern am Gymnasium mit den Null-Bock-Teenagern. Jede Lehrkraft hat ihr eigenes Päckchen zu tragen, was auf Dauer zur Belastung werden kann. Und heutzutage machen alle neuen Lehrkräfte die gleiche Ausbildung, weswegen es nur fair ist, dass sie auch gleich bezahlt werden.
Die psychische Belastung muss man aber gegenrechnen!
Das Vier Tage Gelaber von manchen hier nervt zwar, aber für Brennpunkte sollte es drei-bis vier-Tage-Wochen geben.
Das Argument der Grundschulllehrer war nie, dass sie mehr Stunden arbeiten. Sondern dass die anderweitige Belastung höher ist. Meine Kolleginnen in Klasse 1 hatten schon einen Elternsprechtag (4 Nachmittage von 14-19 Uhr) und haben mit einem Großteil der Eltern noch zusätzliche Gespräche geführt.
In der 1. Klasse ist ein Unterrichtsvormittag schön, aber wahnsinnig anstrengend.
Gymnasiallehrer, die als Seiteneinsteiger bei uns waren, haben gesagt, dass sie sich den Job nicht annähernd so stressig vorgestellt haben.
Jaaaa, wir haben auch eine GY-Kollegin…..die kriecht auf dem Zahnfleisch….
Ich erinnere mich an meine Gymnasiallehrer: „Buch aufschlagen S… , los geht’s…‘. Den Rest der Stunde saßen die vorne am Pult und haben… nicht viel gemacht. Der Korrekturaufwand in der GS ist geringer, die Vorbereitungen in der GS sind dagegen viel intensiver. Dazu kommt das immens unterschiedliche Lernniveau der Schülerschaft. Inklusion… Eine Ahnung, was das an Differenzierung bedeutet? An zusätzlichen Elterngesprächen?
Hat dieser Beitrag wirklich mehr als anekdotische Relevanz? Ich hatte mal eine Grundschullehrerin, die … auch ne, lassen wir das.
Ja, mein Beitrag hat anekdotische Relevanz, in etwa soviel wie alle anderen, die auf Hören und Sagen beruhen, dass Grundschullehrer weniger arbeiten, mehr Freizeit haben, weniger Stress, geringer qualifiziert sind usw. … Das Alles! ist Unsinn!
Und ich frage mich schon immer, wie Studienräte ohne Grundschullehrerinnen in ihr Amt gekommen sind.
Fragen Sie besser die Studienrätinnen, falls die einen von den wenigen Grundschullehrern ab gekriegt haben sollten.
Das muss schon sehr lange her sein, oder es bezieht sich auf einen speziellen Lehrer. Leider gibt es solche immer noch, und die machen den Ruf aller Lehrer kaputt.
Es gibt eben überall ” sone und solche”.
Haben Sie denn schon mal Experimente im Physikunterricht in der SEK 1/2 vorbereitet, sowohl aufwendige Demo-Experimente als auch Schülerexperimente (keine Stunde ohne Experiment!)? Oder die Einführung partieller Integration? Oder didaktisch/methodische Konzepte ausgearbeitet, wie Sie Schülern Programmierung beibringt, in 25ger-Klassen?
Nicht? Woher nehmen Sie dann Ihre Feststellung, dass die Vorbereitung von Unterricht in der GS so viel aufwändiger wäre als am Gym? Und wie kommen Sie auf das schmale Brett, dass es an Gymnasien keine Inklusionsschüler gäbe? Gibt ja nicht nur GE-Schüler in der Inklusion!
Woher nehmen Sie Ihre Feststellungen bezüglich der Grundschule?
Welche Feststellungen meinen Sie?
Ich habe nirgendwo behauptet, dass Grundschullehrer überbezahlt seien und zu wenig arbeiten würden.
Was so ziemlich alle Lehrerarbeitsszeitstudien ergeben haben, ist, dass Gymnasiallehrer mehr Stunden arbeiten als Grundschullehrer (beides im Mittel betrachtet).
Mit freundlichen Grüßen,
Mika
Die Belastungen sind unterschiedlicher Natur, niemand behauptete, die der Gymnasialkeäfte wäre weniger erheblich. Sie ist zeitintensiv, die Arbeit an der Grunschule fordert dagegen stündlich (!) ein hohes Maß emotionaler Ressourcen.
Sie können auch für Entlastungen bei Korrekturen sein – wo Ihnen bestimmt die meisten beipflichten – ohne gegen andere Schulformen nach unten zu treten
Ich möchte nur sagen, DANKE, Prognos-Studie, DANKE! Alles, was immer wieder bestritten wird und wurde, ist hier belegt. DANKE!
Also stimmen alle anderen Studien nicht? Gibt es da Belege für?
Sie picken sich auch immer nur bestimmte Kirschen raus oder?
Auch die ungleiche Arbeitsbelastug unter den Lehrkräften schreit nach einer individuellen Arbeitszeiterfassung.
Die Länder sollten aufören, sich dagegen zu sträuben, wenn sogar die eigenne Gutachten die Notwendigkeit der Arbeitszeiterfassunng belegen.
Was wäre denn dann eigentlich die Konsequenz?
Die Grundschullehrkräfte arbeiten vermeintlich zu wenig, also sollen sie mehr arbeiten. Wird dadurch jemand anderes entlastet?
Wenn unsere drei Französisch- und Deutsch-Lehrkräfte in Arbeit versinken, hilft es Ihnen nicht, wenn der Sportlehrer zwei Stunden mehr arbeitet. Oder soll der dann deren Fanzösisch-Arbeiten korrigieren?
Wenn sich rausstellen sollte, dass wir MINT-Lehrkräfte zu viel arbeiten, soll der Latein-Lehrer dann fachfremd einen Kurs übernehmen und Chemie-Experimente mit den Schülern machen? Wir werden ja nicht mehr Physik- oder Chemie-Lehrer, nur weil ein anderer Lehrer mehr unterrichten müssen.
Klar, es muss eine ehrliche Arbeitszeit-Erfassung geben. Aber dann müsste man auch selbst schauen, wie man das individuell anpassen kann. Dann braucht die Korrektur eben länger, Unterricht wird auch mal weniger gut vorbereitet oder man muss eben außerunterrichtliche Aktivitäten streichen…
Die GS-Lehrkräfte arbeiten nicht zu wenig, weil auch sie mehrheitlich über dem Soll arbeiten…..sie arbeiten jedoch in der Gesamtheit weniger als GY-Kräfte….(besonders die, mit den aufwändigen Korrekturfächern)
Laut dieser Studie arbeiten alle Lehrer mehrheitlich über dem Soll, aber es gibt eben doch noch Unterschiede vor allem innerhalb der verschiedenen Schulformen)
Vielleicht sollte sich jeder mal selber ein Bild dieser Studie machen….sind ja nur 250 Seiten…..und nicht nur Bezug zu den Punkten nehmen, die in diesem Artikel rausgegriffen wurden….das finde ich schwierig….
Es müssen endlich so viele Planstellen eingerichtet und dann auch besetzt werden, wie tatsächlich notwendig sind. Dass das jetzige System „ham wa imma so jemacht“ nicht funktioniert, sehen Sie am ausbleibendem Nachwuchs. Die sehen doch, dass ihre Lehrer auf dem Zahnfleisch kriechen.
Ich sag nur – Personalausstattung an Schulen und in Kitas von 110% !
Ja, lang, lang ist´s her. War in einem wesentlich ärmeren Land als der reichen BRD.
An anderer Stelle habe ich das überspitzt dargestellt – nicht wahr. @Fräulein Rottenmeier.
Aber wie soll das laufen? Wir erhöhen die Wochenstundenzahl von GS-Lehrkräften und dann? Wie gehen wir dann in der praktischen Umsetzung vor. Mehr Lehrerstunden reduzieren die Zahl der Planstellen einer Schule. Am Prinzip des KL-Unterricht soll aber nicht gerüttelt werden. Für den offenen Ganztag sollen die Lehrkräfte vermutlich auch nicht eingesetzt werden. Und die Zahl der Klassenleitungen kann auch nicht reduziert werden. Und mehrere Klassenleitungen einer Lehrkraft sind auch nicht sinnvoll. Bleibt das Thema Mehrbedarfe, aber was ist die Politik bereit zusätzlich anzuerkennen.
Wieso sollte die Wochenstundenzahl der GS-Kräfte erhöht werden? Die arbeiten genau wie alle anderen Lehrer schon jetzt über dem Soll…..sind nur nicht so über den Soll wie manche GY Kollegen…..siehe Studie S. 86 und 87….. da kann man ziemlich gut erkennen, wie viel alle so arbeiten…
Ich habe nie davon gesprochen, dass irgendwas erhöht werden soll…..Sie scheinen mich zu verwechseln ….
Es geht doch (für die Lehrkräfte) im Kern nicht darum, dass andere mehr arbeiten sollen, sondern vor allem darum, dass die Lehrkräfte, die bisher wegen des hohen Korrekturaufwandes deutlich zu viel gearbeitet haben, endlich weniger arbeiten müssen.
Das muss nicht wochengenau geschehen, sondern kann auch im nächsten Halbjahr ausgeglichen werden. Lediglich wenn die Höchstgrenze von 48 Stunden pro Wochen überschritten wird (zum Beispiel bei Klassenfahrten oder im Abitur) muss sofort etwas geschehen. Zum Beispiel fällt dann der Untericht am Freitag für die beteffende Lehrkraft (Korrekturtag) aus oder mindestens vier Kollegen fahren gemeinsam mit einer Klasse, damit die gesetzlichen Ruhezeiten eingehalten werden können.
Die Lösung, dass Korekturen einfach länger dauern, ist in vielen Fälen nicht gangbar, weil viele Lehrkräfte so viele Korrekturgruppen haben, dass manche Klassenarbeiten ausfallen müssten, weil ja die neue Arbeit erst geschrieben werden darf, wenn die letzte zurückgegeben ist.
Ich selbst habe regelmäßig 7 Korrekturgruppen, 6 davon in Deutsch. Zwei bis vier der Deutschgruppen habe ich in der Oberstufe.
Und das kuriose bei den Korrekturen bzw. Leistungsbewertungen ist doch Folgendes:
Man liest die Arbeit durch und hat in Folge des ersten Eindruckes bezogen auf den Erwartungshorizont eine Notenstufe im Blick. Nach zeitaufwendiger Korrektur in mehreren Arbeitsschritten kommt man dann in über 90% der Fälle genau da an, wo man nach der ersten Inaugenscheinnahme schon ohne großen Aufwand gelandet war.
Neuer Vorschlag für das Schulministerium:
Unter Arbeiten steht nur noch die Note evtl. Punktzahlen, alles Weitere wird bei Rückgabe der Arbeit mündlich mitgeteilt und nicht mehr schriftlich unter der Arbeit festgehalten. Dann entfällt zumindest viel der quälenden Arbeit von der Sie berichten, die von den Kindern/Eltern eh nicht beachtet wird
EWHs sind eh Schwachsinn:
1. Wer sie durcharbeiten müsste tut das nicht – sonst wäre das Problem nicht vorhanden.
2. Wer sie NICHT durcharbeiten müsste tut es – ok, schadet soweit nichts.
3. Es kommt als Note eh trotzdem raus was der Lehrer will.
Reine “busy work” für den Papiermüll.
LLMs wie DeepSeek (mein neuer Favorit) oder ChatGPT sind hilfreich, ich sage nur so viel dazu…
Doch, es müssten dann mehr Lehrkräfte sein – für Physik und Chemie.
Oder es müssten andere Kräfte an den Schulen sein, die den NaWi-Lehrkräften hinterherräumen und reinigen und Sammlung pflegen – nach Ansage.
Oder es gäbe zusätzliche Kräfte für Aufsichten und Aufgaben der Differenzierung im Unterricht sowie die Vorbereitung/ Anpassung der entsprechenden Materialien.
Hinzu kommt, dass es ja große Unterschiede zwischen, aber auch innerhalb der Schulformen gibt: Lehrkräfte mit 35 Zeitstunden, Lehrkräfte mit 50 Zeitstunden in der Woche und irgendetwas dazwischen. Diese finden sich aber in allen Schulformen, argumentiert wird nun gerade wieder mit dem Schnitt.
Eine Grundschullehrkraft, die an die 50 h in der Woche arbeitet, versteht nicht, warum ihr unterstellt wird, sie würde weniger arbeiten … weil der SCHNITT das sagt. Ebenso arbeiten ja nicht alle Lehrkräfte an den SekII-Schulen immer an die 50 Stunden, sondern – individuell – auch weniger.
Deshalb bräuchte es andere Formen des Ausgleichs dafür, dass Lehrkräfte außerunterrichtliche Aufgaben übernehmen, und zwar nicht nur Korrekturen, sondern auch alles rund um die Inklusion, Konfliktbewältigung im Brennpunkt, Konzeptarbeit und Schulentwicklung, etc.
Wenn z.B. Gremienarbeit 4-5 Zeitstunden in der Woche braucht, dann können diese eben nicht in den Unterricht und die Vor- und Nachbereitung gehen. Und genau dafür müssen Stunden im System sein, um Lehrkräften für diese Aufgaben Zeit geben zu können. Und ebenso müsste es Zeiten geben für sehr viele andere Aufgaben, die alle erledigt sein sollen, für die aber nie die Zeit ausreicht.
Diese Stunden sind aber nicht in ausreichendem Maß vorhanden, angesichts der Aufgaben, die in den letzten 20 Jahren in den Schulen abgeladen wurden, und zusätzliche Aufgaben kommen stets ohne Entlastung oder Ausgleich hinzu.
Meine Schulleitung sagt immer, dass Anrechnungsstunden nur eine Anerkennung für zusätzliche Aufgaben, die man übernimmt ist, aber nicht den Arbeitsaufwand abdeckt. Das ist halt so, die Arbeit wird trotzdem erwartet. Die GS haben leider auch viel zu wenig davon, in unserem kleinen System 4 Stunden. Das ist im Vergleich zu den Aufgaben ein Witz.
Ist ja richtig, allerdings unterrichten doch fast alle Lehrer bereits fachfremd, weil viele Fächer ansonsten gar nicht mehr stattfinden würden.
Genau, das macht die ganze Rechnerei ja noch viel komplizierter.
Nachdem ich endlich, damals, eine Stelle bekam, habe ich eigentlich überwiegend fachfremd unterrichtet. Da ich das nicht mal “eben so” machen wollte, habe ich mich da sehr reingekniet. Diese Fortbildung für mich selbst hätte zeitlich jede Arbeitszeiterfassung gesprengt…
Habe mir dazu noch jahrelang Fächer wie Kunst und Hauswirtschaft (als Hauptfach) ans Bein gebunden mit dem ganzen Fachraum- und Materialgedöns. Schön blöd und selbst schuld könnte man/frau sagen. Nun ja, konnte noch nie so wirklich aus meiner Haut raus, war auch alles sehr bereichernd.Hat aber auch dazu geführt, dass ich frühestmöglich aufgehört habe.
“Was wäre denn dann eigentlich die Konsequenz?”
Die Konsequenz wird sein, denjenigen, die “zu wenig” arbeiten, zusätzliche Lerngruppen aufzubrummen.
Diejenigen, die “zu viel” arbeiten kann man aber leider nicht entlasten, da die entsprechenden Lehrkräfte fehlen (bzw. sie keiner bezahlen will). Oder man wird ihnen vorwerfen, nicht “effizient” genug zu arbeiten, mit typischer “Beamtenmentalität” die Zeit zu vertrödeln…
So bekommt man bei gleichem Personalschlüssel mehr Unterrichtsstunden ins System.
Und wieder sucht jemand das Heil in der Arbeitszeiterfassung. Das ist UNSINN und änderte gar nichts. Als ob, wer lange fürs Korrigieren braucht, mehr Stunden eintragen könnte als jemand, der kürzer korrigiert. Die FEHLVORSTELLUNGen, die hier immer wieder kursieren, sind wahre LACHNUMMERn!
Man würde sich in der Schule morgens in einem Portal einloggen bzw. bei Ankunft stempeln, beim Verlassen wieder aus und daheim in einem Portal ebenso. Am Tag werden 8 bis max. 10h angerechnet, Pausenzeit von 30-45 Minuten automatisch abgezogen. Wenn man durch einen Elternabend etc. darüberliegt, wird gekappt oder vorher in Ausnahmefällen(!!!) Mehrarbeit genehmigt durch die SL. Das gilt auch für Dienstreisen (Fahrten), Ferienzeiten, es sei denn, es wurden welche der 30 Urlaubstage eingetragen oder man macht Zeitausgleich geltend. Und in der eingeloggten Zeit wird erledigt, was zu tun ist: Unterricht, Sitzungen, Aufsichten, Korrekturen, Vorbereitung, Orga. Wer es in seinem vorgegebenen Zeitkontingent (ca. 40 Wochenstunden) schafft, bei dem:der passt es. Wer mehr Zeit braucht, hat Pech und erledigt das nicht Geschaffte eben für lau in seiner: ihrer Freizeit- wie bisher auch. Und man bekommt wie gehabt Klassen, Fächer. Aufgaben, Unterrichtsstunden etc. So ist’s auch in anderen Branchen, die z. B. teilweise Homeoffice anbieten.
In Zukunft müssen die Schulen ohnehin auch Betreuung für die Ferien und den Freitagnachmittag organisieren und gewährleisten, die gesetzliche Regelung für die Grundschule ist gerade angelaufen.
Kolleg:innen, bitte nicht blauäugig sein!
Ach Frau Löwig, natürlich kann ich die Zeit für Korrekturen eintragen, die ich individuell benötige. Fragen Sie eigentlich auch Richter, warum die unterschiedlich lange brauchen für ihre Fälle? Oder Ärzte, warum die für die eine Blinddarm OP länger brauchen als für die andere?
Wenn Sie Leuten Trödeln unterstellen, dann müssen Sie denen das nachweisen. Ansonsten gilt: „was ich selber denk und tu, das trau ich auch den andern zu.“. Bezeichnend, wie unterstellend Sie gegenüber Ihren Noch-Kollegen sind.
Die Rechtsgrundlage für „Was nicht geschafft wird, muss dann in der Freizeit gemacht werden, unbezahlt“ würd ich gern mal sehen. Ich bitte um Verlinkung.
Ehrlich, gehen Sie in Ihren 400+x Tagen in Pension, genießen Sie diese, und hören Sie einfach auf, solchen Mist zu erzählen.
Sehr geehrter Herr oder sehr geehrte Dame,
natürlich können Sie die Zeit eintragen, die sie aufwenden. Sie wird Ihnen aber nicht angerechnet, beispielsweise am Abend nach 20 Uhr, Wochenende oder wenn Sie über 10 Arbeitsstunden am Tag kommen. Das liegt daran, dass Sie dann bzw. so lange und ohne Pausen nicht arbeiten dürfen- steht im Arbeitsrecht (,das ja gerade ‘flexibilisiert’ werden soll). Sie als Lehrkraft hätten Aufgaben- wie jetzt auch- die für (angeblich) 40 Arbeitsstunden gedacht und zu erledigen sind. Schaffen Sie das, gut. Schaffen Sie es nicht, arbeiten Sie auf eigene Rechnung- also gratis. Natürlich gibt’s für letzteres keine offizielle Rechtsgrundlage- welche, mit Verlaub wenig durchdachte, wohl provokante, Frage stellen Sie da? Schafft man das Pensum auf Dauer nicht, kann/muss man remonstrieren- wie bisher auch und mit identischem Effekt (eher keinem), oder man macht eben unbezahlte Überstunden.
Der Richter: die Richterin, die die ihm:ihr zugeteilten Fälle bearbeiten muss, wird nach ebensolcher Systematik arbeitszeiterfasst. Niemandem wurde Trödeln ‘unterstellt’- dennoch ist es blauäugig zu denken, wenn ich besonders viel oder lang oder sorgfältig korrigieren will oder muss, würde das durch AZE wertgeschätzt.
Übrigens war ich vor ca. 5 Jahren einige Jahre abgeordnet in den Universitätsdienst- da lief die AZE GENAU SO.
Für Sie würde es mich freuen, wären meine Erfahrungen andere gewesen, mögen Sie mich gerne ins Unrecht stellen- es steht jedoch zu befürchten, dass Blauäugigen vom Dienstherrn ein böses Erwachen bereitet werden wird.
Alles Gute für Sie!
Wie kommen Sie auf Ihre Horrorvorstellungen?
Was Sie da beschreiben, wäre schlicht und einfach rechtswidrig. Die Gerichte haben längst entschieden, dass es eine individuelle Zeiterfassung der realen Arbeitszeit geben muss. Das willkürliche Kappen der Arbeitszeiterfassung wäre gar nicht erlaubt.
Erlaubt wäre eine Anordnung, dass niemand mehr als 8 oder 10 Stunden pro Tag arbeiten darf (und nicht mehr als 48 Stunden pro Woche) und dass auch an Sonn- und Feiertagen nicht gearbeitet werden darf. Wenn in dieser Zeit aber nicht alle Klausuren zu korrigieren sind, geht man zu seiner Schulleitung und schildert den Fall. Dann muss die Schulleitung ggf. Zum Beispiel einen Korrekturtag gewähren.
Mehrarbeit, die im gesetzlichen Rahmen bleibt, kann über ein Stundenkonto im nächsten Halbjahr ausgeglichen werden.
Nichts anderes ist meine Erfahrung. Allerdings wird ein übermäßiges Plus auf dem Stundenkonto im Mitarbeitendengespäch hinterfragt und man zum Abschmelzen aufgefordert- da lässt man dann die Korrektur der Arbeit sein und/oder sie wird an eine: Kolleg:in vergeben. Na klar, bestimmt läuft letzeres dann so. Also weniger Erfahrung habe ich bislang mit remonstrierenden Lehrkräften, die dann Korrekturtage o. ä bekamen. Wäre schön und wünschenswert. Wird sich aber im Rahmen halten- Mut ist nicht gerade die Haupttugend der braven und verbeamteten Lehrerschaft. Aber da sind ja noch die leuchtenden Kinderaugen….
Man kann ja viel verlangen. Abermals Beamte dürfen wir da ein dickes Fell haben und Selbstausbeutng ablehnen.
Richtig. Aber wir tun es ja nicht!!!
Wir gehen uns gegenseitig an und rechtfertigen uns reflexartig in der Öffentlichkeit. Und kuschen brav. Und im Zweifel beuten wir uns selbst aus: finanziell, zeitlich, emotional- Stichwort leuchtende Kinderaugen.
Deshalb gibt’s ja kaum eine Unverschämtheit, die man uns nicht entgehenschleudert.
Aber AZE läuft auch nicht so, wie so manche:r hier erträumt!
„Wer mehr Zeit braucht, hat Pech und erledigt das nicht Geschaffte eben für lau in seiner: ihrer Freizeit- wie bisher auch.“ Genau das passiert dann eben nicht mehr, u.a. auch, weil die Kollegen endlich mal sehen, wie viele unbezahlte Mehrarbeit sie im Moment leisten.
Für die Betreuung in den Grundschulen sind übrigens Mitarbeiter des offenen Ganztags zuständig, die werden von der Kommune eingestellt und bezahlt. Lehrerstunden dürfen nur in unterrichtliche Tätigkeiten einfließen (z.B. in die Hausaufgabenzeit).
Ihr Wort in Gottes Ohr. Möge es so sein und vor allem bleiben. Das wünsche ich Ihnen sehr. Was passiert wohl, wenn die Kommunen keine Leute haben oder rumheulen wegen der Kosten? Was werden die Länder, in deren Verantwortung die Ganztagsbetreuung liegt, tun?
Wurde da nicht mal eine Quote eingeführt, welcher Stundenanteil der GTS von Lehrkräften abzudecken ist? Ist in rlp so- woanders auch (dann irgendwann?).
„Für die Betreuung in den Grundschulen sind übrigens Mitarbeiter des offenen Ganztags zuständig, die werden von der Kommune eingestellt und bezahlt. Lehrerstunden dürfen nur in unterrichtliche Tätigkeiten einfließen (z.B. in die Hausaufgabenzeit).“
Es ist genau festgelegt, wie viele Lehrerstunden in die jeweilige OGS zu fließen hat. In NRW gibt es dazu zwei Modelle, die vertraglich festgelegt sind. Entweder muss die Schule 0,2 oder 0,4 LehrerStellen je Gruppe (25 Kinder) einfließen lassen. Das hängt mit dem vereinbarten Landeszuschuss zusammen. Zusätzlich müssen bei Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf noch 0,2 Stellen je Gruppe (12 Kinder) zur Verfügung gestellt werden.
Wir stecken bei uns 0,8 Lehrerstellen in die OGS…..
Die Kollegen, die in der OGS sind machen Hausaufgabenbetreuung und übernehmen auch AGs…..sie dürften aber auch in Mittagessenbetreuung (halbe Anrechnung)…..das ist Absprache…..Vorgabe ist lediglich, dass möglichst unterrichtsnah einzusetzen sind……
Bis einer kommt und klagt.
Ich verstehe nicht, warum Arbeitszeiterfassung in allen Berufen funktionieren soll, nur bei Lehrern nicht.
Bei uns ist der Freitag betreuungstechnisch ein ganz normaler Werktag. Ferienbetreuung gibt es schon seit Jahren.
Das verstehe ich auch nicht. Die Dienstherrn und -damen haben wohl doch Angst vor den Ergebnissen?!
Aber auch hier ergeben sich Probleme, welche am Ende nicht in der Verantwortung der Geldgebenden liegt, aber echte Auswirkungen haben könnte:
– arbeitet die Kolleg*innen effektiv im Team oder jede/r für sich?
– arbeiten die Kolleg*innen tagesaktuell, alltagsbezogen oder aus vorgefertigtem Material?
– machen sich Kolleg*innen die Mühe, extra Zeit in wertvolle, aber nicht notwendige Ideen/ Projekte zu investieren?
Wie wird das wohl am Ende bezahlt? Ich würde schätzen, am Ende gilt: so wenig, wie möglich – Qualität kann (!) auf der Strecke bleiben…
Geliefert wird dann, was bestellt wird. Das ist in anderen Berufen nicht anders.
(Abgesehen davon würde ich bestreiten, dass das Arbeiten im Team effizienter ist. Bevor die erste Diskussion im Team abgeschlossen ist, habe ich meinen Unterricht schon vorbereitet.)
“Das ist in anderen Berufen nicht anders.”
Das ist in anderen Berufen VÖLLIG anders 😀
Bezüglich des Teams stimme ich Ihnen zu, dass Ihre Erfahrungen bewahrheiten können, daneben gibt es aber auch Beispiele, bspw. von Hattie, wo sich Kolleg*innen die Unterrichtsplanung untereinander aufteilten und so sehr effizient arbeiteten.
Sollen diese nun “abgestraft” werden? Oder soll dies als Norm anderen zur Last gelegt werden, wo sich keine Teamarbeit ergibt?
Ich bin, als jemand der eher viel zusätzliche Zeit – in beknackte Projekte 😀 – investiert, skeptisch bezüglich einer “angemessenen” Bezahlung, geschweige einer möglichen Steuerungsfunktion durch individuelle Arbeitszeiterfassungen…
Wer schneller arbeitet wird nicht abgestraft. Am Ende arbeiten schließlich alle dieselbe Zeit.
In Deutschland galt bislang immer die reine Anwesenheit im Betrieb als Arbeitszeit. Das wurde, durch Corona nochmal ganz verstärkt, aufgeweicht…Homeoffice etc. wurden möglich.
Jetzt gibt es neue Bestrebungen, dass nach fertig gewordenen Projekten/Aufgaben bezahlt wird und nicht mehr die reine Arbeitszeit zählt…für den Lehrerberuf ein Alptraum, denn dann passiert genau das, was Frau Löwig (ich hoffe, dass das so richtig ist) schon beschrieben hat…es werden Zeitkontingente angerechnet und alles darüber hinaus ist Pech.
Das ist eben eine Frage des eigenen Anspruchs und der Zeit/Belastung:
Will ich in den MINT-Fächern jede Stunde zumindest ein kleines Experiment machen?
Passe ich meine Materialien an die aktuelle Lerngruppe an?
Suche ich im Alltag nach neuen Aufhängern, Beispielen und Kontexten?
Gerade im Ref wird man ja darauf trainiert, großartige Zauberstunden zu machen, die unfassbar viel Vorbereitung benötigen.
Wenn sich aber die Klausurstapel auf dem Schreibtisch sammeln, wird man eben auch mal solide Stunden machen, die einfach mit einem netten Einstieg und dem Buch laufen. Das müssen auch gar nicht die schlechtesten Stunden sein.
Im Durchschnitt dürften wir nicht mehr (eher weniger) als eine Stunde Vor- bzw. Nachbereitung pro Unterrichtsstunde benötigen. Immer wenn irgendwo mehr ansteht (z.B. der Klausurenstapel korrigiert werden muss, Elternsprechtage oder eine Klassenfahrt anstehen), müsste man an anderer Stelle Arbeit einsparen. Anders ist das auch nicht bezahlbar.
Sie unzeichnen meiner Meinung nach das Problem: Korrekturzeit muss gegen (vorbereitete) Lernzeit aufgerechnet werden. Vielleicht kann da KI irgendwann mal einen Beitrag leisten, aber ich fände es schlimm, wenn Sie sich in MINT zwischen Experiment und gesetzter Arbeitszeit (welche Ersteres nicht berücksichtigt) “entscheiden” sollen 🙁
Eines Nachmittags vor etlichen Jahren in der Physiksammlung unseres Gymnasiums. Mehrere Kollegen und ich sind dabei, Demonstrationsversuche vorzubereiten. Die Türe zum Flur steht offen.
Der Chef – auf dem Weg zur Tiefgarage – geht vorbei, sieht uns und äußert seine große Verwunderung, zu dieser Zeit hier noch jemanden vorzufinden.
Ich hab’s ihm so erklärt: “Tja, in der Physik wird vormittags gelehrt und nachmittags geforscht”.
Das ist eben ein Punkt, den man nicht versteht, wenn man keine NaWi-Fächer unterrichtet:
Wenn man guten Experimentalunterricht machen will, geht eben eine Menge Zeit drauf zum Ausprobieren, Vorbereiten, aber auch mit dem Abbauen, Entsorgen, Spülen und Wegräumen. Und wenn ein Versuch oder gar ein Gerät mal nicht funktioniert, kostet es eben auch Zeit.
Gerade in Chemie und in der Chemiedidaktik passiert so viel, dass man immer wieder akutelle Experimente ausprobieren kann.
Übrigens:
Wenn man es mit den schriftlichen Gefährdungsbeurteilungen wirklich ernst nehmen würde, hätte man ca. 3 Seiten schriftliche Beurteilungen für jedes einzelne Experiment, für jede Lerngruppe und jeden Raum neu. Damit käme man kaum noch zum Experimentieren.
Dennoch machen MINT-Fächer macht durchaus Spaß, aber wir haben dennoch Arbeit, die man in anderen Fächern nicht in der Form hat.
Genau so ist das. Und da sind auch noch keine Korrekturen dabei. Ich habe 2 Bio 11er mit 29 SuS pro Klasse. Ich schaue zu meinem Englisch-Kollegen: Ihm wurde die Klasse geteilt (weil er sich so sehr beschwert hat bei der SL) und er chillt (natürlich übertrieben von mir) jetzt mit der Hälfte der Schüleranzahl. Ich gönne ihm. Gönnte es mir aber mehr, da ich noch an 2 Tagen 60km weit weg abgeordnet bin. Durch das Landstraßengegurke muss ich jede Woche insgesamt 7 Stunden mehr von meiner Zeit abzwacken. Man kann es eben nicht jedem recht machen, schon verstanden. Aber der Frust wächst und wächst. Sorry, ich bin etwas abgeschweift. Mir kommt da ein Gedanke. Es wird seit 2-4 Jahren weit weg abgeordnet. Ich hege (aufgrund meiner eigenen Beobachtung) die Vermutung, dass aufgrund der Abordnungen die Abweichungen in der Arbeitszeit nicht noch deutlicher war. Die 7 Stunden rechnete ich nämlich nicht als Arbeitszeit in der Studie mit ein. Die Stunden fehlen aber in meiner Vorbereitung. Irgendwann muss man sich auch mal erholen.
Tja, Scheißspiel!!
Tut mir leid … und da sind wir wahrscheinlich die einzigen, denen es leid tut.
Mein Mitgefühl hast du!!
Schließe ich mich an.
Das ist scheinbar unmöglich nachzuvollziehen. Vielleicht liegt es etwas daran, dass MINT für viele schon zu Schulzeiten sinnlose Pflichtfächer waren und es unvorstellbar erscheint, dafür auch noch echten Einsatz zu zeigen und das gerne zu machen. Gilt für Sport nicht weniger, keiner will den Job der Sportkollegen, aber viele müssen unbedingt betonen, wie wenig die doch arbeiten und wie wenig sie ‘echte’ (Korrektur-)arbeit haben. Es gibt Kollegen mit D/E/F/Span…, die kommen jeden Tag drei Minuten vor Unterrichtsbeginn und verschwinden ebenfalls drei Minuten nach der letzten Stunde, bei allen praktischen Fächern unvorstellbar.
Mit Physik, Chemie, den Sammlungen, den Experimenten, Korrekturen in NW und Oberstufe, Reparaturen, experimentellen Facharbeiten und den üblichen anderen Kleinigkeiten wie KL, fachfremdem Unterricht, Verwaltung und Konferenzen bin ich gut ausgelastet. Ich kann aber auch zu 100% sicher sagen, dass ich die Arbeitszeiten niemals korrekt kleinteilig eingetragen hätte und wahrscheinlich zu wenig herausgekommen wäre. Wie die Ankreuzliste aussieht weiß ich nicht, aber jedes, wirklich jedes Formular bei uns wurde von ‘Sprachlern’ erstellt und passt nicht zur NW-Realität, wenn das in dieser Buchhaltung auch nur etwas ähnlich ist…
Bei uns s wäre das so,dass die SL am Razm vorbeigeht, hineinsieht, KuK bei der Arebit sieht und dann – ohne Kommmentar, Nachfrage, Restinteresse o.ä. ins Auto steigt um nach Hause zu fahren.
“Ich will’s nicht wissen – es ist mir egal – Hauptsache der Laden läuft!”
Unsere würde wahrscheinlich noch fröhlich was von „schönem Feierabend“ rufen…
„Eine geringere Wochenarbeitszeit ist nicht gleichzusetzen mit geringerer Beanspruchung.“
Das ist sein sehr sehr wichtiger und weiser Satz.
Gruß geht raus an alle, die Sportlehrkräfte pauschalisierend als Minusstundler an den Pranger stellen.
Ja, genau!
Gilt auch für Musik, wenn getrommelt, gepfiffen oder gegrölt … ääähm … gesungen wird …
Gilt auch für Klassen in der Mittelstufe und alle darunter (Lärmbelastung, psychische Belastung = Originalität im Verhalten – oft im Pulk! , Lehrplan im Nacken und Eltern im Nacken und Kids mit viel zu wenig Grundwissen, Kinder mit psychischen Störungen, Kinder mit Kriegserfahrung, Gruppen ohne Deutschkenntnisse in der Regelklasse usw…)
Da fällt man zuhause auf’s Sofa …
So ist es
Die Pflichtstunden für Lehrer in Bayern variieren je nach Schulart: An Grundschulen beträgt sie 28 Wochenstunden, an Mittelschulen 27 Wochenstunden und an Gymnasien sowie Realschulen 23 Wochenstunden (wissenschaftliche Fächer) oder 26 Wochenstunden (Musik/Kunst/Sport). Ist das nur in Bayern so? Die unterschiedlichen Besoldungsmöglichkeiten lassen hier doch auch eine unterschiedliche monetäre Wertschätzung erkennen Grund und Mittelschule bis A13 , Realschule bis A15, Gymnasium bis A16…ich verstehe das Problem ned so ganz…Der Vergleich ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit…wenn ich auf meinen Gehaltszettel blicke bin ich zufrieden (A12Z) wenn ich sehe, das Kollegen mit 20 Jahren weniger Berufserfahrung A13 haben, könnte ich doch…Ich habe 27 Schüler, Kollegen haben nur 16….;-) muss ich aber nicht. In diesem Sinne…Ihr wusstet es doch vorher. Oder etwa nicht? Grüße aus Bayern
Ja, in anderen Bundesländern ist es anders. In NRW unterrichten die Lehrkräfte an Gymnasien alle 25,5 Stunden. Es wird kein Unterschied nach den Fächern gemacht. In den anderen Schulformen unterrichten Lehrkräfte mehr Wochenstunden als an Gymnasien, das ist ähnlich.
Dennoch gitb es die Pflicht de Länder zur individuellen Erfasung der Arbeitszeit. Dassit auch sinnvoll,denn auch in Bayern wird es ja zum Beispiel so sein, dass während Klassenfahrten die Lehrkräfte rund um die Uhr im Dienst sind, und so die maximal erlaubte Arbeitszeit so stark überschreiten, dass sie in einer Woche die Arbeitszeit von drei Wochen abgeleistet haben. (Für Teilzeiträfte ist es noch schlimmer.)
Im Text wird konkret auf die Belastung der Lehrkräfte eingegangen, die mit dem Unterricht in inklusive Klassen einhergeht. Dies gilt nicht nur für die Grundschulen, sondern auch für die Sek1 der Gesamtschulen. Während mein Kollege Sek1 Gesamtschule abends völlig fertig ist, bereitet seine Kollegin Sek1+2 Gymnasium abends noch fröhlich Unterricht vor, weil der Unterricht an sich nicht so belastend ist. Das MUSS in Arbeitszeit berücksichtigt werden!
Ich glaube das Beste, was die Ministerien machen können ist, eine Sozialneiddebatte unter Lehrkräften auszulösen.
Teile und herrsche.
So beschäftigen wir uns alle damit, wer angeblich nicht genug arbeitet und vergessen, dass jede unbezahlte Überstunde gesetzeswidrig ist und jedem Lehrer, der auf Grund von Korrekturen oder Klassenfürhung oder hohem Unterrichtsaufwand auf Grund der Fachwahl nun haben. Dass das Unterrichten von zwei Klassen gleichzeitig in der Grundschule häufiger vorkommt als vielleicht in anderen Schularten ergibt sich aus der Schulartspezifik. Ich hatte auch schon drei Klassen. Das haut anders rein. Dennoch will ich keinesfalls, dass meine Kollegen in den Gymnasien gerade in den Fächern mit längeren Texten weiter ausgebeutet werden.
Die Studie kann jeder gern nachlesen. Ab S.112 werden die schulartspezifischen Unterschiede diskutiert. Achtung. Wer bei den Grafiken genauer hinsieht und nachrechnet, kann die grau angezeigten Prozentzahlen vielleicht nicht ganz nachvollziehen. Aber es eignet sich super, um damit Lehrer aufeinander und nicht auf die Arbeitgeber zeigen.
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/48353
Genau das ist es, was hier läuft … und was dickebank zum Trollen bringt … was gar nicht seine Art ist, sich aber aus dieser unsäglichen “Gerechtigkeitsdebatte” ergibt, die hier institutionell angefeuert worden und an der Basis für heftige Beiträge sorgt.
“Jeder einzelne Finger lässt sich leicht brechen – aber eine Faust schafft die Kraft zum Zuschlagen, die man hier benötigt.”
Recte quidem
Ganz genau! Danke für diesen Beitrag! Mögen sich alle wieder in einer ekelhaften und lächerlichen Neiddebatte zerfleischen. Ich kann es nicht mehr ertragen.
Den Dienstherrn freut‘s!
Glauben Sie ernsthaft, das Thema würde in den Kollegien nicht wahrgenommen, wenn Medien wie News4teachers nicht darüber berichten würden? Wir sind nicht der Meinung, dass sich Probleme durch Verschweigen von selbst lösen – dann gäb’s uns nämlich nicht. Herzliche Grüße Die Redaktion
Es ging eher um die Forenbeiträge.
Es stimmt, dass man berichten muss, auch wenn ich gerade die Spalte der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen S.114 (Seitenanzahl nach Seite im Dokument benannt), anders interpretieren würde, als Sie es in Ihrem Artikel tun.
“Insgesamt liegen Grundschule und Gymnasium „positiver“ als der Gesamtschnitt, während Ober-schulen (Vollzeit) und berufsbildende Schulen (beide Umfänge) im Vergleich eher im negativen Bereich liegen. Die Förderschulen bewegen sich nahe der Nulllinie.”
Trotzdem glaube ich jeder Berufsschullehrkraft, die sagt, dass sie mit ihrem Pensum nicht klar kommt. Weil die, die es wirklich gewissenhaft machen und die Qualität der Bildung sichern hier klar zu denen gehören, die mehr arbeiten.
Bzw. ist es bei dieser Studie ja enorm auffälltig, dass man eine echte mit Zahlen belegte Aussage dazu, wie viel die verschiedenen Lehrkräfte arbeiten, nicht einfach findet.
Die Studie hatte irgendwo auch sinngemäß den Satz: Der Unterschied der einzelnen Lehrkräfte in einer Schulform ist großer als der, zwischen den Schulformen. Finde den jetzt leider auf die Schnelle nicht mehr.
Mein Fazit wäre: Qualität braucht ihre Zeit.
Welches Fazit die Kultusministerien ziehen… nun, das bleibt abzuwarten.
Auch hier gilt vermutlich: Qualität braucht (viel) Zeit … 🙂
Es geht nicht um die Berichterstattung, es geht um die Reaktion der Leserschaft hier. Davon abgesehen würde ich mir aber eine grundsätzlich kritischere Betrachtung von Studien wünschen, egal für wen diese von Vorteil sein könnte.
Sie sind doch selbst ziemlich hart dabei, Gymnasiallehrer abzuqualifizieren als „müssen nicht so differenzieren“, „blicken despektierlich auf insbesondere GS-Lehrer hinab“ und dergleichen. Sie fördern also genau diese Zerfleischungsdebatte, die Sie als unerträglich bezeichnen.
Kommt mir nicht sehr glaubwürdig vor, was Sie hier so von sich geben.
Ich habe aber auch keine öffentlichen Artikel geschrieben. Das ist schon ein Unterschied, ob ich als Lieschen Müller meinen Senf dazugebe oder ob dies Journalisten tun. Die Zerfleischungsdebatte ist doch seit Jahren in Gang und ich muss die Frage wohl nicht beantworten, wer hier wen zerfleischt. Leider haben wir GSKollegen keine starke Gewerkschaft oder Verbände im Rücken. Wer qualifiziert denn bitte permanent die GSLehrkräfte als Lehrer 2.Klasse in der Öffentlichkeit ab? Der Philologenverband ist diesbezüglich ganz vorne mit dabei. In RLP kann man dies ständig in der Zeitung lesen. Da will man mit aller Macht verhindern, dass wir GSLehrer auch A13 bekommen. Tun Sie nicht so, als ob es an der Tagesordnung wäre GymKollegen abzuqualifizieren. Wer ist hier unglaubwürdig?
Welche Journalisten qualifizieren denn Grundschullehrer ab? Hier auf N4T? Ist mir noch nicht untergekommen.
Wenn ich Ihre Sprüche allein auf dieser Plattform lese, dann teilen Sie ziemlich heftig gegen Gymnasiallehrer aus. Kann man machen – sollte sich dann jedoch nicht beschweren,wenn man als Gesprächspartner nicht mehr ernst genommen wird.
Im übrigen: wenn es Sie tröstet: als angestellte Lehrkraft am Gym hab ich selbst in der höchsten Erfahrungsstufe (nach rund 30 Jahren) in der E13 deutlich weniger raus als jemand in der A12 nach zwei Jahren.
Mit freundlichen Grüßen,
Mika
Mein Gott, lesen Sie mal genau! Ich habe nirgendwo geschrieben, dass N4T oder andere Medien Grundschullehrkräfte abqualifizieren. Es ging um den Umgang mit Studien.
Ich teile dann gegen GymLehrkräfte aus, wenn diese Grundschullehrkräfte abqualifizieren, was recht häufig passiert. Redet einem wahrscheinlich der Philologenverband ein, dass man was Besseres wäre….
Mir ist sch…egal, was Sie verdienen!
Ist für mich keine Frage des Glaubens: Als Ex-Grundschulkollegin stehe ich neben Ihnen und ignoriere z.B. auch den arroganten Philologenverband. Fühle mich seit zig Jahren bestens aufgehoben in der GEW. Integrierter Rechtsbeistand ist sehr zu empfehlen, hilfreich auch bei allen Gehaltsthemen.
Ich halte die Diskussion um Arbeitszeitvergleiche zwischen Schularten und Fächern für fruchtlos und destruktiv, denn man wird meiner Einschätzung nach keine übergeordnete Regelung (Arbeitszeiterfassung) finden, die hier von außen für deutlich mehr „Gerechtigkeit“ sorgen wird.
Die Art der Lehrtätigkeit an unterschiedlichen Schulformen ist geprägt durch ganz unterschiedliche Herausforderungen und Lehrerkompetenzen und da muss die Gesellschaft entscheiden, was ihr diese Arbeit wert ist, auch um Personen für den Beruf zu gewinnen. Auch wenn ich als Gymnasiallehrer vielleicht statistisch etwas mehr arbeiten muss, halte ich eine A13-Bezahlung für Grundschullehrer für angemessen.
Gewisse schulinterne Ungleichheiten sollten und können nur kollegial im Gespräch und von einer Leitung mit Fingerspitzengefühl gelöst werden. Daneben gibt es ohnehin zu viele Unterschiede in der Arbeitsweise, qualitativ, quantitativ, in der Effizienz, als dass eine äußere Regelung alle Fälle erfassen könnte.
Ich denke da z.B. an einen Kollegen, der in Teilzeit mehr arbeitet als ich in Vollzeit, weil er zu 120% Genauigkeit und Formalität neigt. Damit benötigt er für gewisse Vorgänge ungefähr doppelt so lang wie ich, die Arbeit ist dann aber auch perfekt erledigt. Andere haben aufgrund von fehlender digitaler Routine ebenfalls einen höheren Zeitbedarf, ohne dass ihre Arbeit schlechter oder besser wäre. Wessen Zeitaufwand ist nun der Maßstab? Da kann man viel diskutieren, ohne wirklich zu einer „gerechten“ Lösung zu kommen.
Die einzige Sache, die meiner Meinung nach grundlegend angegangen werden muss, ist, dass Teilzeitkräfte tendenziell deutlich mehr arbeiten als ihre Gehaltszettel hergibt.
Wahres Wort gelassen ausgesprochen. Wird in anderen Behörden ja auch nicht gemacht.
Mögen Sie so sehen. Ich persönlich sehe die Ausuferung der Arbeit bei uns allein dadurch, dass meine SEK 2Kurse (Korrekturfach) 30 SuS umfassen, die meiner Korrekturfachkollegen ebenfalls. Und nein, die Korrektur eines 30min -Tests in der SEK 2 ist sowohl vom zeitlichen Aufwand als auch von der notwendigen Konzentration nicht vergleichbar mit der Korrektur eines 30 min -Tests in der SEK 1. Da ich das Pech habe, als einer der letzten verbliebenen grundständig ausgebildeten Kollegen meiner Fächer fast ausschließlich in der SEK 2 eingesetzt zu sein, sehne ich die Arbeitszeiterfassung herbei. Kommt sie nicht, werde ich, obwohl Mitte 50, den Job wechseln und den Schuldienst verlassen (nicht schwer mit Mathe und Informatik, aber ich wechsle die Branche dann komplett). Die seit Jahren immer schlimmer werdende Belastung ist nicht mehr tragbar.
Es geht hier überhaupt nicht um Gymnasium gegen Grundschule, Mathe gegen Sport oder so. Es geht allein darum, dass die individuell erbrachte Arbeitszeit endlich erfasst und in Fällen wie meinen endlich Abhilfe geschaffen wird.
Danke für die konkrete Stellungnahme, @Mika.
Ich sehne es auch herbei,
und ja, manches machen manche vielleicht akribischer, aber das ist doch in anderen Berufen auch so.
Aber die unendlich vielen Zusatzaufgaben müssen mit erfasst werden. Die werden ja nicht weniger, weil man sie anderen Leuten zuschiebt, die dann wieder zu viel haben. Es passt einfach nicht.
Und auch die Bedingungen in den verschiedenen Standorten führen zu ganz unterschiedlichen Aufgaben, die mehr Zeit in Anspruch nehmen (müssen), weil man bestimmtes Klientel sonst nicht erreicht – was wir uns auch nicht leisten können.
Zudem: Wenn erfasst wird und ausgeglichen werden muss, muss man in Zukunft bei jeder Änderung und jeder Aufgabe, die in Schule gegeben wird, den Aufwand und die Kosten mit einpreisen. Dann kann man ja mal überlegen, ob man im 3-6-Monats-Takt Formvorschriften ändern will und ob man Daten der Statistik wirklich mehrfach abfragen muss oder innerhalb der Behörde auswerten und weitergeben kann.
Das schaffen andere Länder ja auch. Ich verstehe echt nicht, warum die Länder hier den Blick nach z.B. Schweden verweigern…
Ich spreche mich nicht gegen die Arbeitszeiterfassung aus, ich halte das Gegeneinander von Kollegen für kontraproduktiv.
Deshalb fordere ich ja auch eine detaillierte Stellen beschreibung für alle möglichen Profile, die durch Fächer, Schulform etc. bedingt sind.
Es wird sich zeigen, dass eine große Zahl von Merkmalen auf alle lehrkräfte zutrifft, es aber auch eine Vielzahl unterschiedlicher, spezifischer Unterscheidungsmerkmale gibt. Das ist aber nicht unüblich, das betrifft ja das Profil von “Kaufleuten” in Wirtschaftsunternehmen ebenso. Ist da aber auf der Grundlage von tariflichen Vereinbarungen weitestgehend rechtssicher geregelt.
Ja, und selbst wenn Sie zwei Kollegen in derselben Schule mit denselben Fächern in denselben Jahrgängen haben: hat mein Grundkurs Mathe 30 SuS und der LK Mathe des Kollegen nur noch 6, ist die Belastung einfach ungleich verteilt, zumal mein Kollege dann 5 Deputatstunden dafür hat und ich nur 4.
Es bleibt nur die Erfassung der individuellen Arbeitszeit.
Deshalb unterschreibe ich Ihren letzten Satz.
Bis jetzt habe ich es so erlebt, dass die SekII als “Aushängeschild” weitestgehend verschont blieb vor Unterrichtskürzungen, Kurszusammenlegungen. Ich habe allerdings als sekI-lehrkraft an einer GE gearbeitet. Kurszusammenlegungen und Stundenstreichungen haben da zuallerst die SekI betroffen. Mittlerweile ist der Lehrermangel aber so eklatant, dass selbst in der SekII Maßnahmen ergriffen werden müssen, da die lehrkräfte mit befähigung für SekI+II ja nicht überwiegend in der GOSt eingesetzt werden können und einen teil der Unterrichtsverpflichtung in der SekI abhalten müssen, da sonst die Stellenbemessung nicht passt. Stundenstreichungen sind beim Oberstufenunterricht nicht möglich, da der Umfang von LG und GK verbindlich geregelt ist. So bleibt nur Zusamenlegen und Erhöhen der Teilnehmerzahl Statt der drei Bio-GK mit um die 18 SuS, zwei mit 27 bis 28 SuS.
Nee, bei uns wird seit Jahren zusammengelegt und die Kursgrößen werden immer höher getrieben. Und wie Sie an mir (und etlichen meiner Kollegen) sehen, gleicht sich der Mehraufwand in der SEK 2 schon lange nicht mehr durch kleinere Kursgrößen oder Unterricht in der SEK 1 aus. Die Quereinsteiger werden in 7-9 (manchmal bis 10 – so groß ist die Not) eingesetzt, die ausgebildeten Lehrkräfte gehen in die SEK 2, damit das Abi rechtssicher ist.
Verstehe ich niocht ganz. Ich kenne nur einen Fall, in dem eine Kollegin mit Lehrbefähigung für die SekI in einem Fach für das sie Fakultas hatte, ausnahmsweise in der EF unterrichten durfte, da sonst der Kurs hätte gestrichen werden müssen.
Das von Ihnen beschriebene Vorgehen, geht doch nur an GY, da dort alle grundständigen lehrkräfte über eine lehrbefähigung für die SekI+II verfügen. Wie gesagt, ich bin in NRW an einer GE gewesen und da haben im Vollausbau lediglich 40% des Kollegiums die Lehrbefähigung für die SekI+II. Alle anderen sind SekI-Lehrkräfte – sowohl die grundständigen Lehrkräfte als auch die Seiteneinsteiger nach erfolgreichem OBAS-Abschluss..
Ich unterrichte am Gym. Wir haben inzwischen in bestimmten Fächern kaum noch grundständig ausgebildete Kollegen, die in SEK 1 und SEK 2 unterrichten dürfen. Die Quereinsteiger dürfen nicht in die SEK 2: also werden sie insbesondere in den niedrigen Klassen der SEK 1 eingesetzt. Demzufolge müssen die ausgebildeten Kollegen wie ich vorrangig die SEK 2 abdecken. Das führt zu der beschriebenen übermäßigen Belastung, da der Ausgleich durch weniger korrekturintensive Jahrgänge (die niedrigeren) fehlt und die Kurse in der SEK 2 bei uns meist größer sind als die Klassen (Kurs: 28-30, Klasse: je nach Jahrgang zwischen 22 und 30). Das liegt daran, dass das Schulamt keine kleineren Kurse genehmigt, solange die 31 nicht überschritten werden.
Ich habe das Pech, drei Mangelfächer studiert zu haben. Also bin ich mit all diesen Fächern in der SEK 2 und habe lediglich einige wenige Stunden (3) in Klasse 8 und 9.
Drei Mangelfächer …… klingt jetzt nicht gerade nach Abiturskorrekturen.
Mathe, Physik, Informatik.
Klingt ziemlich sehr nach Abiturkorrekturen. In Informatik kommt die Erstellung der Abiturvorschläge dazu, weil dezentrales Prüfungsfach.
30 minütige Tests? Was habt ihr denn für Regeln? Bei uns in NRW sind nur die Klausuren verpflichtend in der Sek2.
Sie haben keine schriftliche Leistungserfassung außerhalb von Klausuren? Das ginge in BB nicht. In Mathe schon garnicht.
Das große Problem ist tatsächlich, dass ein großer Teil der Lehrerarbeitszeit unsichtbar bleibt, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Das liegt auch schon daran, dass sie häufig zu Hause passiert. Da ist die konkrete Erfassung ein möglicher Weg. Eine zusätzliche, evtl. auch ergänzende Möglichkeit sehe ich in der Präsenzzeit. Das kann auch eine Teilpräsenz sein, so dass aber klar wird, wie viel Zeit außerhalb der Schule überhaupt noch zur Verfügung steht. Vielleicht käme man über einer Kombination von beiden zu einer Lösung.
Gebt mir einen Arbeitsplatz in der Schule, und ich bin dabei.
Es wird ja schon viel über die Architektur als den dritten Pädagogen (wer war nochmal der zweite?) berichtet. Vielleicht ist ja ein kleiner Arbeits(!)platz drin, als Alternative zu den offenen Arbeitslandschaften, genannt Lehrerzimmer, für Kollegen, die sich während der Büroarbeit lieber introvertiert geben, als in verordneter Gruppenarbeit zwangsweise Sozialkompetenzen zu üben.
Vielleicht sollte ich den Raum bitten, die Korrekturen zu übernehmen? Der dritte Pädagoge kann auch mal was tun.
😉
Kein Platz
„Divide et impera.“ … „Wem nutzt es? „
Dann bitte doch “cui bono”!
Ich halte es für unglaublich dumm,wenn Lehrkräfte begonnen,sich gegenseitig auszuspielen und in die Pfanne zu hauen. Sinn macht allein der Zusammenhalt,um eine einheitliche Front gegen den Arbeitgeber aufzubauen-um gemeinsam die Belastungen zu verbringen.
Es ist außerdem unglaublich naiv zu glauben,die Belastungen wurden weniger oder gerechter,wenn man Arbeitszeitkonten einrichtet. Glauben wir wirklich,die Schulbehörden wären an Gerechtigkeit und Arbeitsschutz interessiert? In erster Linie ist das ein Politikum. Es geht in erster um Zahlen und Ausfall und darum,dass irgendein Heini vor der Klasse steht und ins Klassenbuch ein schreibt. Man sollte die Frage stellen: Warum gibt’s denn zu wenig Lehrer*innen?
Vielen lieben Dank! Genau so ist es. Aber Kollegen sichern lieber Pfründe und haben tausend Gründe, warum sie mehr Wert sind, als andere…..
Um Wert geht es nicht, aber mich ärgert es durchaus, wenn ich mir z. B. nach den Pfingstferien, die ich mit Abitur- und diversen anderen Korrekturen verbracht habe, vom Sport/Relikollegen erzählen lassen muss, wo er in den Ferien (nicht: unterrichtsfreie Zeit) wieder Cooles hingefahren ist. Und das habe ich in 30 Jahren Dienst viele, viele Male erlebt.
Die Sport/Reli Kollegen haben mittlerweile auch ein Abitursfach, in der Regel.
Selbstbeweihräucherung halt.
So ein Quatsch. Es geht darum, dass bitte keiner mehr arbeiten muss als seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit – egal an welcher Schulform. Dazu muss individuelle die Arbeitszeit jedoch endlich mal erfasst werden. Und ja, Leute, die sich jetzt so durchmogeln, werden dann mehr arbeiten müssen. Ich glaube aber nicht, dass das mehr als 20% sind, eher deutlich weniger.
Dann sagen Sie mir bitte, wie diese selbsterhöhenden Kommentare einiger GYLehrkräfte hier zustande kommen, die meinen, nur weil sie etwas vertiefend Mathe, Physik, Englisch oder Deutsch etc. studiert haben, sie spielten als Lehrer in einer ganz anderen Liga?
Und dann gab es noch den einen oder anderen Kommentar, dass GS Lehrer dann noch mehr Unterrichten müssten….
Ein Kommentar zog in Zweifel, dass die Bezahlung A13 gerechtfertigt sei….
Und ja, das nenne ich Pfründe sichern.
Ich könnte mich auch darüber aufregen, dass in der Studie ganz klar herausgefunden wurde, dass Schulleiter ganz weit über dem Soll liegen und trotzdem GS-Rektoren weder deutlich mehr Gehalt bekommen noch eine weitere Entlastung vorgesehen ist. Ich könnte sogar soweit gehen, dass ich darüber abätze, dass meine Kolleginnen nun bald einen verschwindend geringen Gehaltsunterschied zu mir (zu meiner Konrektorin genau noch 1 € je Deputatstunde) haben….das tue ich aber nicht, denn deren Arbeitsbelastung sind nicht Schuld an meiner Belastung und deren (verdientermaßen) A13 ist absolut gerechtfertigt. Ich muss nicht nach unten treten, damit es mir besser geht, aber einige hier tun das und das ist Bah!
Habe ich mal als Standesdünkel gebrandmarkt.
Laut letzter VBE-Mail hat die Landesregierung auch absehbar nicht vor, daran was zu ändern. Grund? Wie immer: die „angespannte Haushaltslage“. Das lässt für die kommenden Gehaltsverhandlungen allgemein nur Böses ahnen…Der VBE geht übrigens davon aus, dass sich ab Sommer genau wegen der Bezahlung viele SL entpflichten lassen. Wäre das eine Lösung? Oder sind Sie eh die arme Dienstälteste, die den Job dann für´n feuchten Händedruck machen muss?
Nein, das ist keine Lösung, denn ich mache den Job grundsätzlich gerne. Und nein, ich bekomme schon ein bisschen mehr als eine feuchten Händedruck 😉
Hier kann jeder alles schreiben, und ich denke, dass hier so mancher unter falscher Flagge segelt, um Sie genau dahin zu bringen, wo Sie und dickebank und andere jetzt sind.
Mal aus meiner Sicht:
Ich finde im Schuldienst gleiche Bezahlung aller Personen mit gleicher Ausbildung (2. Staatsexamen resp. vergleichbarer Abschluss) gerecht. Dazu gehören dann allerdings auch angestellte Lehrkräfte und Seiteneinsteiger, die sich entsprechend qualifiziert haben.
Ich finde, so wie Sie, den Unterschied in der Bezahlung von Schulleitung und „normalen“ Lehrkräften zu gering.
Ich denke, dass es durchaus unterschiedliche Anforderungen im Studium zwischen einzelnen Fächern und einzelnen Schulstufen gibt, allerdings begründet dies meiner Ansicht nach keinen Gehaltsunterschied.
Ich bin der festen Überzeugung, dass es dringend der Erfassung der individuell benötigten Arbeitszeit bedarf, um der Überlastung der überwiegenden Mehrheit der Kollegen ein Ende zu bereiten. Auf der Datenbasis eines Jahres kann dann der Einsatz im Folgejahr geplant werden. Modellhaft kann man ja mal nach Schweden schauen, wie der Einsatz einer Lehrkraft dort erfolgt.
Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass wir nicht mehr bei fünf vor zwölf, sondern bei Viertel nach drei stehen, was das Bildungssystem in D betrifft. Die Kipppunkte sind überschritten. Trotz massiver Anstrengungen der tatsächlich im System Arbeitenden rauschen die Effekte weiter gen Keller, da das System unglaublich träge ist und, was schlimmer wirkt, von Politik und Gesellschaft außer lauwarmer Luft nichts zu erwarten ist: im Gegenteil, es wird noch gekürzt. Das führt dazu, dass die jetzt noch Engagierten noch schneller ausbrennen. Ist wie beim Klimawandel: jahrelang auf die Folgen hingewiesen, jahrelang ignoriert worden, und jetzt sterben die Korallenriffe unwiederbringlich, Extremwetterlagen nehmen zu, die Menschen spüren die Folgen und trotzdem wird dem Verbrenner und der Gasheizung gehuldigt.
Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiss.
Da bin ich sehr bei Ihnen, denn ich habe da auch keinen Bock mehr auf den Scheiß!
Ich bin nur immer wieder verwundert, wie wenig einige Kollegen über den Tellerrand gucken können und so sehr in in ihrer eigenen Biographie verfangen sind.
Ich habe aber, ich kann aber, ich tue aber…..nicht kapierend, dass es hier um alle der lehrenden Zunft geht, dass hier alle echt viel arbeiten, dass es für alle schwierige Rahmenbedingungen sind und das es nichts bringt sich gegeneinander abzugrenzen….
Wir wollen doch alle das gleiche und dazu muss man an einem Strang ziehen, sonst wird das nichts…..
Auf Ihre ziemlich tunnelhafte Haltung und die Diffamierung Andersdenkender hat sicher auch keiner Bock, der differenzierter denkt.
Vielen Dank für Ihren Beitrag. Genauso ist es! Unerträglich, wenn sich GYKollegen sich hier so darstellen, als wenn GSKollegen Lehrer 2.Klasse wären, nur weil diese kleine Kinder unterichten. Nach dem Motto: Für mehr als das kleine Einmaleins hat es nicht gereicht. Der AbiSchnitt an meiner Uni lag jahrelang bei 1,7. Ich wollte gerne mit jüngeren Kindern arbeiten und habe deshalb auf GS studiert. Kollegen an der Förderschule verdienen ebenfalls A13. Ich arbeite an einer Inklusionsschule, muss Gutachten schreiben, habe eine Bandbreite an Schülern, wie sich das GYKollegen nicht vorstellen können. Ja, der Korrekturaufwand ist sicher nicht so zeitaufwendig, der Vorbereitungsaufwand mit Dreifachdifferenzierung ist dagegen immens! Die Elternarbeit ebenso. Diese Abqualifizierung durch Kollegen (allen voran der Philologenverband) ist ekelhaft. Es ist eine Neiddebatte. Hauptsache dem Nachbarn gehts schlechter als mir.
Es wäre zauberhaft, wenn Sie nicht so generalisieren würden.
Neben mir gibt es sehr viele Gymnasiallehrer, die Ihre Arbeit ebenso wertschätzen wie die eigene. Wenn mir jedoch permanent eingeredet wird, wie Scheisse wir Sie angeblich finden, hab ich irgendwann keine Lust mehr, Ihnen diesbezüglich zu widersprechen und spare meine Kraft für Wichtigeres.
Auch Ihnen möchte ich noch mal Folgendes sagen:
Nicht jeder, der sich hier als GS-Lehrer, Gy-Lehrer, Sonderpädagoge oder Ähnliches ausgibt, ist ein solcher. Auch hier sind Putins Trollfirmen und rechte Gesinnungsgenossen unterwegs, um zu spalten und zu hetzen. Und die wissen gut, welches Knöpfchen man drücken muss… Sieht man ja an den Reaktionen.
Also: Jede Schulform hat ihre Herausforderungen. Das ist anzuerkennen. Punkt.
Lesen Sie doch mal oben die abwertenden Kommentare hier und zu anderen Beiträgen über die Bezahlung von GS Lehrkräften. Da kann man schon schlussfolgern, da man leicht von oben auf uns herabblickt. Erfahre ich häufig auch bei Rückmeldegesprächen, ebenso wie meine Kolleginnen. Von daher sparen Sie sich die Vorwürfe, dass ich generalisiere.
Sie generalisieren über alle Gymnasiallehrer drüber und werfen gleichzeitig denselben vor, zu pauschalisieren.
Ich glaub inzwischen nicht mal mehr, dass Sie eine Lehrkraft sind: ein echter (im Sinne von lebendig und tatsächlich im Beruf stehender) Lehrer würde die Widersprüchlichkeit dieses seines Handelns bemerken.
Ehrlich gesagt, ich habe auch mehrheitlich schlechte Erfahrungen mit Gymnasiallehrern gemacht und daraufhin die Schulart gewechselt. Nur mal so nebenbei ………
Irgendwas stimmt mit Ihnen nicht!
Ich bin seit 25 Jahren Lehrerin an einer Grundschule in RLP. Wie kommen Sie eigentlich zu solchen Behauptungen? Bekommen Ihnen die Ferien nicht?
Sie trollen dermaßen rum: das ist jetzt echt unter meinem Niveau.
Hallo, gehts noch???? Kommen Sie mal wieder runter.
Genauso so ist es! Diese gegeneinander Ausspielen ist der Tod im Topf.
Und ganz ehrlich, in der Zeit, wo Einstellungsstopp war (ab 1996\97] habe ich (Primimäuschen) Nachhilfe gegeben für Mathematik in der SEK II und anschließend Mathe und Deutsch in einer Fortbildungsakademie für Erwachsenenkurse (Mediengestalter) unterrichtet, sowie EDV Kurse für Fortgeschrittene unterrichtet……kann ich also auch….kann aber auch für ganz klein…..wenn man will, ist auch ein GS-Lehrer fix eingearbeitet…..so eine abgehobene Sache ist das nämlich gar nicht…..
Jau, und ich habe die Anerkennung für Lehramt SekI+II seitens der Bez.-Reg. MS zuerkannt bekommen, habe mich aber aufgrund der anerkannten Fächer für die SekI entschieden.
In der SekI gab es einen Bedarf und die Aussicht auf Übernahme nach dem Vorbereitungsdienst. Also lieber den spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.
Haben Spatzen Ohren?
ja, mein Spatz:)
Tagträumen Sie weiter, aber bitte ohne mich.
Der Joke musste sein, bei der Steilvorlage. Konnte ich mir nicht entgehen lassen.
Hätten Sie mal besser den Frosch und die Frage nach den Locken genommen
Schon klar. Also für Sie besser Frösche in der Hand als auf dem Dach nach Locken suchen ?
Frösche in der Hand nicht, aber Kröten in der Tasche.
Und das einzige was lockt, ist durch den Film mit BB ja ebenfalls bekannt.
Mag für krötenorientierte Schwerenöter gelten.
Tja, ist der Ruf erst ruiniert …
Primimäuschen –
diese Bezeichnung für uns GS-Lehrer kenne ich auch noch von früher
Was ist denn die genaue vertraglich geregelte Arbeitszeit? Bitte keine individuellen Arbeitsaufwände …..
Ich bin mir sicher, dass Sie es als ausgebildete Lehrkraft schaffen, zu ergoogeln, wie hoch die wöchentliche resp. jahresgemittelte Arbeitszeit für Beamte in Ihrem Bundesland ist. Ich vertraue weiterhin darauf, dass Sie in der Lage sind, dies durch Lesen des Par. 44 TVL auf Ihre angestellten Kollegen zu übertragen.
Mit freundlichen Grüßen,
Mika
Lehrer sind zwar Beamte, aber kaum mit anderen Beamten vergleichbar. Und dass die angestellten Lehrer hoffnungslos benachteiligt sind, darüber brauchen wir ja wohl nicht zu sprechen.
Merken Sie, dass Sie immer mehr in Arroganz verfallen? Schlechter Berater…..
Der 44er überträgt nicht, er oktroyiert.
Das ist ein gewaltiger Unterschied .
Jo, aber in der Auswirkung machts halt keinen Unterschied.
“Dabei gilt zu beachten, dass ‚Korrektur‘ einen vergleichsweise hohen Anteil der Arbeitszeit von Gymnasiallehrkräften ausmachte”
Ich würde dies durchaus als emotionale Belastung empfinden, zumal diese (so nehme ich an) gebündelt und nicht verteilt stattfinden…
Auch wie viel Sinn das Aufrechnen gegeneinander ergibt, dürfte angestellte Lehrkräfte brennend interessieren :/
Ja, aber da kann man sich auch zu helfen wissen: Minimum an Leistungskontrollen/Klassenarbeiten, keine freiwilligen Leistungen, Lückentexte, MP-Aufgaben, “unsauber” korrigieren. Das geht auch in Deutsch. Ist zwar nicht schön, aber da soll sich mal einer beschweren. Übrigens stelle ich bei diesen Aufgaben kaum einen Leistungsunterschied fest zu herkömmlichen Schreibaufgaben. Alternativ: Antrag bei der Klassenkonferenz, dass man eine Note mit weniger Leistungskontrollen/Klassenarbeiten als erforderlich erteilt.
Das geht in Mathe nicht,
Vielleicht lieber auf digitale Verfahren umstellen, bevor “unsauber” korrigiert wird.
Bin allerdings auch an einer Förderschule, kann da nicht viel zu den großen Arbeiten anmerken.
“Unsauber” klingt mir da jedenfalls nicht angemessen
Wie Sie unterrichte ich Korrekturfächer an einem BY-Gymnasium und erlebe das alles auch. Der damit verbundene Zeitaufwand interessiert den Dienstherrn null, Hauptsache, man kommt mit der Jutetasche voller Schulaufgaben termingerecht zur Tür herein. Und das muss endlich aufhören!
Das ist wirklich heftig. Genau die Dinge, die sie vorschlagen, sind in meinem Bundesland möglich, bzw. werden einfach gemacht, da es sowieso keiner kontrolliert.
Bei uns in der GS sind sogar 4-5 Arbeiten in D, M und E im Halbjahr fest vorgeschrieben
Am Ende muss von den Lehrkräften gar nichts gegeneinander ausgerechnet werden. Einfach die reale individuelle Arbeitszeit erfassen , wie es die Rechtslage vorschreibt.
Wer dann mehr und wer weniger arbeiten muss als vorher, ergibt sich dann auch individuell.
Detaillierte Stellen- und Arbeitsplatzbeschreibung und eine darauf basierende Arbeitszeiterfassung sind eben unabdinglich.
Die Stellen- und Arbeitsplatzbeschreibungen werden dann nämlich aufzeigen, dass es durchaus Unterschiede in den Aufgabenbereichen von Lehrkräften der unterschiedlichen Schulformen gibt. Ebenso wird sich vermutlich herausstellen, dass die Tätigkeitsmerkmale von Lehrkräften in Abhängigkeit von den von ihnen unterrichteten Fächern abhängt.
Für die reine Arbeitszeiterfassung ist das aber zunächst einmal vollkommen irrelevant, da geht es nur darum zu erfassen wer für welche zuseinem Aufgabenbereich gehörenden beruflichen Tätigkeiten wie viel Zeit benötigt.
Daraus resultierte Arbeitszeitvorgaben z.B. für Korrekturen sind dann Teil nachfolgender tariflicher Vereinbarungen, ebenso wie Zulagen für besondere Inanspruchnahmen oder Gefährdungssituationen – so wie in anderen teilen des ÖD auch.
So mag ich die dickebank!
Und dennoch werde ich hin und wieder durch Trollen provozieren. Vor allem, wenn sich Diskussionen im Kreis drehen und mir fürchterlich auf den Senkel gehen.
Konstruktivismus ist was Feines, nur gegenüber dem einen oder anderen auch perlen vor die Säue geschmissen.
Mach das, aber lass mich aus. Ich bin eine von den Guten…
Weiß ich doch, auch wenn ich hin und wieder Rundumschläge verteile.
😉
Prinzipiell stimme ich zu, dass es individuelle Unterschiede gibt, aber die Ungenauigkeiten wären mit hier persönlich zu hoch.
Sind die Leistungen in der Klasse homogen oder versucht die Lehrkraft, diese homogen zu halten (bspw. indem sie nicht differenziert)?
Wird eine Lehrkraft für besonders herausfordernde Schüler*innen mehr Geld erhalten – wird sie nicht – oder erhalten Kolleg*innen weniger, wenn sie in der Planung schnell voran- und vor allem mit dem Stoff durchkommen?
Ich finde, das ist ein riesiges Feld mir nur einer Gewissheit: dass die Dienstherr*innen das günstigste Modell wählen werden… :/
“Prinzipiell stimme ich zu, dass es individuelle Unterschiede gibt, aber die Ungenauigkeiten wären mit hier persönlich zu hoch.”
Sie und keine Ungenauigkeiten? Wäre ja mal was ganz Neues. Wir schätzen Sie alle für Ihre Expertise – ganz ohne Bauchgefühl und Empfinden.
“Sind die Leistungen in der Klasse homogen oder versucht die Lehrkraft, diese homogen zu halten (bspw. indem sie nicht differenziert)?”
Basiert das gegliederte Schulsystem denn nicht auf überwiegend homogenen Gruppen? Ohne eine “Range” zumindest macht das gegliederte System auch absolut keinen Sinn. Ob man jetzt innerhalb der (Range an) homogenen Gruppen nochmal zieldifferenziert oder binnendifferneziert arbeiten “muss” lässt sich kritisch betrachten und diskutieren. Ob das gegliederte System “ein gutes System” ist ebenfalls. Von “fair” … Brauchen wir hier erstmal gar nicht sprechen. “Fair” in Bezug auf wen und was wäre dazu erstmal zu klären.
Also … Wo steht man … Was will man/wo will man hin … Wie will man das. Und je nachdem ist “homogen” gar nicht so schlimm. Es ist dann nur anders.
“Wird eine Lehrkraft für besonders herausfordernde Schüler*innen mehr Geld erhalten – wird sie nicht – oder erhalten Kolleg*innen weniger, wenn sie in der Planung schnell voran- und vor allem mit dem Stoff durchkommen?”
Interessanter Satzbau … Wer würde das denn definieren? An wann ist ein SuS “herausfordernd”? Welche Faktoren würden Sie hierfür nehmen und empfehlen? Darf man dann “das Zusammenstellen” wie man will als LuL? Wie funktioniert das?
Ab wann “kommt” man denn mit dem Stoff durch? Bei Erwähnung? Bei Vertiefung? Wenn es einer/eine kann? Wenn es alle können?
“Ich finde, das ist ein riesiges Feld mir nur einer Gewissheit: dass die Dienstherr*innen das günstigste Modell wählen werden… :/”
Tjo, und dann? Dann gibt es halt eben bspw. “nur Bucharbeit”. Geliefert wie bestellt. Schade? Ja. Logisch? Auch. Kann man das ändern als AG? Ja. Wer trägt die Verantwortung und Rahmen? Ah. Der AG.
Hier darf man dann eben nicht auf den Trick der Selbstaufopferung zugunsten des AG hereinfallen. Der AG ist verantwortlich. Wir arbeiten dann unter den Rahmen. Und wenn hier xy nicht machbar ist … Pech. Dann liegt es am AG diesen zu stellen, wenn das der Wunsch und die Erwartung ist.
Oder … Falls Sie das anders sehen … Sie machen das halt. Nehmen Sie gerne diese Verantwortung auf und machen Sie … Ihre Sache dann.
Darüber, dass Lehrer an Gymnasien mehr leisten als an Grund- und Sekundarschulen, lässt sich streiten. Nur weil der Unterrichtsstoff schwieriger ist, heißt das nicht , dass ein Grundschullehrer nicht weniger zu tun hat. Im Gegenteil, der bereitet nämlich seinen Unterricht nicht nur für eine Gruppe vor, sondern hat auch noch 2-3 Fördeschüler unterschiedlichen Niveaus und 5-6 Migrationskinder in der Klasse sitzen, muss Fördergutachten und Förderpläne erstellen und sehr viel Elternarbeit leisten. Umgedreht wird ein Schuh daraus.
Unabhängig davon, dass ich nichts vom „Ätschi, ich arbeite mehr als Du“ halte: das haben wir auch am Gym.
Erzählen Sie mir bitte nicht, dass sie dreifach differenzieren müssen. Da lach ich mich schlapp!
Auf zwei Anforderungsniveaus (Inklusion), verminderter Aufgabenumfang (Inklusion), Bereitstellung von Hilfsmitteln und stark vergrößerte Kopien (A4 auf A2) wegen massiver Sehschwäche, stark vereinfachte Sprache und entsprechende Anpassung des Aufgabenumfangs wegen DaZ. Nicht in jeder Klasse alles, aber keine Klasse ohne.
Lachen Sie gern, das hält jung!
Und wie ich lache! Danke fürs Junghalten! Erzählen Sie hier keine Märchen, dass am Gym ähnlich differenziert wird wie in der GS.
Die Inklusion ist längst angekommen in den Gymnasien. Glauben Sie mir oder lassen Sie es – mir völlig egal.
Sie scheinen in einer Blase zu leben, in der nur Ihre Meinung und Realität existiert. So, wie Sie hier auftreten, versuchen Sie, Schulformen gegeneinander auszuspielen. Sie werden Ihre Gründe dafür haben: im Interesse der Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte agieren Sie so jedenfalls nicht.
Mit freundlichen Grüßen,
Mika
Und nicht zu vergessen die SE- Schüler:innen, die ADHS-Kinder, die Verhaltenskreativen und diejenigen, die mitten im Schuljahr in die Klasse kommen, weil sie aus Haupt-/Realschulformen abgeschult worden sind, nachdem die Statistik abgeschlossen und die Lehrer:innenstunden safe sind, oder die man weggedealt hat, dass sie am Gymnasium die Versetzung dann doch schaffen. Herausfordernd, aber mit A14 aufwärts schaffen wir das.
Aber Mehrfachintegrale oder mehrfache Ableitungen Differentialrechnung) sind auch arbeitsaufwendig.
So isses! Vielleicht meint Mika das. Das erklärt dann einiges.
Ungleichgewicht zwischen Schularten – Lehrkräfte an Gymnasien und beruflichen Schulen leisten deutlich mehr Stunden, ohne entsprechenden Ausgleich.
Niemals! Ich unterrichte gerne an einer KGS im G-Zweig, weil es dort viel entspannter ist als in den anderen Zweigen. Die Belastung in den anderen Zweigen entsteht durch das „tolle“ Verhalten und die beispielhafte Erziehung.
Mhmmm, die Studie sagt auch aus, dass Lehrer an einer Berufsschule auch entsprechend der Solllinie arbeiten…..also passt doch….
Habe mich über den Artikel auch gewundert, denn die Studie sagt anderes….
Wir brauchen:
4-Tage Woche
30% Homeschooling / online
Gehalt im 18 % rauf
DB & GK digital
Das Gute an Hausaufgaben ist, dass ich meinen Kindern so besser helfen kann mit meiner Bildung als viele andere Eltern. So haben jene später bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt als viele andere ihrer Altersgenossen.
Ist vollkommen okay so. Sek 2er sind im.höheren Dienst, Sek 1erbim gehobenen. Die Aufstiegsmöglichkeiten sind trotz A13 für alle im Gehobenen de facto nicht gegeben. Von daher ist es logisch, dass jene mehr arbeiten als diese.
Herzlichst
Euer Haupti
Das sehe ich als erfahrene schweizer Lehrkraft und Mutter zweier nun erwachsenen Kinder anders. Wir Drei haben erlebt: Je höher die Schule, umso weniger setzten sich Lehrer ein!! Nicht nur was die persönliche Begleitung von Lernenden angeht. Oft wurde nur Lehrmaterial aus früheren Jahren gezückt, Tests nicht neu geschrieben sondern nur minim umgeändert, Schüler wurden mit den korrigierten Prüfungs-Retouren dauernd vertröstet und hatten viel zu späte Rückgaben.
Faule Eier in einem Lehrerteam gab und gibt es immer. Was kaputt macht ist, dass die Lehrpersonen gezwungen werden, in mehreren Gremien teilzunehmen mit zig Sitzungen, feste Ämter in der Schule zu übernehmen, an dörflichen Anlässe mit Schüler teilzunehmen, interne Fortbildungen werden erzwungen, oft pro Jahr drei Themen gleichzeitig. Der Lehrer muss dafür auch Berichte lesen und Aufgaben erfüllen. Man darf zu recht behaupten: Es wird alles getan, um den Lehrer von der eigentlichen Aufgabe, nämlich Unterrichtsstoff an SchülerInnen nachhaltig zu vermitteln, wegzuführen.
Der Lehrer hat immer weniger Zeit für diese eine Hauptaufgabe.
Das System ist falsch und Politiker, welche nur selber glänzen wollen indem sie dieses Thema wählen- aber keine richtigen Taten zeigen und Mut zur Umstrukturierungen oder gar Reset.
Würden externe Personen die Schul-Ämter führen- ich spreche von einem ganz neuen Berufsbild, das es so noch nicht gibt- gäbe es keine internen Fortbildungen mehr geben, die bei dem häufigem Personalwechsel wo ist eh keinen Sinn machen- würden Schulleiter die Schulen nur leiten und nicht persönlichen Stempel in einer Gemeinde aufsetzen wollen- würde Schwimmunterricht, Waldbesuche, Zahnpflege, Teilnahme an Dorfanlässe und ähnliches wieder als Bildungsauftrag an die Eltern zurück gelangen, wären Therapien wie DaZ, Logopädie, ISF wieder ausserhalb der Unterichtszeit und nur begleitet integrativ wenn es um den aktuell ausgeführten Lehrstoff der LP geht oder um Integration in den Klassenverband- würde man das Eintrittsalter der Kinder für den Kindergarten wieder hinaufsetzen- hätte jede Lehrkraft im Zyklus 1 nur ersten Semester eine tägliche Assistenz zu Gute- würden alle 5- Jährigen täglich den Kindergarten nur morgens besuchen aber immer 1 Stunde früher heimgehen dürfen- würden Ausländer gezwungen werden, ausserhalb der Schule mit den Kindern Deutschkurse zu besuchen, denn Sprache ist nun mal der Schlüssel zu allen Unterrichtsstoffen…
Wäre das wesentlich mehr den wahren Bedürfnissen angepasst. Der Lehrer kann wieder unterrichten. Das System war vor 30 Jahren definitiv besser.
Geld regiert auch das Schulwesen. Mir unbegreiflich, warum ein Land nicht in die unterste Sprosse der Pyramide am meisten investiert. Gut ausgebildete Kinder und später Erwachsene helfen der eigenen Wirtschaft.
In der Tat kann man den Eindruck haben, man möchte, dass das Volk dumm bleibt. Dass ein angeblich reiches Land nicht schafft, im eigenen Land ein einheitliches Schulsystem zu führen, dass niemand den Mut hat laut auszusprechen, dass die Zunahme von Einwanderer das Bildungssystem herabsetze…auch wie man miteinander umgeht…
Fehler geschehen. Aber in der Schweiz kehrt man alles unter den Teppich und guckt nur voll fokussiert auf Not-Anpassungen und Neuerungen. Auf einer schlechten Erde kann aber niemals ein gesunder Baum sprießen.
Na ja, vom Waldsterben spricht ja auch plötzlich niemand mehr….
Auch ohne Studie steht fest: Grundschullehrkräfte haben die höchste Wochenstundenverpflichtung und verdienen am wenigsten. Der Gymnasiallehrer für Sport und Erdkunde lacht sich ins Fäustchen.
Man sollte Äpfel nicht mit Birnen vergleichen.
In BB bekommen die grundständig ausgebildeten Lehrer aller Schulformen A/E13. Soweit ich weiß, ist das inzwischen in einigen.Bundesländern so.
In einigen. Aber eben nicht in allen!
Sport und Erdkunde gibt es als Fächerkombination schon lange nicht mehr.
Na klar, zum Beispiel an der Humboldt-Uni.
NRW
Ich glaube, dass man die Schulformen nicht miteinander vergleichen kann, da es andere Arbeitsschwerpunkte gibt.
In der Grundschule sind es Folgende:
die Elternarbeit ist ein großer zeitlicher Faktor (tägliche Gespräche, Telefonate, E-Mails, sonstige Nachrichten und nicht nur beim Elternsprechtag)
in Klasse 1/2 kommt die Unselbstständigkeit der Kinder hinzu, die ein Kontrollieren aller Arbeitsergebnisse unabdingbar macht (das ist nicht so anspruchsvoll wie in der Oberstufe, steht der Arbeit aber zeitlich in nichts nach, da es alle „Produkte“ der Kinder betrifft und nicht nur die Korrekturen der Klassenarbeiten
viel differenziertereres Arbeiten, da die Unterschiede der Kinder viel größer sind
die Arbeit als Klassenlehrerin ist in der GS ein noch größerer Zeitfaktor als in der weiterführenden Schule
Zusätzliche Arbeiten, für die es an der weiterführenden Schule Anrechnungsstunden gibt, müssen an der GS zusätzlich erledigt werden ohne Anrechnung
die Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Stellen/Personen wie Jugendamt, Familienhilfe, Integrarionskräften etc.
Und dann muss man noch bedenken, dass es einen hohen Anteil von Teilzeitbeschäftigten gibt, die die ganze Arbeit, die außerhalb der Deputatsstunden zu erledigen sind, in vollem Umfang erledigen müssen, da sich die Teilzeitreduzierung nur auf die Unterrichtsstunden bezieht.
Was aber für alle Schulformen gilt:
Die tatsächliche Anzahl der Wochenstunden hängt immer auch davon ab, wie sehr ich mich für meinen Beruf einsetze.
Ich kenne (sehr wenige!!) Kolleginnen, die sehr pünktlich das Schulgebäude verlassen, Unterricht nach Buch machen und nur das Nötigste für die Schule machen. Das sind die, die dann wahrscheinlich bei 35 Stunden in der Woche rauskommen.
Dann gibt es Kolleginnen, die sich für ihre Klasse total aufopfern, tolle Klassenräume gestalten, damit sich die Kinder wohlfühlen, stundenlang differenzierte Materialien für ihre Kinder gestalten, um sie optimal zu fördern, qualitative Unterrichtsstunden planen und viel Zeit in die Schulentwicklung und in zusätzliche Aufgaben investieren. Das sind dann die, die locker bei 50 Stunden in der Woche landen.
Ohne diese Lehrkräfte würden die Grundschulen als System zusammenbrechen, das ist halt auch die Wahrheit.
Dann gibt es noch die Kolleginnen (davon wird es die meisten geben), die sehr engagiert sind, dabei aber versuchen, die Arbeitsbelastung nicht ganz ausufern zu lassen. Die landen dann bei ca. 45 Stunden in der Woche.
Solange das Deputatsmodell gilt, wird es nie ganz gerecht sein.
Toller Kommentar, genauso sehe ich das auch.
Sehr geehrtes Forschungsteam,
ich bin Gymnasiallehrerin für Deutsch und Englisch in meinem 40.Dienstjahr, unverbemtet in Sachsen-Anhalt und kann Ihr Ergebnis in jeder Hinsicht nur bestätigen und hoffe für die jungen Kollegen auf ein neues System.
Ich war 44 Jahre Lehrer für Englisch und Deutsch am Gymnasium mit voller Stelle. Im Herbst und späten Frühjahr hatte ich selten ein freies Wochenende.
Wieder die Prämie zum 45. Dienstjubiläum eingespart. Da haben aber die Sektkorken geknallt.
Abhilfe würde eine Arbeitszeiterfassung bieten. Diese ist im übrigen für andere Arbeitsverhältnisse vorgeschrieben!
In Bayern erhalten Grundschullehrkräfte eine zwei Gehaltsstufen schlechtere Bezahlung als Berufsschul-, Förderschul- oder Gymnasiallehrer.
Als Lehrer für Deutsch als Fremdsprache schaue ich mir das an und denke: Ich arbeite 41 Stunden die Woche vor meinen Kursen und verdiene im Krankheitsfall und in den Ferien nix. Dafür gehen knapp 50 Prozent des Verdiensts zurück an den Staat. Korrekturarbeiten, Vor- und Macharbeiten, Organisation ist alles extra und kommt zu den 41 Stunden dazu.
Sorry, aber dass Vollzeit Grundschullehrkräfte so viel weniger arbeiten, als Gymnasiallehrkräfte, das halte ich für ein Gerücht. Da hätte ich gerne mehr Informationen, wie diese Angaben erhoben wurden.
Moin,
Vorab, ich bin Gymnasiallehrer mit einem Hauptfach.
In dem Artikel klingt deutlich mit, dass unterschiedliche Arbeitszeit mit unterschiedlicher Belastung gleichzusetzen ist und indirekt erkenne ich da eine Forderung nach Mehrbezahlung oder Stundenverringerung für LuL von korrekturaufwendigen Fächern im Gymnasium. Ich glaube das sind tatsächlich auch die KuK, die die größte Lobby haben.
Was in der Diskussion immer fehlt ist die qualitative Beleuchtung der Belastungen. Es macht einen riesen Unterschied, ob du in der Grundschule den Kids das absolute Elementarste beibringst, die alle gar nicht lesen und schreiben können, zum Teil kein Deutsch können und aus sozial schwachen Familien kommen, kein bitte und danke kennen, Konflikte mit Händen klären und zu Hause 10h vorm eigenen Handy suchten…
Oder ob du ne schöne vorselektierte Klasse aufm Gymmi unterrichtest, die natürlich 1000 mal homogener ist: im Elternhaus, den sozialen Strukturen, der Lernbereitschaft und Lernfähigkeit, den Sprachkenntnissen etc. dafür musste dann halt 3 oder 4 h mehr in der Woche korrigieren, gemütlich zu Hause auf der Hollyschaukel oder nebenbei, wenn der Partner den Grilltisch vorbereitet.
Wie gesagt ich bin Gymnasiallehrer und habe mehr Korrektureaufwand als die GS KuK, aber holy cow um keinen Preis mag ich mit den KuK an der GS wechseln.
Der Artikel ist unvollständig und unfair.
Hier gehen Grüße an alle GS Helden und Heldinnen raus! Ihr macht grandiose Arbeit!
Bleibt gesund!