HAMBURG. An der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule in Hamburg-Osdorf zeigt sich, was passiert, wenn Architektur und Pädagogik von Anfang an zusammengedacht werden. Der Neubau ist nicht nur ein architektonisches, sondern auch ein pädagogisches Statement – entstanden aus einem intensiven Beteiligungsprozess.

„Die Räume verändern die Pädagogik. Wir arbeiten nicht mehr hinter geschlossenen Türen, es herrscht mehr Offenheit. Das hilft uns sehr“, sagt Schulleiter Dirk Voss, der die Geschwister-Scholl-Stadtteilschule (GSST) seit 2017 leitet, laut einem Beitrag auf ganztagsschulen.org, einem Portal des Bundesbildungsministeriums für Bildung und Forschung. Wer das Gebäude betritt, versteht sofort, was er meint: wenig Flure, viel Glas, übersichtliche Lerncluster, in denen sich Klassenräume und Differenzierungsräume und -zonen zu einem großen Lernraum verweben – die Schule wirkt einladend, transparent und zugleich ruhig.
Der Neubau am Osdorfer Born ist eines der größten Schulbauprojekte Hamburgs der vergangenen Jahre. Rund 46 Millionen Euro investierte die Stadt in das neue Gebäude mit integrierter Dreifeldsporthalle und Haus der Jugend. Die Schule bietet Platz für rund 900 Schülerinnen und Schüler und rund 80 Lehr- und Fachkräfte. Gebaut wurde nach Plänen von MGF Architekten in Zusammenarbeit mit mo Architekten Ingenieure Hamburg.
Das Architekturbüro MGF beschreibt das Konzept so: „Vier miteinander verbundene Clusterhäuser gruppieren sich um halboffene Höfe und werden von einem weitläufigen Erdgeschoss mit zentralen schulischen Nutzungen zusammengehalten. Durch seine offene Raumformation bildet das Forum zusammen mit der Mensa das Herz der Schule und wird durch Fachräume, Verwaltung und das ‚Haus der Jugend‘ ergänzt.“

Die Fassaden aus hellem, sandfarbenem Backstein sind klar gegliedert, mit feinen horizontalen Versätzen, die an die Altonaer Bauten des in den 20-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wirkenden Architekten und Stadtbaurats Gustav Oelsners erinnern. Im Inneren trifft Sichtbeton auf naturbelassenes Holz – ein Zusammenspiel aus Robustheit und Wärme. „Es entsteht eine einladende Atmosphäre von Geborgenheit“, heißt es in der architektonischen Beschreibung. Glaswände sorgen für Transparenz, ohne Distanz zu schaffen.
Jedes Jahrgangsteam verfügt über ein eigenes „Cluster“ aus fünf Klassenräumen mit Differenzierungsangeboten und einer multifunktionalen Mitte – nutzbar als Gruppenraum, Bewegungsfläche oder Rückzugszone. Die Lehrkräfte arbeiten nicht in einem zentralen Lehrerzimmer, sondern in Teamstationen, die in den Clustern verankert sind. Unterricht und pädagogische Arbeit werden so räumlich zusammengeführt.
Die Schule wurde 2021 fertiggestellt und bald darauf mit dem BDA-Architekturpreis Hamburg ausgezeichnet. Das Bundesbildungsministerium bezeichnet sie auf seinem Portal ganztagsschulen.org als „architektonisch und pädagogisch ein Hamburger Vorzeigeprojekt“, das „Kindern und Jugendlichen einen sicheren Lern- und Lebensort“ biete.
Der lange Weg dorthin: Die Phase Null
Bevor der erste Stein gelegt wurde, stand eine intensive Planungs- und Beteiligungsphase – die sogenannte Phase Null, begleitet von der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft und einem Schulbauberatungsteam. Ihr Grundgedanke: Schulbau darf nicht erst mit dem Architekturplanung beginnen.
„Die Phase Null ist die entscheidende Phase zu Beginn des Planungsprozesses einer Schule“, heißt es in der Projekt-Dokumentation der Stiftung. „In ihr werden alle wichtigen Weichen für den Planungs- und Bauprozess gestellt.“ Pädagoginnen, Architektinnen, Politik, Verwaltung und Nutzer*innen – also Kinder, Lehrkräfte, Eltern – diskutieren hier gemeinsam, welche Schule sie brauchen.
Schulentwickler Otto Seydel, einer der beiden von der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft beauftragten Schulbauberater, beschreibt diese Aufgabe so: „Wir müssen alle relevanten Akteure vor Ort an einen Tisch bringen und Impulse geben für einen Blick über den Tellerrand. Wir leisten Hebammendienste bei der Entwicklung des pädagogischen Konzepts, das notwendig ist für das pädagogische Fundament des Raumkonzepts.“
In Hamburg war diese Zusammenarbeit besonders anspruchsvoll. Das alte Schulgebäude – ein Bau der 1960er Jahre – war technisch veraltet, seine Struktur überholt. „Die Frage Bestand oder Neubau hat uns am Anfang überaus intensiv beschäftigt“, erinnert sich sein Kollege Jochem Schneider. Drei Monate lang habe man diskutiert, ob eine Sanierung genügen würde. Seydel ergänzt, dass es nicht nur um Technik oder Kosten ging. „Es ging um die Chance, dass ein Neubau zugleich auch als Signal eines Neubeginns verstanden werden kann – mit Auswirkungen auf den Stadtteil insgesamt.“ Schließlich fiel die Entscheidung für den Neubau.
Lernen aus anderen Schulen
Ein Schlüsselerlebnis im Prozess war dann eine Exkursion der Planungsgruppe in die Niederlande. Dort sahen Lehrkräfte, Eltern und Architekten Beispiele für Schulen, die Architektur und Pädagogik radikal neu zusammendenken. „Die Gespräche vor Ort waren in hohem Maße mutmachend, ermunternd und augenöffnend“, berichtet Schneider.
„Während der Exkursion ist die Frage der Machbarkeit von anderen Konzepten deutlich geworden“, erzählt er. „Eine Lehrerin hat gesagt: ‚Wir haben hier Dinge gesehen, die konnten wir uns bislang noch nicht vorstellen – jetzt wollen wir auch unsere Ideen in Hamburg umsetzen.‘“ Dieser Perspektivwechsel war entscheidend. Die Planungsgruppe begann, Schule nicht mehr nur als Gebäude, sondern als Lebensort zu denken – mit Rückzugsräumen, offenen Lernlandschaften und Begegnungszonen.
Zugleich wurde die Rolle der Schule im Stadtteil neu definiert. „Wenn man sagt, ‚Schule ist Teil des Stadtteils‘, dann stellt sich die Frage, welche Form von Beziehung und Teilhabe es zwischen Schule und Stadtteil gibt“, so Schneider. Besonders das Zusammenspiel zwischen Schule und Jugendzentrum war ein zentrales Thema: Wie viel Offenheit ist möglich – und wo braucht es Grenzen, um Geborgenheit zu bewahren?
Das Ergebnis: Ein Lern- und Lebensort mit Magnetwirkung
Das Ergebnis dieser Planungsarbeit ist heute sichtbar und spürbar. Das neue Gebäude ist nicht nur funktional und energieeffizient, sondern Ausdruck einer pädagogischen Haltung: Offenheit, Beziehung, Sicherheit. „Unsere Schule soll ein sicherer Lern- und Lebensort für alle Schülerinnen und Schüler sein“, betont Schulleiter Voss. Dieses Ziel prägt den Alltag. Der Ganztag ist rhythmisiert, Lernzeiten und Entspannungsphasen wechseln sich ab. „Wir achten darauf, dass die Entspannung nicht nur am Nachmittag stattfindet und Schule nicht nur am Vormittag“, erklärt Ganztagskoordinatorin Nicola Sterr laut ganztagsschulen.org.
Das Konzept funktioniert, weil es im Raum verankert ist. Die Clusterschule bietet klare Bezugspunkte, ermöglicht aber flexible Lernformen. Kinder können sich zurückziehen oder gemeinsam arbeiten. Sie erleben die Schule als überschaubaren, sicheren Ort – und zugleich als lebendiges Zentrum ihres Viertels.
 Im Zuge des Projekts wurde die Schule Teil des städtebaulichen Konzepts „Bildungsband Osdorfer Born“, das von der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft mitentwickelt wurde. Dabei ging es darum, die Außenräume und Wege zwischen den umliegenden Bildungseinrichtungen – Schule, Kita, Jugendhaus – als zusammenhängende Bildungslandschaft zu gestalten. So entstand ein Campus mit klaren Verbindungen und Aufenthaltsqualitäten, der den Stadtteil pädagogisch und räumlich vernetzt. Das Gebäude öffnet sich bewusst zum Quartier: Das Haus der Jugend, die Sporthalle und die Cafeteria sind öffentliche Orte – ebenso wie die Freiflächen, die bewusst für gemeinschaftliche Nutzung und Begegnung im Freien gestaltet wurden. Vereine, Initiativen und Familien nutzen sie mit. Der Osdorfer Born, lange als Brennpunkt verschrien, gewinnt mit der Schule und ihrem Außenraum ein Zentrum der Begegnung.
Im Zuge des Projekts wurde die Schule Teil des städtebaulichen Konzepts „Bildungsband Osdorfer Born“, das von der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft mitentwickelt wurde. Dabei ging es darum, die Außenräume und Wege zwischen den umliegenden Bildungseinrichtungen – Schule, Kita, Jugendhaus – als zusammenhängende Bildungslandschaft zu gestalten. So entstand ein Campus mit klaren Verbindungen und Aufenthaltsqualitäten, der den Stadtteil pädagogisch und räumlich vernetzt. Das Gebäude öffnet sich bewusst zum Quartier: Das Haus der Jugend, die Sporthalle und die Cafeteria sind öffentliche Orte – ebenso wie die Freiflächen, die bewusst für gemeinschaftliche Nutzung und Begegnung im Freien gestaltet wurden. Vereine, Initiativen und Familien nutzen sie mit. Der Osdorfer Born, lange als Brennpunkt verschrien, gewinnt mit der Schule und ihrem Außenraum ein Zentrum der Begegnung.
Das Bundesbildungsministerium schreibt auf ganztagsschulen.org: „Der Neubau der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule wird durch seine Magnetwirkung den Stadtteil insgesamt aufwerten.“
Lehren aus Hamburg
Die Erfahrung zeigt: Schulbau gelingt nur, wenn er als gemeinsamer Entwicklungsprozess verstanden wird. „Ein gut geplanter Bau, der die Anforderungen des Standorts erfüllt, wird besser angenommen, besser behandelt und verursacht langfristig weniger Kosten“, so die Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft. „Gleichzeitig wertet eine gute, leistungsfähige Schule jeden Standort auf.“
Die Geschwister-Scholl-Stadtteilschule steht heute für eine neue Generation von Lernorten, bei denen pädagogische Entwicklung und räumliche Planung untrennbar miteinander verbunden sind. Der Prozess hat gezeigt, dass eine konsequente Bedarfsermittlung und eine integrierte Planung weit über die Architektur hinauswirken können: Sie werden selbst zu einer Initialzündung für pädagogische Weiterentwicklung, für neue Formen der Zusammenarbeit im Kollegium und für ein gemeinsames Verständnis von Schule im Stadtteil. News4teachers
Zur Dokumentation des Pilotprojekts „Schulen planen und bauen“: https://issuu.com/montagstiftungen/docs/151105_5xphasenull_72ppi_einzelseit
Die Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft unterstützt News4teachers bei der inhaltlichen Gestaltung dieses und weiterer Beiträge des Themenmonats „Schulbau und Schulausstattung“. Hier geht es zu allen Artikeln des News4teachers-Specials.
Und noch ein Rekord… Das neue Redaktionskonzept von News4teachers zieht!



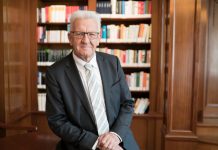







Ich finde das Konzept interessant und anscheinend auch gelungen. Deshalb habe ich noch weitere Artikel über diese Schule gelesen und erfahren, dass sie einen Umweltschutz- Preis gewonnen hat. Eigentlich war ich auf der Suche danach, ob diese Schule eine Klimaanlage eingebaut hat, was mir bei der steigenden Hitze im Sommer bei Ganztagsschulen in Häusern mit viel Glas unbedingt notwendig erscheint. Ich würde mich freuen, wenn dem so wäre und auch das Klimakonzept anderswo als Vorbild dienen könnte. Leider habe darüber nichts gefunden und hoffe, es wurde so selbstverständlich in einer klimaschonenden Form eingebaut, dass es nicht der Rede wert war. Ein Ort zum Wohlfühlen und gleichzeitig mit der Verpflichtung zur Anwesenheit muss zu allen Jahreszeiten angenehm temperiert sein.